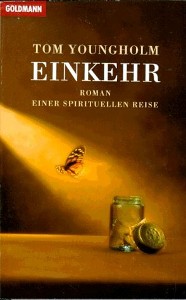
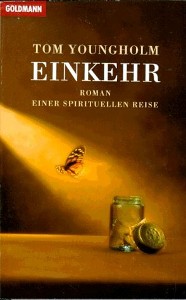
Buch
Irgend etwas fehlte. Selbst in seinen glücklichsten Tagen fehlte Jonathan »Digger« Taylor etwas. Er wußte nur nicht genau, was es war. Und deshalb verbrachte er sein gesamtes bisheriges Leben mit der Suche nach diesem unergründlichen Etwas. Er zog von Florida nach Kalifornien und war Kneipier und Kapitän einer Baseballmannschaft.
Doch Digger verlangt mehr vom Leben – und beschließt, sich seinen uralten Traum vom Komponieren zu erfüllen. Immer wieder aber verfolgt ihn in seinen Träumen die Vision einer finsteren Gestalt. Bis sich Digger eines Tages vor einem entscheidenden Auftritt in Meditationen versenkt und wieder diesem Wesen der Dunkelheit begegnet. Auf der Flucht vor ihm rettet er sich in die »Himmelsbar« – und damit verändert sich sein Leben für immer. Denn Digger trifft dort nicht nur die bizarrsten Gestalten, sondern stößt auch endlich auf die Lösung seines alten Problems, findet den Schlüssel zu den fundamentalen Rätseln seines Lebens.
»Einkehr« nimmt den Leser mit auf eine hinreißend unterhaltsame und zugleich einzigartige spirituelle Reise durch die emotionalen und intellektuellen Fragen unserer Zeit.
Autor
Tom Youngholm lebt in San Diego, wo er schreibt und Seminare zu den Inhalten von »Einkehr« veranstaltet. Sein Buch »Einkehr« verlegte er zunächst im Selbstverlag, wo es – ähnlich wie etwa Marlo Morgans Roman »Traumfänger« – ein überraschender Bestseller wurde. Daraufhin hat der Verlag Doubleday für eine sehr hohe Summe die Rechte an »Einkehr« erworben.
TOM YOUNGHOLM
Deutsch von Ulrike Jung-Grell
GOLDMANN VERLAG
Die Originalausgabe erschien 1994 unter dem Titel
»The Celestial Bar« bei Delacorte Press, New York.
Deutsche Erstausgabe Juni 1996
Copyright © der Originalausgabe 1994 by Tom Youngholm
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1996
by Wilhelm Goldmann Verlag, München
ISBN 3-442-43391-6
Meinen Freunden
Die mich immer bestärkt und unterstützt haben
Ich achte mich in keinem Stück so glücklich,
Als daß mein Sinn der Freunde treu gedenkt.
Shakespeare, Richard d. II.
| Prolog | »Er wußte nicht, was es war, er wußte nur, daß er noch etwas mehr vom Leben erwartete.« |
| 1 | »Liebe … braucht Nahrung und Pflege.« |
| 2 | »Irgend etwas fehlte; was, das konnte er nicht herausbekommen.« |
| 3 | »Es wird schon wieder gehen …« |
| 4 | »Wer war er ohne all diese Menschen und Aktivitäten?« |
| 5 | »Dein Wissen wird bald deine Träume übersteigen« |
| 6 | »In deinem Innern sitzt eine schmerzhafte, quälende Leere, die Linderung verlangt.« |
| 7 | »Balance ist der natürliche Zustand des Universums …« |
| 8 | »Du kannst keine Verbindung eingehen … ehe du dich von deiner Angst gelöst hast.« |
| 9 | »Was die (Welt) wirklich braucht … sind mehr Diener.« |
| 10 | »… du selbst trägst die Verantwortung …« |
| 11 | »Unglück ist die Chance einer neuen Erfahrung; mehr noch – ein Geschenk …« |
| 12 | »Liebe … existiert nicht irgendwo da draußen … Liebe ist eine Entscheidung, und Liebe ist überall.« |
| 13 | »… die Wahrheit fühlen.« |
| Die Suche | |
| Danksagung | |
| Anmerkung |
7
»Er wußte nicht, was es war, er wußte nur,
daß er noch etwas mehr vom Leben erwartete.«
San Diego
Digger fror plötzlich, als ein Windstoß durch seinen Körper fuhr. Er schaute sich um und hatte das Gefühl, verfolgt zu werden. Er stand vor dem Wohnblock, in dem er vor vielen Jahren gelebt hatte, damals, als sein Vater gestorben war. Weniger verwirrt als verängstigt begann er den Aufstieg zu seiner Wohnung im dritten Stock. Als er am Griff seiner Eingangstür drehte, war ihm, als sei dieser unbekannte Gegner womöglich schon in seine Privatsphäre vorgedrungen – den einzigen Ort in seinem Leben, über den er zu herrschen geglaubt hatte. Die Tür flog auf und zog Digger mit sich. Auf einmal stand er mitten in seinem Wohnzimmer, von der Furcht eines drohenden Verhängnisses ergriffen. Die Luft wurde immer stickiger, während die Temperatur rasch weiter sank. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit ergriff seinen Körper. Zu seiner größten Überraschung bemerkte er, daß er nicht mehr auf dem Boden stand, sondern irgendwie zu schweben schien. Im nächsten Augenblick wurde er durch die Luft geschleudert. Er hörte und fühlte jede einzelne Rippe in sich bersten, als er mit dem Brustkorb gegen den Kaminsims prallte. Dann sackte sein Körper auf dem Fußboden 8zusammen, und er schmeckte das Salz seines eigenen Blutes, das aus einer klaffenden Wunde über dem rechten Auge strömte.
Noch einmal wurde sein Körper von unsichtbarer Gewalt gegen die Wände geschleudert, als sei er ein lebender Kegel. Mit äußerster Klarheit spürte Digger jeden zerschmetterten Knochen, jede Wunde und jede Prellung. Er betete darum, in Ohnmacht zu fallen – damit alles vorüber sei. Während er gleich einer menschlichen Stoffpuppe auf der Erde lag, spürte er, daß da jemand über ihm stand. Er versuchte zu erkennen, wer es war, doch das Blut strömte ihm übers Gesicht und in die Augen und machte seinen Peiniger unsichtbar. Digger gab auf. Gegen diese übermächtige Gewalt konnte er nicht ankämpfen.
»Es ist Zeit«, schrie jemand in weiter Ferne.
Die Aufmerksamkeit des Angreifers ließ für einen Moment nach, als dieselbe Stimme wiederholte: »Es ist Zeit.«
Digger fühlte, wie sein Körper von der unbekannten Kraft mühelos aufgehoben und durchs Fenster geworfen wurde.
»Digger, 's is Zeit«, sagte eine wohlbekannte Stimme. »Was machst du denn, verdammt noch mal?«
Digger Taylor schauderte und blickte um sich. All seine Mannschaftskameraden auf der Spielerbank starrten ihn an. Er hatte vor sich hin geträumt. Der Alptraum, den er in der vergangenen Nacht wieder einmal gehabt hatte, ließ ihn nicht los.
»Los, Digger«, sagte Hank Olsen, der Mannschaftskapitän und Secondbaseman. Er hob Diggers Handschuh auf und warf ihn ihm zu. »Letztes Inning. Wir liegen einen Punkt zurück. Los! Wir müssen sie aufhalten!«
Digger fing seinen Handschuh auf und trabte in den Vormittagssonnenschein hinaus, auf das sandige Innenfeld zu.
9
»Nach vollendeten acht Innings hier im Presidio Park«, dröhnte es aus den Lautsprechern, »lautet der Zwischenstand Black Angus, acht, Harbor Café, sieben. Für diejenigen unter Ihnen, die zum ersten Mal bei einem Slow-Pitch Meisterschaftsspiel dabei sind: Wir halten es hier genauso, wie's die ›Großen‹ machen. Bei einem Punktegleichstand am Ende von neun Innings machen wir so lange weiter, bis eine Mannschaft nach einem vollen Inning vorne liegt.«
Es kann doch nicht sein, daß du so in den Tag hinein geträumt hast, dachte Digger, während er zum Aufwärmen die Grundbälle des Firstbaseman annahm. Es ist schon schlimm genug, daß fast alle in der Mannschaft dich irgendwie für verrückt halten. Jetzt werden sie auch noch denken, dir wäre das alles scheißegal – mitten in einem Meisterschaftsspiel vor dich hin zu träumen. Was zum Teufel ist bloß los mit dir, Taylor?
Er wollte zu dieser Mannschaft gehören – irgendwo dazugehören. Er hatte sich so lange bindungslos gefühlt, daß er Mühe hatte, aus seinem Kokon herauszukommen. Er durfte sich jetzt nicht verlieren. Er mußte irgend etwas tun, um zu zeigen, daß ihm wirklich etwas daran lag.
Niemand in der Mannschaft wurde aus ihm klug. Er hatte ihnen gesagt, den Spitznamen Digger, der Wühler, trage er seit der Highschool-Zeit wegen seiner Fähigkeit, Grundbälle »auszugraben« und besonders schnell zu laufen. Doch sie hatten den Verdacht, sein Name müsse noch etwas anderes bedeuten. Immer hatte er die Nase in irgendwelchen Büchern über Komposition oder Philosophie, die er in der Bibliothek auslieh. In der letzten Zeit hatte er – wenn er nicht gerade Klavier spielte – sich sogar an »kalifornischem Zeug« wie Meditation und Yoga versucht. Er wußte nicht, was es war; er wußte nur, daß er noch etwas mehr vom Leben erwartete.
10
Das einzige, was seine Mannschaftskameraden sicher wußten, war, daß Jonathan Patrick Taylor der beste Shortstopper in der Restaurant-Softball-Liga war, und daß sie verdammt froh waren, ihn zu haben. Die Schiedsrichter sagten, Digger sei einer der besten Softball-Spieler im ganzen Kreis; und alle fragten sich, warum er nicht als Profi spielte.
Keiner seiner Kollegen im Harbor Café konnte verstehen, warum Digger als Kellner arbeitete. Er sah zwar nur wenig älter aus als sie, aber es war klar, daß er besser über die Führung eines Restaurants Bescheid wußte als die Geschäftsführer oder der Küchenchef oder sogar der Besitzer. Doch er hielt sich immer zurück – kam früh, ging spät und machte sich kaputt. Auf seiner Bewerbung war lediglich ein Postfach im Hauptpostamt angegeben.
»Batter in Position«, brüllte der Plate Umpire.
Der erste Batter schlug einen Hot Smash zum Thirdbaseman. Der Fielder, dem das lange Surferhaar in die Augen wehte, machte das Spiel klar und warf zum ersten Base. »Aus«, bellte der Base Umpie ins aggressiver werdende Spiel hinein. Von den Tribünen schallten Hochrufe und Applaus. Die Menge grölte: »Defense! Defense!«
Der Lautsprecher verkündete, daß der nächste Schlagmann ein Ersatzspieler sei.
»Der Junge schlägt nach rechts«, schrie Digger Olsen zu, während er auf das zweite Base zurannte. »Ich hab mal in einer Raveling League gegen ihn gespielt; er ist ein Rechtsausleger.«
Olsen lief näher an das erste Base heran und gab dem Centerfielder ein Zeichen, sich links von ihm zu halten. Der Outfielder machte einen Schritt.
Erster Wurf – der Batter täuschte und schlug ins rechte Innenfeld. Der Ball rollte zum Zaun, und der Schlagmann trottete aufrecht ins dritte Base.
11
Digger nahm den Wurf vom Außenfeld an und blieb am Ball. Das dritte Base blieb unbespielt. Er rief »Time« und ging mit dem Ball zum Pitcher.
Olsen winkte den Innenfeldspielern, sich mit ihm am Mound zur Beratung zu treffen. »Was meinst du, Digger?« fragte er, sobald alle bei ihm waren. »Am besten spielen alle nach innen, oder?«
Digger nickte. »Wir haben einen schnellen Läufer am Plate, aber wir sollten möglichst versuchen, den Läufer am dritten Base abzufangen.«
Die anderen nickten zustimmend und trabten auf ihre Plätze zurück.
Der nächste Schlagmann war ein kleiner, dünner Mann, dessen Baseballmütze sein bleiches Gesicht fast ganz verdeckte.
Die Innenfeldspieler duckten sich tief auf gleicher Höhe mit dem nächsten Base und warteten darauf, sich mit dem Pitch in Bewegung zu setzen. Der Ball stieg steil in die Luft und kam fast senkrecht in der Nähe des Plate wieder herunter. Der Schlagmann blieb stehen, und auch Digger und die übrigen Innenfeldspieler bewegten sich nicht.
»Ball eins«, brüllte der Umpire.
Auch der nächste Wurf ging hoch in die Luft. Aus irgendeinem Grunde war Digger schon auf den Plate zugerannt. Der Batter verzog und schlug einen weichen Pop-up-Ball, der einen flachen Bogen nahe der dritten Baselinie beschrieb. Kaum traf der Schläger den Ball, da raste der Runner in Richtung Home.
Digger war klar, daß der Runner punkten würde, wenn der Ball im Fair aufgenommen und dort bleiben würde. Der Thirdbaseman würde nicht mehr rechtzeitig an den Ball kommen, um das Spiel am Mal zu entscheiden. Wie der Blitz schoß er durch die Luft, fing den Ball, noch ehe der den Boden 12berührte, und landete nach einem harten Aufprall bäuchlings gleitend auf dem äußeren Innenfeld. Er war kaum zum Halten gekommen, als er auch schon auf die Füße sprang und den Ball dem Thirdbaseman zuwarf, der ihn auffing und auf das Kissen sprang.
»Flugaus!« schrie der Umpire. »Und aus am dritten Base.«
Die Menge sprang auf, klatschte und jubelte.
»Gutes Spiel, Digger«, grummelte der Third Base Coach, als Digger auf seinem Weg zur Spielerbank an ihm vorübertrabte. »Danke«, sagte Digger und schüttelte schmerzverzerrt seine rechte Hand aus. Er sah auf seinen kleinen Finger. Der stand in einem Winkel von fünfundvierzig Grad von seiner Hand ab und war schon jetzt weiß und geschwollen.
Nicht jetzt, dachte Digger. Nicht jetzt. Ich hab noch zu viel vor. Die dünne Luft der Verzweiflung hüllte ihn ein.
Digger hörte, wie irgendein Schreihals vom Spielfeldrand »Was is' los, Junge?« brüllte. Er hatte einen irischen Akzent. »Geht der Kleine jetzt nach Haus, damit die Mami ihm das kleine Fingerchen wieder anmacht?«
Diggers Miene verfinsterte sich. Er versuchte angestrengt, den Mann auszumachen, konnte ihn aber nicht entdecken. Ihn fröstelte.
13
»Liebe … braucht Nahrung
und Pflege.«
San Diego, vier Monate später
Als Digger in die Pedale seines Fahrrads trat, spürte er im Gesicht die kühle Brise des Pazifiks. Er fuhr die Strandpromenade entlang, wo man gewöhnlich eine Vielzahl von Menschen auf Skateboards, Rollerblades, zu Fuß oder beim Joggen traf. Aber um drei Uhr morgens war es ruhig. Digger liebte die Nachtstunden; da gab es keine Zerstreuung, keine Verabredungen, keine Verpflichtungen. Es waren die Stunden, in denen er sich am besten auf sich selbst besinnen konnte, in denen er am kreativsten war. Es war die Tageszeit, die seine innersten Gefühle am genauesten widerspiegelte.
Als er beim Wellenbrecher am Ende der Mission Beach angekommen war, stellte er sein Fahrrad ab und schloß es an. Um an die äußerste Spitze des Dammes vorzudringen, kletterte er über die Felsen. Zu dieser Nachtzeit war selten jemand hier draußen. Er glitt auf einem der schlüpfrigen Felsen aus und streckte die Hand vor, um seinen Fall abzufangen. Du mußt vorsichtiger sein, dachte er. Noch mehr Finger darf ich mir nicht brechen. Schon durch seinen kleinen Finger hatte er wertvolle Zeit zum Komponieren verloren. Der Finger war gerade eben geheilt, verkrampfte sich aber immer 14dann, wenn er an eine bestimmte Stelle des Konzertes kam, das er zu Ende komponieren wollte.
Wie üblich, war er nach der Arbeit im Restaurant gegen ein Uhr morgens nach Hause gegangen, um an seiner Musik zu schreiben. Doch da es ihm nicht gelang, sich in eine kreative Stimmung zu versetzen, hatte er sich entschlossen, ein Stück mit dem Fahrrad zu fahren. Es ging ihm so viel durch den Kopf: wie sollte er seine Schulden abbezahlen, wie sein Konzert beenden, wie mit seinen Gefühlen für Mary umgehen, wie an einen ordentlichen Job herankommen. Und dann war da noch dieser Alptraum, den er immer und immer wieder träumte. Während der letzten Monate hatte ihn zudem ein Gefühl der Leere ergriffen, das er schon kannte. Aus früherer Erfahrung wußte er, es bedeutete, daß sich etwas am Horizont zusammenbraute.
Eine Stunde etwa blieb er dort sitzen und schaute zu, wie die Wellen die Felsen zu seinen Füßen umspülten. Er blickte nach Westen, die Lichter der Stadt im Rücken, weil man dann am besten die Sterne betrachten konnte, die hier draußen so viel heller schienen. Stundenlang konnte er so dasitzen und seinen Gedanken freien Lauf lassen. Der Himmel beflügelte seine Phantasie, und die See besänftigte irgendwie sein Herz.
Doch wieder durchfuhr ihn das beunruhigende Gefühl, daß ihn jemand verfolgte. Er sagte sich, daß seine Angst von diesem Alptraum herrühren müsse. Doch in der letzten Zeit wuchs die Empfindung in ihm, auch in der Tagwelt verfolgt zu werden.
Er stand auf und wanderte zurück zur Promenade. Aus den Augenwinkeln glaubte er, eine schattenhafte Gestalt wahrzunehmen. Das konnte nicht sein, denn hier draußen war niemand außer ihm, da war er sicher. Dennoch beschleunigte er seinen Schritt. Er stellte sein Fahrrad auf und 15drehte hektisch am Nummernschloß. Ein Felsbrocken polterte den Molendamm hinunter und fiel ins Wasser. Digger sah auf, doch da war niemand. Er wandte sich wieder seinem Schloß zu, konnte sich aber nicht an die letzte Ziffer erinnern.
Na komm, Digger, dachte er, nimm dich zusammen. Die kleinste Panik, und du klappst zusammen. Da fiel es ihm wieder ein – achtzehn. Er zog das Schloß durch die Speichen und trat hastig in die Pedale.
Als die Brücke hinter ihm lag, verschwand seine Furcht. Er wollte unter Menschen sein. Also steuerte er dorthin, wo er sich nachts am liebsten herumtrieb.
Die Wanduhr im Hardee's am Voltaire und Sunset Cliff zeigte vier Uhr fünfundvierzig an. In einer braunen Uniform im Trapezschnitt rauschte Mary Porcelli eben aus der Damentoilette und stellte ihren kurvenreichen achtundzwanzigjährigen Körper zur Schau. Das lange, braune Haar war tadellos gebürstet und unter dem vorgeschriebenen Haarnetz zu einem Knoten geschlungen; Makeup und Lippenstift frisch auf ein hinreißendes Gesicht aufgetragen.
Aus den Nischen in der Nähe der Toiletten wurde ihr Auftritt mit durchdringendem Zischen und Pfeifen begrüßt. »Wahnsinn, Leute«, schrie Zippo, ein Koloß in Motorradkluft mit langem Bart und muskulösen, nackten Armen voller Tätowierungen. Die frühmorgendlich versammelte Menge brüllte vor Lachen. Die meisten waren Stammgäste, die in unregelmäßigen Schichten arbeiteten oder um diese Stunden nichts Besseres zu tun hatten.
»Paß bloß auf, Zippo«, giftete Mary zurück.
»Ohhh«, machte die Gruppe im Chor, denn man witterte eine leichte Nervosität. Irgend etwas stimmte nicht mit Mary. Im allgemeinen war sie nicht so empfindlich.
16
Mary ging eine Menge im Kopf herum. Sie konnte es nicht erwarten, die Schule hinter sich zu bringen und die Zeugnisse zu bekommen. Mit Hilfe dieses Jobs hatte sie das Schulgeld bezahlen und tagsüber weiter zur Schule gehen können. Doch in den letzten Wochen hatte sie eigentlich nur an Digger gedacht.
»Wo is'n dein Kumpel, Mary?« fragte ein Taxifahrer – einer der Stammgäste.
Mary wußte, von wem er sprach, beschloß jedoch, nicht zu antworten. Sie glitt hinter die Theke und machte sich wieder an die Arbeit. Sie wollte es sich nicht mit Jake, dem Geschäftsführer, verderben. Über Wortgefechte mit den Gästen ärgerte er sich besonders gern. Außerdem wollte sie ein paar Punkte sammeln für den Fall, daß Digger doch noch auftauchen würde.
Keiner aus der »Hinterwäldler-Gang« (wie Jake sie nannte) traute sich, das Personal zu reizen, wenn es einmal hinter der Theke stand. Die Männer hatten auch so schon keine guten Karten bei ihm, besonders, wenn Digger nicht da war.
In diesem Augenblick schlenderte Digger herein, sein Fahrrad vor sich herschiebend. Schweiß bedeckte seinen Körper. Diggers Freunde spendeten spontan Applaus.
»Nett, daß du uns Gesellschaft leisten willst«, brüllte Zippo. »Wo zum Teufel bist du die letzten Tage gewesen?«
»Mal hier, mal da.«
»Digger«, befahl der Taxifahrer, »setz dich her. Ich brauch deinen Rat in geschäftlichen Angelegenheiten.«
Digger grinste. »Klar, aber kann ich erstmal was zu essen bestellen?«
Mit einem schnellen Blick zog Digger Marys Aufmerksamkeit auf sich und gab ihr durch Handzeichen zu verstehen, daß er Kaffee und warmes Essen wünschte.
17
Der kleine, untersetzte Mann begann, Digger ein versicherungstechnisches Problem zu unterbreiten, das sein Taxiunternehmen betraf.
Ein paar Minuten lang beschäftigte sich Digger bis ins Detail mit allen Vorzügen und Nachteilen der Versicherungsoptionen seines Freundes. Dabei dachte er, was für eine Ironie – ich bin der letzte Mensch, den man um einen Rat in Versicherungsdingen fragen sollte, wenn man bedenkt, was ich in Florida für einen Mist gemacht habe.
Viele aus der Gruppe schüttelten bewundernd die Köpfe über die Sachkenntnis, mit der Digger dieses Problem anging.
Der Motorradfahrer sagte: »Wo hast du diesen Scheiß gelernt, Taylor? Bist du so 'ne Art Anwalt oder was?«
»Nein«, antwortete Digger mit einem gutmütigen Grinsen, »sowas lernt man nur aus gnadenloser, bitterer Erfahrung.«
Als er fertig war, brachte Mary auf einem Tablett heißen Kaffee, Milch, ein Omelett und eine Semmel, fertig verpackt zum Mitnehmen. »Hier drin ist es ja plötzlich so still geworden«, sagte sie mit einem spitzbübischen Grinsen. »Was ist los? Habt ihr vor, die Spielbank in Las Vegas zu sprengen oder so was, Jungs?«
»Nichts dergleichen, allerdings wäre mir damit sehr geholfen«, sagte Digger und schaute zu ihren sanften braunen Augen auf. Er sah Mary gerne an. Außer ihrer Schönheit besaß sie viele Eigenschaften, die er bei einer Frau zu suchen glaubte: Intelligenz, Humor, Kraft, Feinfühligkeit, Selbständigkeit und eine Portion Frechheit.
Er griff nach seinem Geld, um zu bezahlen. »Nur ein kleines geschäftliches Problem«, fuhr er fort, »aber wenn wir rausfinden, wie wir die Bank in Las Vegas oder sonstwo knacken, wirst du eine der ersten sein, die 's zu wissen kriegen. 18Dann kannst du auf all die vielen Stunden pfeifen, die du hier mit deiner Arbeit verplemperst.«
Er hatte sein Geld gefunden und ließ einen Zehn-Dollar-Schein auf das Tablett fallen. »Sag, Mary, was würdest du tun, wenn du in Las Vegas hunderttausend Dollar gewinnen würdest?«
Sie hob die Augenbrauen und zuckte mit den Schultern. Ihr Lächeln verschwand, und sie starrte in die Dunkelheit hinaus. »Ich weiß es nicht. Ein paar Rechnungen bezahlen. Meinen Abschluß machen. Ein Haus kaufen. Vielleicht reisen. Ich glaube, ich würde gern mal nach Rom fahren. Ich bin …« Sie hielt erschrocken inne, errötete, warf einen schnellen Blick auf die Gesichter der Gruppe und dann auf ihr Tablett. »Ich bring gleich das Wechselgeld.«
Digger öffnete die Papiertüte und überprüfte den Inhalt. Manchmal schmuggelte ihm Mary eine Nachricht hinein. Na also. Er entdeckte den Zettel und nahm ihn unauffällig heraus.
»Die Natur ruft«, verkündete er, stand auf und begab sich zur Herrentoilette. Nachdem er sich eingeschlossen hatte, las er in Marys vertrauter Handschrift: »Ich muß dich sprechen.«
Herrje, dachte er, warum kann sie keine Ruhe geben? Er wollte sich nicht mit diesem Thema beschäftigen – vor allem, weil er nicht wußte, was er ihr sagen sollte.
Mary und Digger hatten sich fünf oder sechs Mal verabredet. Doch damit war seit ungefähr einem Monat Schluß. Sie hatten eine recht gute Beziehung gehabt, aber er wollte nicht schon wieder eine Enttäuschung erleben. Er hatte sich ihr nie ganz geöffnet, und sie spürte die Mauern, die ihn umgaben. Er hatte ihr gesagt, daß er noch nicht so weit sei.
Genaugenommen konnte Digger keinen einzigen vernünftigen Grund dafür vorbringen, weshalb er nicht wahnsinnig 19in sie verliebt war. Ihm fiel nicht mehr ein, als ihr zu sagen: »Es liegt nicht an dir, Liebes, es liegt an mir.« Und das stimmte wirklich. Es lag an ihm. Er wußte nur nicht, was dieses »es« war. Er wußte nur, daß irgend etwas in seinem Leben fehlte.
Am Rettungsturm Nummer Sieben am Ocean Beach – oder OB, wie die Einheimischen ihn nannten – herrschte den Sommer über vom frühen Vormittag bis weit nach Sonnenuntergang Hochbetrieb. Im Morgengrauen war hier jedoch fast nie ein Mensch – nur Möwen, der Wind und das brüllende Tosen der Brandung.
An diesem Morgen wartete Mary, gegen den Turm gelehnt, auf Digger und betrachtete das Farbenspiel des ersten Morgenlichtes auf dem Meer. Ihr braunes Haar hatte sie aufgelöst. Lange, dicke Locken quollen aus der Kapuze ihrer weißen Sweatjacke hervor. Die Arme hatte sie ungeduldig verschränkt.
Sie hatte Digger gleich vom ersten Abend an gemocht, an dem er ins Restaurant gekommen war. Er hatte ein selbstbewußtes Auftreten, doch vor allem war es die Herzlichkeit, die in seinem Lächeln lag. Dazu kam die Aura des Geheimnisvollen, die ihn umgab. Sie war ein zweischneidiges Schwert, denn sie fesselte Mary und schloß sie doch zugleich aus. Digger lebte sehr zurückgezogen und gab kaum etwas von sich preis. Tatsächlich war sie noch nie in seiner Wohnung gewesen. Ihre Freundinnen meinten, er träfe sich wahrscheinlich mit einer anderen Frau. Sie wollte ihnen nicht glauben.
Außerdem spürte Mary irgendwo in Digger einen Schmerz, von dem sie ihn befreien wollte, obwohl sie wußte, es würde ihr nicht gelingen. Das »Retten« war in ihren Beziehungen schon zu einer lieben Gewohnheit geworden, die sie unter keinen Umständen aufgeben wollte. Tief im Innern 20spürte sie jedoch, daß es für sie beide noch Hoffnung gab. Sie wußte nicht, wie sie zu Digger durchdringen sollte, doch einen letzten Versuch wollte sie wagen.
Endlich tauchte Digger auf. Er schob sein Fahrrad durch den Sand und kam auf Mary zu. »Entschuldige, daß es so lange gedauert hat. Zippo will unbedingt, daß ich auf seiner Harley fahren lerne. Ich glaube, er weiß gar nicht, was das Wort ›Nein‹ bedeutet.«
Ein gutmütiges Lächeln erhellte Marys Gesicht. »Macht nichts«, sagte sie und atmete tief. »Weißt du, er betet dich an, Digger. Du bist wie ein Gott für ihn. Du würdest ihn zum glücklichsten Mann in OB machen, wenn du ihm erlaubst, dich das Ding fahren zu lehren.«
»Wahrscheinlich hast du recht«, stimmte Digger zu. »Das erschreckt mich ja gerade so.« Er lehnte das Fahrrad gegen den Turm und wandte ihr sein Gesicht zu. »Also … was gibt's?«
Sie schloß kurz die Augen. »Na hör mal, Digger. Schau mich nicht mit so großen, unschuldigen Augen an. Du weißt ganz genau, was mit mir los ist.«
Er zuckte mit den Schultern. »Na ja, so ungefähr. Aber so ganz sicher bin ich da nie.«
»Digger, was soll ich denn noch tun? Ich hab alles getan, außer mich dir an den Hals zu werfen. Wie komm ich bloß an dich ran? Ein ganzes Jahr lang bist du regelmäßig ins Restaurant gekommen, ehe du den Mut aufgebracht hast, dich mit mir zu verabreden. Und als wir dann zusammen ausgegangen sind, war es wunderbar. Das hast du sogar selbst gesagt. Dann auf einmal trittst du den Rückzug an.«
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Er ließ den Kopf hängen. Wie kann ich es ihr erklären, wenn ich es selbst nicht einmal verstehe? Immer kroch diese Leere in ihn hinein – gleich, ob es um Beziehungen ging, um eine berufliche Laufbahn 21oder um fremde Städte -, das Gefühl, daß es doch noch mehr geben mußte, nicht nur ein bißchen mehr, sondern einen ganzen Grand Canyon mehr. Und dieses Gefühl war in der letzten Zeit noch stärker geworden.
»Wo liegt das Problem?« fuhr Mary fort. »Warum lieben wir uns nicht einfach irgendwo oder schlafen längst tief und fest, ich in deinem, du in meinem Arm? Du weißt, daß ich dich wirklich gern hab, und ich glaube, daß du dasselbe fühlst. Worauf wartest du eigentlich?«
»Ich dachte, das hätte ich dir schon erklärt«, sagte er mit gespielter Zurückhaltung.
»Aber Digger! Du hast nur gesagt, daß du noch nicht so weit bist. Und das erklärt überhaupt nichts.«
Er holte tief Luft, räusperte sich und begann auf und ab zu gehen. Er konnte ihr nur das begreiflich machen, was sein Verstand gelten ließ:
»Vor vier Jahren kam ich nach San Diego. In Florida hatte ich eine Serie von gescheiterten Beziehungen hinter mir gelassen, und davor in Chicago war es genau dasselbe. Nur, daß da auch noch Ehe und Scheidung dazukamen. Ich beschloß, daß ich, wenn ich hierher ziehen würde, zuerst mit mir selbst ins reine kommen müsse, ehe ich mich mit jemand anderem einließe. Und … daran arbeite ich nun seit drei Jahren. Ich habe keine andere Freundin und keinen Freund; ich hab auch keine Laster. Ich hab nur eins – meine Musik. Ich komponiere. Das war's … Ende der Vorstellung.«
Sie zog die Stirn in Falten. »Das wars? Das ist alles, was du tust?«
»Das, und dann spiel ich noch ein bißchen Softball.«
»Was für Musik?«
»Ein Konzert für Klavier und Orchester.«
»Ist das wirklich wahr? Die ganze Zeit? Und du hast nie was davon gesagt?«
22
Digger zuckte die Achseln.
Mary sah ihn nur an. Ihr wurde klar, daß sie sich in einen Mann verliebt hatte, von dem sie so gut wie nichts wußte. Das war gegen jede Vernunft.
»Kann ich dich irgendwann mal spielen hören?« fragte sie sanft. Verschwunden war die kritische Schärfe, an ihre Stelle traten Bewunderung und Überraschung.
»Irgendwann, ja … ich habe noch nichts so weit fertig, daß es in die Premiere gehen könnte. Aber es dauert nicht mehr lange … naja, jedenfalls nicht sehr.«
»Was ist denn das für eine Antwort?«
Während er darüber nachdachte, trat eine kurze Stille ein. Nur hoch oben schrien ein paar Möwen.
»Eine ziemlich dürftige Antwort«, sagte er schließlich. Er sprach leise, und seine Worte klangen wehmütig. »Aber auch eine aufrichtige. Ich habe das Gefühl, daß meine Musik noch nicht gut genug ist, sie jemandem zu zeigen. Bis dahin habe ich keine Zeit und keine Kraft für irgend jemanden oder irgend etwas anderes. Es tut mir leid.« Er hielt inne und betrachtete ihre schöne Silhouette im goldenen Licht der aufgehenden Sonne. »Ist das klar genug?«
Sie schaute ihn prüfend an und nickte. »Klar und deutlich«, sagte sie freundlich und mit einem Augenzwinkern. »Merk dir eins, du Klavierspieler. Mary Benedetta Porcelli mag verrückt sein, aber sie liebt dich … sehr sogar. Solange du dich hinter deiner Musik verschanzt, wirst du ein Verlierer sein. Liebe ist nicht wie Unkraut, das von selber wächst. Liebe ist wie eine schöne, empfindliche Pflanze: Sie braucht Nahrung und Pflege.«
Mary langte in ihre Jackentasche und zog einen kleinen Umschlag hervor.
»Das ist meine neue Adresse und meine Telefonnummer. Heute war mein letzter Tag im Hardee's. Ruf mich an, wenn 23du bereit bist fürs wirkliche Leben. Ich hoffe, unsere Pflanze hat dann noch Leben und Kraft.«
Sie gab ihm einen Kuß auf die Wange und ging über den weißen, wehenden Sand davon.
24
»Irgend etwas fehlte; was, das konnte er
nicht herausbekommen.«
Die Sonne begann die Stadt zu wärmen, als Digger an einem Wohnhaus vorüber, die Einfahrt hinunter auf ein kleines Einzimmer-Strandhaus zuradelte. Ganz deutlich war das Ächzen der Brandung zu hören, die gegen das Ufer schlug. Darum vor allem hatte er dieses Haus gewählt: wegen seiner Nähe zum Ozean. Der Klang und der Geruch des Meeres hatten ihn schon immer angezogen.
Außerdem liebte er die Einsamkeit dieses Ortes – nicht nur, weil er selbst sich hierher zurückziehen konnte, sondern weil er hier seine Musik spielen konnte, ohne irgend jemanden zu belästigen. Der Preis stimmte auch. Wo sonst in San Diego außer am Ocean Beach hätte er wohl für fünfhundert Dollar im Monat ein Einzimmerhaus bekommen, das nur einen Steinwurf vom Strand entfernt lag?
Natürlich mußte er jeden Cent sparen. Er war immer noch dabei, das Geld, das er von seiner Mom und einem Freund geliehen hatte, zurückzuzahlen. Ja, das Finanzamt drohte sogar mit allen möglichen Maßnahmen, weil er die letzte Rate seiner überfälligen Steuern immer noch nicht bezahlt hatte. Der Fehlschlag von Florida verfolgte ihn immer noch – in vielerlei Hinsicht.
Digger drehte den Schlüssel im Schloß herum und öffnete 25die Haustür. Er holte tief Luft und seufzte, während er die Tür wieder schloß. Home, sweet home, dachte er.
Ohne Disziplin würde er es nie zu Ende bringen. Vielleicht ging es ja heute besser. Er hatte es einfach satt, sich Stunde um Stunde, Tag um Tag, Woche um Woche mit seiner Arbeit herumzuschlagen, damit am Ende vielleicht ein paar Noten dabei heraussprangen. Vielleicht hatte Mutter unrecht. Vielleicht hatte er doch nicht so viel Talent.
Er warf seine Schlüssel auf den Küchentisch und ging zum leeren Kühlschrank hinüber. Da sah er überall diese schwarzen Punkte. Er hatte seit Tagen kein Geschirr mehr abgewaschen; Schwärme von Ameisen wimmelten auf Töpfen, Tellern und Gläsern herum.
Was soll's, dachte er, sie machen ja nichts kaputt. Wenigstens hatte er daran gedacht, die Erdnußbutter und die Konfitüre zu verschließen. Erst wenn dir mal Nußmus und Konfi ausgeh'n, dann weißt du, was Hunger ist. Das hatte sein Dad immer gesagt, wenn er abends spät nach Hause kam und nach etwas Eßbarem Ausschau hielt.
Die Ameisen erinnerten Digger an eine andere Zeit und einen anderen Ort, und er lachte in sich hinein. Judy, seine alte Partnerin in Florida, hatte einen Lieblingsspruch zum Thema Ameisen: »Irgendwo braucht schließlich jeder sein Plätzchen, was, Kumpel?« pflegte sie mit einem fröhlichen Grinsen auf ihrem hübschen australischen Gesicht zu sagen. »Aber doch bitte im Freien.«
Die Ameisen feg ich später weg, dachte er. Er war noch erfüllt von all dem, was Mary ihm eben gesagt hatte. Erfüllt und beunruhigt.
Er ging zu seiner Kommode hinüber, wo sich Türme von Jeans und alten T-Shirts stapelten, zog sich um und öffnete die Fenster im Haus. Ein sanfter Frühlingshauch wehte den Duft des Meeres ins Zimmer. Digger atmete tief ein.
26
Er ging am Klavier vorüber, drehte sich dann aber um und begann, mit der rechten Hand ein paar Töne anzuschlagen. Für Digger war dies eine Reflexhandlung, so als wollte er an einem Bonbonglas vorübergehen: Wenn er es erst einmal entdeckt hatte, mußte er wenigstens ein bißchen probieren.
Aus den Augenwinkeln sah er ein Paar Shorts auf seinem Anrufbeantworter liegen. Das Gerät war ein Weihnachtsgeschenk seiner Mutter gewesen. Sie wünschte, daß er jederzeit wußte, wann sie ihn in seiner Abwesenheit angerufen hatte. »Mit deinen verrückten Arbeitszeiten komme ich nicht mehr mit«, hatte sie gesagt. Ihm fiel ein, daß er das Gerät schon seit ein paar Tagen nicht mehr abgehört hatte. Er räumte die Shorts beiseite, darunter kam ein blinkendes Lämpchen zum Vorschein.
Aus Gewohnheit drückte er die »Play«-Taste. Schneidende Kälte durchfuhr seinen Körper.
»Hallo, Patrick? Hier ist Sean Green«, tönte ein irisch gefärbter Singsang aus dem Apparat.
Digger verdrehte die Augen zur Decke und schüttelte den Kopf. Wer hätte so eine Stimme verkennen können? Sein Agent – ein Agent, den er noch nie gesehen hatte – war der einzige Mensch auf der Welt, der ihn bei seinem zweiten Vornamen nannte.
»Hab 'ne ganze Weile nichts mehr von dir gehört«, fuhr Green fort. »Ich muß unbedingt wissen, wie 's mit deinem Konzert vorangeht, verstehst du. Ich hab das Band mit dem ersten Satz 'n paar großen Tieren gegeben. Laß mich jetzt nicht im Stich. Ich hab denen nämlich mein Wort gegeben. Ich hab ihnen erzählt, du wärst so gut wie fertig. Läut mich an und sag mir, ob ich 'n Fehler gemacht habe. Die Nummer kennst du ja.« Er legte auf.
Vor mehreren Monaten hatte Digger ein paar Bänder mit seiner Musik an verschiedene Agenten an der Westküste verschickt. 27Green war der einzige, der überhaupt Interesse gezeigt hatte. Seitdem rief er regelmäßig an, um zu hören, wie Digger vorankam. Digger wußte, daß er ihm eigentlich dankbar sein sollte, aber irgend etwas an diesem Kerl gefiel ihm nicht.
Er setzte sich, noch immer kopfschüttelnd, ans Klavier. Unzählige Manuskriptseiten, vollgekritzelt mit Noten und flüchtigen Entwürfen, lagen verstreut auf dem Instrument und im Notenhalter. Unzählige Reihen von Notensystemen unter immer neuen Vorzeichen bedeckten das Notenpapier – er hatte mit wechselnder Kontrapunktik experimentiert.
Aufrecht sitzend betrachtete er den alten Clark and Player einen Augenblick. Er hatte ihn gleich in der ersten Woche nach seinem Umzug bei einer Haushaltsauflösung in San Diego gekauft. Das Instrument war durch jahrzehntelangen Mißbrauch völlig verschrammt, aber etwas anderes konnte er sich nicht leisten. Er hatte mehrere Wochen damit zugebracht, es wieder aufzupolieren. Jetzt sah es genauso aus wie Mutters altes Klavier – das einzige Stück, an dem ihr Herz hing. Sie hatte zwar immer ein Riesentheater veranstaltet, um ihren Mann zum Kauf neuer Möbel, neuer Teppiche oder neuer Küchengeräte zu bewegen, doch nur ihr Klavier bedeutete ihr wirklich etwas. Als Digger zehn Jahre alt war, erzählte sie ihm, daß das Klavier das einzige gewesen sein, was ihr Vater ihr erlaubt habe mitzunehmen, als sie von zu Hause fortgegangen war, um eine eigene Familie zu gründen. Großvater Leahy wollte nicht, daß seine Tochter irgend so einen ungebildeten Fabrikarbeiter heiratete; er schimpfte und tobte, dafür hätte er sie nicht ins College und auf die höhere Schule geschickt.
Anfangs hatte Digger nur seiner Mutter zuliebe Klavierstunden genommen. Es lag ihm nichts daran, stundenlang zu üben, wo er statt dessen Little League Baseball oder Pop 28Warner Football oder Basketball beim YMCA hätte spielen können.
Zuerst haßte er das Klavierspielen. Da sie selbst in irisch-katholischer Umgebung aufgewachsen war, hatte ihn seine Mutter bei den Nonnen in den Unterricht geschickt. Digger erinnerte sich daran, wie er mit dem Zeigestock auf die Knöchel geschlagen wurde, weil er »faule Finger« hatte. Die Nonnen legten vor allem Wert auf die Spieltechnik, doch Digger wußte, daß zur Musik noch mehr gehörte als Fingerübungen. In einem der seltenen Akte von Rebellion, die es in seiner Kindheit gab, weigerte er sich schließlich, überhaupt noch zu spielen. In letzter Verzweiflung schloß die Mutter einen Pakt mit dem kleinen Jonathan: Sie würde seinen Wunsch erfüllen, wenn er nur noch drei Monate bei einem neuen Lehrer – diesmal keiner Nonne – Unterricht nehmen würde.
Schon in den ersten zwei Wochen entdeckte Digger, worum es in der Musik eigentlich ging. Der neue Lehrer machte ihn mit verschiedenen Musikrichtungen bekannt und weckte seinen Spaß am Spiel. In dem Alter konnte er noch nicht in Worte fassen, was er dann als Erwachsener erkannte – daß das Klavierspiel die Möglichkeit bedeutete, all die Gefühle auszudrücken, die in seinem Innern verschlossen waren.
Gefühle waren dem kleinen Jonathan sehr verwirrend erschienen. Die heftigen Gefühle seiner Mutter erschreckten ihn (ebenso wie seine Freunde, die sich, wenn irgend möglich, um einen Besuch bei ihm zu Hause herumdrückten). Mrs. Taylor war eine wohlmeinende Frau, die für ihren Sohn nur das Beste wollte, die jedoch nur schwer mit dem unberechenbaren Verhalten eines kleinen Jungen zurechtkam. Sie versuchte, ihn durch gellendes Geschrei im Zaum zu halten. Doch wenn Digger dann seine eigenen Gefühle, sein Mißfallen 29oder seine Wut zeigte, beeilte sich seine Mutter, sie gänzlich auszurotten, indem sie ihm mit Seife »den Mund auswusch«.
Diggers Vater hingegen war ein sehr stiller, liebenswürdiger Mann, ein Mensch, der seine Gefühle in Schach hielt – vor allem seinen Ärger. Sein Vater arbeitete ständig. Wenn er dann nach Hause kam, schnappte er sich immer ein Bier und ging in den »Freizeit«-Raum, um Fernsehen zu schauen. Dann gab es jedesmal Streit, wobei seine Mom zu zetern, sein Dad still dazusitzen pflegte.
Unbewußt hatte sich Digger dafür entschieden, auf den Spuren seines Vaters zu wandeln und all dies in seinem Innern zu verschließen. Doch das Klavierspiel erlaubte es ihm, all seinen Gefühlen in ungefährlicher, annehmbarer Form Ausdruck zu verleihen.
Seine Eltern hatten beide eine Möglichkeit gefunden, noch länger und härter zu arbeiten, damit Digger immer fähigere Lehrer bekam. Als er ins Katholische Gymnasium ging, hatte er bereits mehrere Wettbewerbe gewonnen und war von vielen der besten Musikschulen in und um Chicago umworben worden. Seine Kenntnisse, seine Technik und seine Leidenschaft waren in seiner Collegezeit gewaltig angewachsen.
Doch all das änderte sich, nachdem er das College absolviert hatte.
Die ersten Semester studierte Digger in Europa. Während dieser Zeit wurde sein Vater, der immer ein starker Trinker gewesen war, schwer krank, da seine Leber und sein Gehirn schon erheblich angegriffen waren. Als Digger dann im letzten Studienjahr an die Loyola Universität zurückkam, ging es seinem Vater wesentlich besser.
Die Ärzte, die Digger sonst im allgemeinen verachtete, weil sie jedes Problem mit Medikamenten angingen, waren seinem Vater gegenüber ganz aufrichtig. Sie erklärten ihm, 30wenn er wieder zu trinken anfinge, werde ihn das umbringen.
In dieser Situation fühlte Digger den starken Wunsch, seinem Vater näherzukommen. Da noch keiner von ihnen je zum Hochsee-Angeln gewesen war, machte er Überstunden und plante für sie beide eine Überraschungsreise nach Key West. Es war viele Jahre her, daß sie allein miteinander verreist waren – als er noch ein kleiner Junge war, waren sie zusammen am Lake Shawano gewesen.
Digger konnte sich zwar nicht an alle Einzelheiten dieser Florida-Reise erinnern, doch wußte er noch genau, daß sein Dad wieder angefangen hatte, zu trinken. Als er seinen Vater an die Warnungen der Ärzte erinnerte, antwortete der nur: »Ich weiß ganz genau, was ich tue.«
Diese sachliche Bestätigung seiner Selbstzerstörung versetzte Digger in einen Zustand völliger Lähmung. Er wollte seinem Vater sagen, wie sehr er ihn liebte, wie sehr er wünschte, seinen Schmerz zu lindern. Doch er konnte nichts sagen, und er konnte nichts tun. Er konnte nur dastehen und zuschauen. Digger wußte so wenig über seinen Vater, der so viel in seinem Innern verschlossen hielt.
Nachdem sie aus Florida zurückgekehrt waren, ließ Diggers Interesse an der Musik rasch nach. Es erlosch ganz, als sein Vater wenige Monate später starb.
Draußen am Strand brach sich eine Welle und holte Digger in die Gegenwart zurück. »Jetzt fängst du schon wieder an, dich fertigzumachen«, sagte er laut. Dann stand er vom Klavierhocker auf und stieß die zerknüllten Notenblätter, die am Boden lagen, mit dem Fuß beiseite.
Er dachte über die Haßliebe nach, die ihn mit diesem Instrument verband. Er liebte das Spielen, doch er haßte seine Unfähigkeit, all die Noten auf dem Papier festzuhalten.
31
Digger wandte sich wieder den Tasten zu. Er atmete tief durch und versuchte, sich von seinen Gedanken freizumachen. Du hast noch viel zu tun, sagte er sich. Du hast seit Tagen keine Note mehr geschrieben, die sich aufzuheben lohnte. Du könntest doch wenigstens mal die ersten beiden Sätze durchspielen, bloß so zum Aufwärmen. Wer weiß, was dann passiert? Er setzte sich ans Klavier und rieb die Handflächen aneinander.
Wenn er imstande war, sich völlig zu lösen, war es wie Zauberei. Er konnte dann alles Irdische und alles Wirkliche hinter sich lassen und in seine ureigene schöpferische Welt eintreten, in der er der unumschränkte Herrscher war, die alles bewegende Kraft seines eigenen Universums. Hier war er wahrhaft frei. Hier bewegte er sich auf einer anderen Ebene der Wirklichkeit – in einem Bewußtsein der Stärke. Hier kostete er den Vorrat an Gefühlen, die so lange in den dunklen Zellen seines Herzens gärten.
Die eigene Musik zu spielen hieß in gewisser Weise, den Pfad der Erfüllung zu beschreiten. Noch war er nicht angekommen, doch irgend etwas sagte ihm, daß er auf dem richtigen Wege war. Die Musik war sozusagen der Schlüssel. Nein, überlegte er kurz, die Musik war lediglich die Tür. Der Schlüssel war dieses Musikstück, dieses Konzert, das ihm von Beginn seines Lebens an im Kopf herumtanzte.
Obwohl er wußte, daß es in Konzerten keine Überleitungen zwischen zwei Sätzen gab, war ihm, als ob sein Konzert eine benötigte. Er hörte schon den Spott seiner Lehrer: »Mr. Taylor, was Sie da vollbringen wollen, ist unmöglich. Konzerte haben einfach keine Überleitung.« Sein Konzert schon.
Irgendwo in seinem Innern konnte er die Melodie dieser Überleitung hören, die Verschmelzung spüren. Doch er konnte sie nicht hervorholen.
Seine Finger berührten die verfärbten Elfenbeintasten nur 32leise, fast so wie vor dem Liebesakt mit einer überaus sinnlichen Frau. Er fühlte den Schauer durch Arme und Glieder jagen, bis er nicht mehr länger warten konnte.
Er begann zu spielen, ruhig und behutsam zuerst. So, wie er auch die Introduktion komponiert hatte: pianissimo. Die Musik erinnerte ihn an die Trauer, die er über sein Leben empfand. Die Erniedrigung immer neuen Versagens in einem Leben, das ihm voller Versprechungen zu sein schien. Das eben stimmte ihn so traurig: daß er immer auf dem Weg war, nie am Ziel – so reiche Möglichkeiten, so wenig Vollendung.
Jetzt folgte der Zorn. Crescendo. Sein Hang, so lange keine Veränderung einer Situation herbeizuführen, bis sie ihm aufgezwungen wurde: die gescheiterte Ehe und der Wochenend-Alptraum in Chicago – sinnlose Unglücksfälle, die ihn beinahe das Leben gekostet hätten; die Dummheit in Florida – das Ende des Restaurants und der Beziehung zu Judy. Dann die abgebrochene Karriere als Familienberater für den Verwaltungsbezirk Chicago und die gegenwärtige Unfähigkeit, einen Job zu finden, bei dem er für mehr als nur für Trinkgelder arbeitete. Ein Magister in Soziologie und sein Karrieresprung mit knapp vierzig liefen auf dasselbe hinaus: Dienst am Kunden. Die Ironie, die darin lag, spottete jeder Beschreibung. Wie sehr er sich auch bemühte, welchen Bildungsgrad er auch erlangte, wo er auch lebte, vom Restaurantbetrieb konnte er nicht lassen.
Schließlich hatte er sich dazu durchgerungen, das Tief in seiner Karriere zu nutzen, um seine Musik wiederzuentdecken – einen Vorsatz, der seit kurzem erfolgreich war. Als er seine Mutter angerufen und ihr übers Telefon seine neue Komposition vorgespielt hatte, hatte ihre Stimme vor Freude gebebt. Das war, ehe er sich den kleinen Finger brach.
Sein Finger überschlug einen Ton. Wieder hatte er sich an genau derselben Stelle der Überleitung verkrampft wie das 33letzte und das vorletzte Mal. Das wurde allmählich zur schlechten Gewohnheit.
Digger war schon bei mehreren Ärzten gewesen, um zu hören, was man dagegen tun könne. Soweit sie sagen konnten, war sein Finger völlig verheilt. Sie konnten lediglich Medikamente gegen Muskelverspannung verordnen.
Ganz der Profi, zu dem er sich erzogen hatte, führte er fließend zur nächsten Tonfolge über. Ein uneingeweihter Hörer hätte es nie bemerkt.
Warum läßt du dich auch über diesen blöden Softball-Unfall nachdenken, du Schwachkopf?
Er hörte auf zu spielen und schüttelte seine rechte Hand aus. Der Krampf verging, doch die Stimmung war dahin. »Scheiße«, schrie er in das leere Zimmer hinein und hieb mit der Faust auf seinen Schenkel. »Ich hab von diesem Mist die Nase voll!« Er stand auf und fegte mit einer Hand sämtliche Notenblätter vom Klavier auf den Boden. »Das ist doch Wahnsinn. Ich ertrag das nicht mehr.«
Digger machte sich an den Hausputz. Er wußte, daß er sich wohler fühlen würde, wenn er etwas – und sei es nur dies – vollendet haben würde. Er versuchte herauszufinden, was ihm den Zugang zu Mary verstellte. Dabei summte er wieder und wieder die Überleitung vom ersten zum zweiten Satz vor sich hin. Alles Leben schien aus dem Konzert gewichen. Irgend etwas fehlte. Was, das konnte er nicht herausbekommen.
34
»Es wird schon wieder gehen …«
Digger spürte, wie eine unbekannte Kraft seinen Körper mühelos aufhob. Dann begann er durch die Luft zu fliegen. Im nächsten Augenblick wurde sein Körper durch das Fenster seines Appartements geschleudert. Er fühlte jede einzelne Glasscherbe in seinm Innern explodieren, als er drei Stockwerke tiefer auf das Pflaster schlug. Er konnte nicht glauben, daß er noch am Leben war. Er wäre lieber tot gewesen, dann hätten wenigstens die Schmerzen ein Ende gehabt. Durch die geschwollenen Augen nahm er einen dunklen Schatten auf seinem Körper wahr. Ein Gefühl endgültiger Kapitulation überwältigte ihn. Er wartete auf den Todesstoß, der ihn von all diesem Schmerz erlösen würde.
Es fing an zu regnen, und er begann wieder klar zu denken. Jetzt lief er davon. Die schattenhafte Gestalt war hinter ihm und kam mit jedem Schritt näher.
»Es ist Zeit, Jonathan«, sagte eine Stimme durch den strömenden Regen. Digger erblickte das Licht, das aus einem entfernten Gebäude kam. Mit jedem Schritt rannte er schneller. Da packte eine schwarze Hand seine Schulter und brachte ihn zum Stehen. Als er sich umwandte, stieß er einen Schrei aus …
35
Digger richtete sich kerzengerade im Stuhl auf; Schweißperlen tropften von seinen Schläfen. Verdammt noch mal, das muß aufhören, dachte er. Sein Herz hämmerte noch immer gegen die Brust. Würde dieser Traum jemals enden?
Kurz nach dem Tod seines Vaters hatte er den Alptraum zum ersten Mal gehabt. Der Traum endete immer gleich: sein zerschmetterter Körper auf dem Pflaster vor seiner alten Wohnung, auf den Todesstoß des gesichtslosen Angreifers wartend.
In der Nacht, ehe er sich den Finger brach, kamen zwei neue Elemente hinzu: Zum einen näherte er sich auf der Flucht vor seinem Angreifer einem erleuchteten Gebäude, das er jedoch nie ganz erreichte. Zum zweiten war da diese Stimme.
Zeit, überlegte Digger, Zeit wofür? Er warf einen Blick auf seinen Videorekorder: neun Uhr fünfunddreißig. Er fuhr von seinem Stuhl auf. Das Softball-Spiel begann in fünfundvierzig Minuten. Schnell zog er sein Trikot an und inspizierte das makellos reine Haus. Sieht gar nicht so übel aus, dachte er. Vielleicht kriege ich jetzt ein paar Noten aufs Papier, wenn das Spiel erst vorüber ist.
Er ging zur Garderobe, grub seine Sporttasche aus und kontrollierte den Inhalt: Zwei Feldhandschuhe, Aluminium-Schlagstöcke, Schlägerhandschuhe, Baseballhandschuhe, Sonnenbrille und Unmengen von Kaugummi. Er warf sich die Tasche über die Schulter und steuerte auf die Tür zu.
Das Telefon läutete. Er wollte die Tür öffnen und gehen, überlegte es sich aber anders. Wer weiß? Vielleicht war es seine Mutter. Er wollte es nicht schon wieder mit einer ihrer Schuldnummern zu tun bekommen.
»Hallo?«
»Einen wunderschönen guten Morgen, Patrick, mein Junge«, sagte Sean Green. »Ich dachte, ich probier's mal, wenn ich dich nicht grad' wecke, verstehst du?«
36
»In Ordnung, Sean, was kann ich für Sie tun?« Gänsehaut überlief plötzlich seinen Körper, und ihm brach der kalte Schweiß aus. »Ich wollte gerade gehen«, fügte er voller Unbehagen hinzu.
»Tja, dann mußt du deine Pläne wohl ändern, Junge. Was ich dir zu sagen habe, das kriegst du nur einmal im Leben geboten.«
»Was meinen Sie damit?« fragte er und stellte seine Sporttasche auf den Boden.
»Sitzt du gut, mein Junge? Es könnte nämlich sein, daß dir die Luft wegbleibt, verstehst du? Womöglich kommst du sogar auf die Idee, ich wollte dich auf den Arm nehmen.«
»Bitte, spucken Sie's einfach aus.«
»Erinnerst du dich noch an das Band, das du mir geschickt hast?«
»Natürlich.«
»Also. Heut ist dein Glückstag, mein Junge! Ich hab gerade einen Anruf von 'nem Freund bei den Warner Studios gekriegt. Er heißt Philip Michaelson. Das is 'n großer Regisseur da drüben, verstehst du? Ich hatte ihm 'ne Kopie von deinem Band geschickt. Naja, und er hat es sich gestern abend angehört und findet, man könnte was damit anfangen.« Greens Stimme schwoll an: »Er meint, vielleicht sogar für einen Film, den er gerade produziert. Was hältst du nun davon?«
Digger bekam weiche Knie. Er sank auf die Couch, während seine Gedanken außer Kontrolle gerieten. War das tatsächlich sein Glückstag oder nur eine leere Versprechung, die sich als Chance ausgab?
Keiner der Männer sagte etwas.
»Was ist los, Junge, hat's dir die Sprache verschlagen?«
Digger räusperte sich. »Und wie geht's jetzt weiter?«
»Das geht so, daß du dich hierher in Marsch setzen wirst. 37Er will sich mit dir treffen. Er will dich spielen hören, mein Sohn. Heute noch.«
»Heute?«
»Er will, daß du um sechs Uhr heute abend auf dem Set bist. Da findet eine Hörprobe statt, verstehst du? Du und noch drei andere. Was hältst du davon, mein Lieber; bist du bereit?«
Digger stand auf und griff nach Bleistift und Papier, die auf dem Klavier lagen. Sein Verstand arbeitete nicht, aber das war ohne Bedeutung. Er wollte gar nicht nachdenken; das viele Nachdenken ließ ihn womöglich noch in eine Katatonie fallen. Seine Hände zitterten. »Wie lautet die Adresse?«
»So ist er 'n guter Junge«, schnurrte Green mit Samtstimme. »Ich werden einen Chauffeur zum Bahnhof in L. A. schicken, der dich abholen wird. Kannst du den Elfsiebenunddreißiger von San Diego nehmen?«
Fast zwei Stunden noch, dachte Digger. Ich werde mich krank melden, ein paar Sachen zusammenpacken, ein Zimmer in der Nähe des Studios reservieren lassen und meine Musik in einen Koffer schmeißen. »Das müßte gehen«, sagte er und bemühte sich, einen geschäftsmäßigen Ton anzuschlagen.
Green gab Digger noch genaue Instruktionen, wohin er sich zu wenden und was er zu sagen habe. Er überließ nichts dem Zufall und forderte Digger auf, noch einmal zu wiederholen, was er diktiert hatte. Danach klang es, als wolle der Ire die Unterhaltung beenden. »Laß dich von all dem Brimborium bloß nicht abschrecken. Hast du schon mal vorgespielt?«
»In der Schule, aber seitdem nicht mehr.«
»Es wird schon wieder gehen. Du wirst in einem Theater auf der Bühne spielen. Michaelson und sein Stab werden im 38Zuschauerraum sitzen. Aber wahrscheinlich wird keiner ein Wort sagen. Sie werden dich auf Video aufnehmen. Die Leute vom Theater werden dir sagen, wo du dich melden sollst und wann du dran bist. Ich werde auch da sein, aber wir werden nicht miteinander reden, bis alles vorbei ist. Ich will, daß du an nichts anderes denkst als an deine Musik.« Er machte eine Pause. »Hast du noch Fragen, mein Junge?«
Digger fiel nichts ein.
»Naja, du weißt ja meine Nummer, wenn dir noch was einfällt. Denk dran, du mußt rechtzeitig da sein, verstehst du. Im Sonntagsstaat?« Er legte auf.
Digger lachte lauthals. Er wußte nie genau, ob der Ire eine Frage stellte oder nicht. ›Sonntagsstaat‹. Das hatte seine Mutter immer gesagt, wenn sie meinte »Mach dich so richtig fein, damit du so gut aussiehst, wie du kannst«. Er nahm an, Green meinte, er solle einen Smoking tragen, wenn er einen hätte.
Er holte lange und tief Atem. Aus irgendeinem seltsamen Grund kam ihm das Zimmer jetzt wärmer vor. Der reine, salzige Duft des Ozeans drang ihm in die Nase. Draußen schrien die Möwen und kämpften um ein Morgenmahl, während tief unter ihnen meterhohe Brecher gegen das Ufer schlugen und die Welt daran erinnerten, daß sie noch immer ihre Arbeit taten – Minute für Minute, Stunde für Stunde, Jahr für Jahr, Jahrhundert für Jahrhundert, seit Anbeginn der Zeit. Nie hielt sie inne, nie bat sie um Mitleid oder einen freien Tag. Sie tat nur ihre Pflicht.
Digger überlegte, wie schön es wäre, wenn er an ihrer Stelle wäre. Dann wüßte er genau, was er zu tun hätte. Er schüttelte den Kopf und ging zum Klavier hinüber. Er setzte sich und begann leise die ersten Takte der Überleitung zu spielen. »Also gut, Taylor«, sagte er laut in bestem Irisch, »bist du bereit, mein Junge?«
39
Wie gewöhnlich fuhr der Zug zu spät ab. Die meisten Züge, die auf der Küstenstrecke von San Diego nach Los Angeles verkehren, haben Verspätung. Digger wußte das, weil er diese Reise – nicht geschäftlich, sondern zum Vergnügen – schon früher gemacht hatte. Die Stadt der Engel bot viele lohnenswerte kulturelle Veranstaltungen, die nie den Weg nach San Diego fanden, die er aber alle besuchen wollte. Dies war eine der wenigen Extravaganzen, die er sich trotz seiner anhaltenden finanziellen Probleme erlaubte. Das letzte Mal war es »Das Phantom der Oper« in der Broadway-Besetzung gewesen. In der Regel fuhr er allein. Die Schönheit und den Genuß einer Oper, einer Symphonie oder einer Autorenlesung nahm er am liebsten allein in sich auf.
Heute fand er mühelos einen Doppelsitz auf der Ozeanseite des Zuges. Werktags hatte man eine phantastische Auswahl an guten Plätzen. Diesmal aber dachte er, es wäre ideal gewesen, wenn er Gesellschaft gehabt hätte.
Digger schaute durchs Fenster auf die Brandung und die weißen Sandstrände von Del Mar hinunter. Während der Zug langsam zum Stehen kam, weckte der Sand die Erinnerung an sein Treffen mit Mary am frühen Morgen dieses Tages. Schade, daß sie ungeduldig war, dachte er. Es hätte ihr Spaß gemacht, diese Reise mit ihm zu machen. Er mochte ihren Humor und ihren Scharfsinn. Eigentlich wäre er sogar stolz gewesen, sie seine Musik hören zu lassen, wenn es ihm nur endlich gelänge, sie richtig klingen zu lassen. Aber noch war es nicht so weit.
Beruhige dich, Taylor. Es hat keinen Sinn, sich immer wieder fertigzumachen. Wenn du im alten Trott weitermachst, dann fährst du nur nach L. A., um da einen Flop hinzulegen. Wahrscheinlich ist dies wirklich eine so absolut einmalige Chance, wie Green gesagt hat. Den Filmleuten ist bloß wichtig, daß du ein Macher bist. Green hat ihnen das Band gegeben, 40uns sie sind interessiert. Also hast du die erste Runde schon mal geschafft. Das ist die gute Nachricht. Jetzt mußt du in die zweite Runde kommen, und das Problem ist dein kleiner Finger – naja, nicht direkt. Es sind die Phrasen in der Überleitung. Das ist das Problem. Du hast noch sechs Stunden Zeit, dich in eine positive Gemütsverfassung zu bringen. Du mußt irgend etwas anderes tun. Etwas, das diese Überleitung in Gang bringt.
Aus dem Zugfenster sah Digger den tiefblauen Pazifik im Licht der Nachmittagssonne gleißen. Es hätte ebensogut der Atlantik sein können. Komisch, dachte er, wie sich die Ozeane gleichen und doch so unterschiedlichen Gefühlsballast mit sich führen können. Er erinnerte sich zehn Jahre zurück, als er von Chicago nach Florida Keys fuhr – fünfundzwanzig denkwürdige Stunden lang. Damals hatte er genau dasselbe getan wie jetzt – er hatte sich geschworen, alles anders zu machen.
Seine Heirat mit Ruth in Chicago war von Anfang an eine Fehlentscheidung gewesen. Er hatte gewußt, daß er sie nicht wirklich mit ganzem Herzen liebte – mit dieser »bis daß der Tod euch scheidet« Art von Liebe, von der er im Katechismus so viel gehört hatte. Doch während sie verliebt waren, und sogar noch im ersten Jahr ihrer Ehe schien es, als hätten sie das Richtige getan.
Sie hatten sich beide die größte Mühe gegeben, aber wie sich herausstellte, war das nicht genug. Tatsache war, daß keiner von ihnen genügend Lebenserfahrung hatte, um zu wissen, was man tun musste, damit eine Partnerschaft funktionierte. Sie beide strengten sich viel zu sehr und doch zu wenig an. Eines der Hauptprobleme war ihre Unfähigkeit miteinander zu reden: Sie war voller Ängste, dachte an Hölle und Teufel, und er hatte schon immer Schwierigkeiten, Gefühle 41wahrzunehmen und auszudrücken. Statt mehr Energie in die Beziehung zu stecken, verbrachte er mehr Zeit außer Haus, beim Sport oder in einer Theatergruppe.
Jahre später, als sie schon geschieden waren, setzten sie sich zusammen und redeten. Inzwischen sahen sie beide ihre Beziehung aus einer klareren Perspektive. Ruth sagte, sie erkenne jetzt, daß sie damals geglaubt habe, die Ehe sei für ein irisch-katholisches Mädchen der einzige legitime Weg, seine Familie zu verlassen. Digger erklärte ihr, daß er unwissentlich seine Rolle im Drehbuch der Gesellschaft erfüllt hatte: Das College besuchen, einen guten Job bekommen, sich verlieben und heiraten.
Diesen Fehler konnte sich Digger schließlich verzeihen. Während seiner Tätigkeit als Familienberater in Chicago machte er sogar die Erfahrung, daß die meisten Menschen sich nicht einmal bewußt sind, daß sie nach Drehbüchern leben, die nicht die ihren sind. Er sagte Ruth jedoch, er werde es immer bereuen, daß er, nachdem er einmal die Notwendigkeit erkannt hatte, sich aus dieser Beziehung zu lösen, nicht danach gehandelt habe. Er hatte diese Gefühle und Gedanken für sich behalten, den Kopf in den Sand gesteckt und gehofft, daß sich das Problem von alleine lösen werde. Weil er nicht mit ihr redete, sondern die Partnerschaft aufrechterhielt, hatte er letztlich noch mehr Schaden angerichtet.
Ein ähnliches Zögern befiel ihn, als es darum ging, Chicago zu verlassen. Schon seit Jahren hatte ihn ein Gefühl der Leere befallen. Irgend etwas rief nach ihm, drang in ihn, neue Wege zu gehen, woanders zu leben, etwas anderes zu tun, anders zu sein. Das hätte jedoch bedeutet, daß er seine Frau, seinen Beruf, seine Freunde, den Sport, das Theater und die Familie hätte verlassen müssen. Wer aber war er, wenn er all diese Menschen und Aktivitäten nicht um sich hatte? Also führte er weiter ein Leben voller getarnter Leere, 42in dem trotz aller Ablenkungen schließlich das Gefühl des Untergangs seinen festen Platz hatte.
Heute glaubte Digger fest daran, daß dieses Zögern ihn beinahe umgebracht hatte. Gott oder irgendwer hatte gesagt »Was zuviel ist, ist zuviel« und hatte ihm an einem heißen Chicagoer Wochenende eine Botschaft gesandt – eine unübersehbare Botschaft.
Der Signalton eines Bahnübergang und der langgezogene Pfiff des Zuges holten Digger in die Gegenwart zurück. »Nächster Halt San Juan Capistrano«, brüllte ein Schaffner. Digger schaute sich um. Eine zierliche Spanierin mit zwei Kindern saß auf der anderen Seite des Ganges ihm gegenüber.
Der Junge, der ungefähr zwölf Jahre alt sein mochte, stand da und schaute auf die Gepäckablage über Diggers Kopf. »Wie sollen wir unser Zeug da runterkriegen?« fragte er seine Mutter auf Spanisch. »Ich komme nicht dran.«
»Macht nichts«, antwortete sie in derselben Sprache. »Wir werden den Schaffner bitten, uns zu helfen. Setz dich ruhig hin. Ich möchte nicht, daß du dich verletzt. Der Zug fährt zu schnell.«
Zögernd setzte der Junge sich hin, protestierte aber weiter. Seine kleine Schwester sagte, er solle nicht so angeben.
Digger beobachtete die Szene und wandte sich dann ab, um aus dem Fenster zu sehen. Es sollte nicht so aussehen, als habe er gelauscht, nur weil er Spanisch verstand. Aber helfen wollte er; auf den nächsten Schaffner würden sie ewig warten.
»Entschuldigen Sie«, sprach er schließlich die Frau auf Englisch an, »kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Er zeigte nach oben auf das Gepäcknetz. »Haben Sie etwas da oben, das ich Ihnen herunterholen kann?«
Die Frau lächelte.
43
»Klar, Mann«, sagte der Junge auf Englisch. »Wir haben unsern ganzen Krempel da oben. Sie will, daß es uns der Schaffner runterholt, aber wer weiß, wann der wieder vorbeikommt.«
Digger lächelte und nickte der Frau und ihrer Tochter zu. »Sind Sie einverstanden?« fragte er auf Englisch.
Der Junge übersetzte, während die Frau Digger musterte. Dann nickte sie. »Gracias, señor. Gracias.«
Nachdem er alle Koffer und Papiertüten heruntergehoben hatte, nickte er der Frau noch einmal zu und wandte sich dann an den Jungen. »Ist das alles? Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen?«
»Nein. Das is cool, Mann. Das war alles.«
Digger ging an seinen Platz zurück.
Der Junge setzte sich neben ihn. »Danke vielmals, Kumpel. Wo fahren Sie hin?«
»L. A.«
»Gucken Sie sich 'n Spiel der Dodgers an, oder so?«
»Nein. Magst du die Dodgers?«
»Ja. Das is mein Team, Mann. Mike Piazza is' für mich der Größte, Kumpel. Stärkster Mann in Südkalifornien. Wahnsinn. Sind Sie ein Padre-Fan?« fragte der Junge.
»Nein, ich bin eigentlich ein Cubs-Fan.«
»Aber die verlieren dauernd. Warum feuern Sie 'n die an?«
Digger lachte leise. »Ich bin in Chicago großgeworden, und meinen Dad hab ich eigentlich nur zu sehen gekriegt, wenn er mir erlaubt hat, zu ihm in die Fabrik zu kommen. Wrigley Field war bloß einen Häuserblock entfernt. Da hab ich dann am Morgen immer die Fußböden blank gemacht und bin am Nachmittag zum Spiel der Cubs gegangen.« Er überlegte kurz. »So hatte ich die Ehre oder den Fluch – ich bin mir immer noch nicht sicher, was von beidem es ist -, ein Cubs-Fan zu sein.«
44
Beide lachten.
Der Junge fuhr fort: »Man sagt, daß die Leute, die zu den Cubs halten, ganz knüppeltreue Fans sind. Stimmt das?« Die Unterhaltung sichtlich genießend, lehnte er sich in seinem Sitz zurück.
»Ich glaube, auf mich trifft das zu. Als ich so alt war wie du, hab ich immer ganz komische Sachen gemacht, um den Cubs gewinnen zu helfen.«
»Was meinen Sie damit?«
»Ich hab mit dem lieben Gott in Sachen Baseball jedesmal einen Handel geschlossen.«
»Sie machen Witze.«
»Nun erzähl mir bloß nicht, daß du noch nie mit Gott einen Handel gemacht hast«, sagte Digger mit gespielter Strenge.
Der Junge ließ den Kopf hängen. »Naja, manchmal, wenn ich was gemacht hab, was ich nicht soll. Dann sag ich zu Gott, wenn Er macht, daß ich keinen Ärger kriege, geh ich zweimal die Woche in die Kirche.«
»Das hab ich auch gemacht«, sagte Digger lächelnd. »Aber mit Gott und Baseball war es so, daß ich im Liegestuhl unter dem Ahornbaum in meinem Vorgarten saß und einem Spiel der Cubs zuhörte. Ich hatte mir selbst ein Buch für die Spielberichte gemacht, darin schrieb ich die Statistiken auf. Die Cubs kämpften immer darum, vom letzten Platz runterzukommen, meistens gegen die Phillies. Wenn am Ende des neunten Innings Ernie Banks drankam, dann fing mein Handel an. Ich hab's nicht mit dem ›Ich geh auch in die Kirche‹-Theater gemacht. Nein, ich habe höhere Einsätze geboten. Ich habe zu Gott gesagt, wenn er Ernie ein Homerun schlagen ließe, mit dem das Spiel gewonnen wäre, dann würde ich eine Vier in Erdkunde akzeptieren. Je nach Spiel hab ich die Namen der Batter und meine Schulfächer ausgetauscht.«
45
»Und hat es funktioniert?«
»Naja, ich hab herausgefunden, daß der liebe Gott ein Fan der White Sox sein muß.« Digger sah dem Jungen in die Augen. »Oder vielleicht ein Dodgers-Fan. Die Cubs haben nämlich kaum je eines dieser Spiele gewonnen. Aber, was die Sache noch schlimmer machte, war, daß ich meinen Eltern irgendwie erklären mußte, warum ich so viele Vieren nach Hause brachte!«
Beide lachten laut heraus.
Und als Erwachsener habe ich nach sechzehn Jahren katholischer Erziehung noch immer keinen Zugang zu Gott und zur Spiritualität, dachte Digger.
Er wechselte das Thema. »Spielst du Baseball?«
»Ja, Kumpel. Shortstop. Allstar. Das is was für mich. Das will ich werden, wenn ich groß bin – ein Baseballspieler.«
»Jorge«, schimpfte seine Mutter auf Spanisch. »Komm hier herüber und setz dich hin. Du störst den Mann.«
Der Junge hob die Augenbrauen und seufzte. »Si, Mama.« Er winkte Digger noch einmal zu und nahm neben seiner Mutter Platz. Der Zug kam quietschend zum Stehen.
Die Familie dankte Digger zum Abschied überschwenglich. Jorge ging als letzter, die Arme voller Papiertüten und kleiner Reisekoffer. »Tausend Dank, Kumpel«, sagte er. »Wenn Sie die Dodgers sehen oder hören, dann denken Sie immer an mich, Jorge. Hoch die Dodgers!«
Digger lächelte und hielt dem Jungen die Tür auf. Als sie gegangen waren, setzte sich Digger hin und dachte an die Zeit zurück, da er in Jorges Alter war. Er liebte Baseball. Er spürte, daß in diesem Spiel eine gewisse Poesie und Anmut lag. Die Leute lachten ihn aus, wenn er versuchte, ihnen das zu erklären, doch seitdem es die Wiederholungen in Zeitlupe gab, so meinte er, konnte nun jeder sehen, was er immer gespürt hatte.
46
Es gab noch andere Gründe für seine Liebe zum Baseball: Hier gab es nicht das endlose Warten, bis sein Dad nach Hause kam. Hier gab es die Klagen, das Geheul und das Geschrei seiner Mutter nicht. Hier war es nur er, der schrie »Ich hab ihn«, wenn er einen Flugball runterholte. Nur er, der rannte, so schnell er konnte. Nur er, der schlug, fing, brüllte, schlitterte und rannte, bis es so dunkel war, daß er den Ball nicht mehr sah. Dann, und erst dann hörte er auf zu rennen und konnte nach Hause gehen.
Die Abteiltür gleich neben Diggers Platz wurde aufgestoßen. »Nächster Halt Anaheim«, brüllte der Schaffner im Vorübergehen. Der Zug fuhr an.
Es wird Zeit, daß du den Kopf wieder klar kriegst, Taylor.
Digger starrte aus dem Fenster des Zuges, der seinem nächsten Halt entgegenruckelte. Diesen Streckenabschnitt mochte er am wenigsten. Man sah nichts als Frachthöfe, die öden Nebenstraßen und verlassenen Gebäude der südlichen Außenbezirke von L. A. – eine Gegend zum Vergessen.
Er mußte sich darüber klarwerden, was er mit der Überleitung in seinem Konzert anstellen wollte – und was war, wenn sich sein Finger während des Vorspiels verkrampfte? Denk lieber gar nicht erst über so etwas nach, Taylor. Bleib lieber am Ball. Er lachte in sich hinein – »am Ball bleiben« – Baseball-Jargon für sein Klavierspiel. Taylor, du bist ein Chaot. Aber genau den Rat hätte der Junge dir gegeben. Digger stellte sich vor, wie Jorge sich ausgedrückt hätte. »Na los, Taylor. Laß doch den Scheiß, Mensch. Bleib am Ball, Kumpel. Hoch die Musik.«
Seine Aufmerksamkeit richtete sich nun wieder auf die trostlose Szenerie draußen. Sie erinnerte ihn an den Süden Chicagos. Langsam wanderten seine Gedanken zurück zu jenem grauenvollen Wochenende im August.
47
Es war ein typischer Augustnachmittag in Chicago – heiß und schwül, Temperatur und Luftfeuchtigkeit gleichermaßen hoch. In einer Woche wäre seine Scheidung endgültig, und in zwei Wochen würde er in Key West Ferien machen. Seit er und sein Dad die Inseln vor der Südwestspitze Floridas besucht hatten, hatte er den Wunsch, professionell zu tauchen, lautlos in die Wunder der Korallenriffe einzudringen. Jetzt wurde sein Traum Wirklichkeit. Er stand auf der Kaimauer und bereitete sich auf seine letzte Unterrichtsstunde vor, den letzten Test vor dem Tauchschein. Die Hitze brannte von den Zementblöcken der Mole an der Fünfundfünfzigsten Straße herunter, doch Digger zog den vollständigen Taucheranzug an. Ein paar Meter weiter unten war der Michigansee mit Sicherheit noch eiskalt. Sein Tauchlehrer, dessen Assistent und zwei von Diggers Freunden brannten darauf, in den kühlen See zu springen. An der Kaimauer lehnten etwa fünfzehn lebenserhaltende Sauerstofftanks, die aber auch tödlich wirken konnten, falls einer der explosiven Tanks gegen einen Felsen prallen sollte. Der Tauchlehrer gab eine letzte Anweisung, vergewisserte sich, daß jeder von ihnen »Begleitschutz« hatte, und mit einer letzten Ermahnung zur Vorsicht sprangen sie nacheinander in den kühlen See. Als sie alle im Wasser waren, stiegen sie auf den etwa sechs Meter tiefen Grund hinunter. Die Sichtweite betrug nur einen halben bis einen Meter, doch Digger konnte sehen, wie der Begleiter des Tauchlehrers einen kleinen, offenbar runden Gegenstand auflas. Er schwamm näher, um ihn sich anzuschauen.
Der Taucher gab den Gegenstand an Digger weiter, der ihn vor seine Maske hielt, um ihn genauer betrachten zu können. Er fand nicht heraus, was es war. Achselzuckend gab er ihn dem Taucher zurück.
Nun gingen sie alle das Prüfungsprogramm durch. Handsignale, 48das Auf- und Absetzen der Maske, Reinigen der Schläuche, Atmen mit dem Begleitsystem und ein wenig Kompaßtauchen. Als ihre Luftdruckanzeiger fünfhundert Psi angaben, schwammen sie mit ihren jeweiligen Begleitern an die Wasseroberfläche.
Alle packten ihre Sandwiches und Limonaden aus, um zu feiern. Digger wunderte sich, wie hungrig ihn die kleine Tauchtour gemacht hatte. Noch während der Mahlzeit wurde der seltsame kleine Gegenstand wieder und wieder betrachtet. Die Männer ließen ihn herumgehen. Als Digger an der Reihe war, sah er ihn noch einmal genau an und gab ihn dann seinem Begleitschwimmer weiter. Schließlich wurde der Gegenstand wieder dem Freund des Tauchlehrers zugeworfen. Der fing ihn auf und erhob sich, um ihn wieder in seiner Tasche zu verstauen.
Alles, woran Digger sich erinnern konnte, war ein lauter Knall. Fleischfetzen und dunkelrote Flüssigkeit schossen durch den weißen Phosphorrauch, der sie einhüllte. Er glaubte, die Sauerstofftanks explodierten, und sie würden nun alle sterben. Er duckte sich so tief wie möglich und kroch an der Zementmauer entlang. Als der Rauch sich ein wenig aufgelöst hatte, sah er, wie der Tauchlehrer den Arm seines Freundes verband. Digger und seine Kameraden suchten nach den Resten der Hand des verletzten Tauchers.
Die Polizei vermutete, daß jemand ein Andenken an den Zweiten Weltkrieg loswerden wollte und es – in der Annahme, dort unten sei es in Sicherheit, in den See geworfen habe. Doch die Zündkapsel einer britischen Landmine kostete den Kameraden des Tauchlehrers fast die ganze Hand.
Am darauffolgenden Abend waren Digger und seine Freund noch immer erschüttert. Sie konnten die grauenvolle Szene des Vortages nicht vergessen. Um wenigstens 49einen Teil ihrer Angst loszuwerden, beschlossen sie, durch die Stadt zu ziehen und ein paar Biere zu trinken. In der Rush Street machten sie den Anfang. Dann arbeiteten sie sich durch einige Jazzlokale. Nach vielen Stunden und zu vielen Bieren fuhren sie in einen Stadtteil namens Old Town. Es war eine schwül-heiße Nacht, und die halbe Stadt war auf den Beinen. An allen Ecken standen Leute, die miteinander redeten, lachten und sich amüsierten. Der Verkehr war so dicht, daß die Fußgänger schneller vorankamen als die Autos.
Digger und seine Freunde warteten in einer Autoschlange, als eine Gruppe betrunkener junger Burschen eine der Kneipen verließ und auf das Auto zuschlenderte. Digger, der auf dem Rücksitz saß, fühlte, wie ihm Schauer über den Rücken liefen. Einer der Trunkenbolde steckte seinen Kopf ins Rückfenster. Sein Atem stank nach Whiskey, als er ein paar Zeilen aus einer alten irischen Ballade sang: »Bist du 's nicht müde, vor dem Teufel zu flieh'n? Du weißt doch, er gleicht dir und mir aufs Haar.« Der Mann zwinkerte und schaute Digger mit einem bösartigen Lächeln an, ehe er sich umdrehte und seinen Kameraden folgte.
Seltsamerweise hatte Digger das Gefühl, er sei diesem Kerl schon einmal begegnet. Er wußte nicht genau, wo oder wann, aber gesehen hatte er ihn. Nein, dachte er, nicht so sehr gesehen, mehr gefühlt.
»Hallo«, brüllten seine Kameraden zwei attraktiven Frauen zu, die den Gehsteig entlang neben dem Auto schlenderten. Während der Wagen sich zentimeterweise durch den Verkehr schob, unterhielten sie sich mit den Frauen. Es stellte sich heraus, daß sie alle in dieselbe Bar wollten. Seine Begleiter boten den Frauen an, mitzufahren. Eine von ihnen setzte sich nach vorn, die andere neben Digger nach hinten.
Alle lachten, kicherten und plauderten ihre Lebensgeschichte 50aus; dann fragte das Mädchen auf dem Vordersitz, ob sie an der nächsten Ecke abbiegen könnten. Sie sagte, sie müsse an der Wohnung ihrer Freundin eine Nachricht hinterlassen. Sie hielten nur eine Minute an. Als die junge Frau zurückkam, sagte sie, es ginge schneller, wenn sie eine Abkürzung durch die nächste Gasse nähmen.
Digger flirtete mit der Frau auf dem Rücksitz, als der Wagen in die Gasse einbog. Im nächsten Augenblick wurde ihm klar, daß er als einziger sprach. Als er den Kopf zum Vordersitz wandte, fühlte er, wie sich der kalte Stahl eines Revolvers in seine Stirn bohrte. Er spürte zwei Dinge auf einmal: Sein Herz fühlte sich an, als wolle es seine Brust durchschlagen, zugleich mußte er mit aller Energie das Bedürfnis seines Körpers unterdrücken, sich auf der Stelle zu entleeren.
Nachdem sie seinen Begleitern die Brieftaschen abgenommen hatte, griff die Frau, die neben ihm saß, in seine Brusttasche und zog das Geld heraus. Niemand hatte ein Wort gesprochen. Es war wie ein Stummfilm. Nichts war zu hören als das Hämmern seines Herzens, das in seinem Kopf dröhnte. Die Frau auf dem Vordersitz zog die Wagenschlüssel ab und sagte zu den drei Männern: »Angenehme Nacht noch, Jungs.« Dann schlenderten die Frauen davon und warfen die Autoschlüssel in den nächsten Müllcontainer.
Einen Augenblick – der ihnen wie eine Ewigkeit vorkam – saßen die mittlerweile wieder nüchternen, völlig verblüfften Männer schweigend da. Dann endlich durchwühlte der Fahrer das Handschuhfach und brachte einen Ersatzschlüssel zum Vorschein. Als sie in dieser Nacht nach Hause fuhren, schwankten Diggers Empfindungen zwischen Panik und Erleichterung, zwischen Zorn und Glück und dem Gefühl, ein ausgemachter Narr zu sein.
Am nächsten Morgen ging er mit einem leichten Kater zur Arbeit. Ehe er seinen Kollegen noch von seinem höllischen 51Wochenende erzählen konnte, sah er schon drei Notlage-Berichte auf seinem Schreibtisch liegen. Alle waren sie seine Patienten: John, ein sechzehnjähriger Junge, lag nach einer Überdosis Drogen im Krankenhaus. Susan, ein dreizehnjähriges Mädchen, stand unter der Obhut des Jugendamtes, nachdem ihr Vater sie ein weiteres Mal sexuell mißbraucht hatte. Und der zwölfjährige Leon hatte sein Zimmer in Brand gesetzt.
Die nächsten zwölf Stunden verbrachte Digger damit, seinen Patienten und ihren Familien bei der Bewältigung ihrer jeweiligen Krise zu helfen. Als er an jenem Abend in sein Büro zurückging, wußte er, alle Ängste, Chicago, seine Familie und Freund zu verlassen, waren wie weggeblasen. Er hatte nicht die Spur eines Zweifels mehr, als er zur Schreibmaschine hinüberging und seine Kündigung hineintippte. Er wußte noch nicht genau, was er tun würde. Doch eines wußte er. Was es auch sein würde, es würde nicht in Chicago sein. Irgend jemand oder irgend etwas hatte ihm eine Botschaft gesandt. Er hatte sie empfangen. Er verstand sie nicht unbedingt – aber empfangen hatte er sie schließlich doch.
Die Abteiltür wurde aufgestoßen, und der Lärm des dahinrasenden Zuges fuhr Digger in die Ohren. »Nächster Halt Anaheim«, brüllte der Schaffner. »Nächster Halt Anaheim.«
Digger seufzte und schaute auf die Uhr. Er schüttelte den Kopf und versuchte, seine Gedanken von den Spinnweben zu befreien. In der Therapie nannte man das einen »Museumsausflug«, wenn man zu früheren Ereignissen in die Vergangenheit zurückkehrte. Seltsam, aber es schien, als brenne sein Unterbewußtes darauf, jeden noch so kleinen Winkel, jedes Eckchen seines privaten Louvre aufzusuchen.
52
»Wer war er ohne all diese Menschen
und Aktivitäten?«
Nicht mal mehr vier Stunden, Taylor, und von Kampfgeist immer noch keine Spur. Jetzt mußt du allmählich ernsthaft über deine Finger und diese Überleitung nachdenken. Das Nachdenken über frühere Krisen hilft dir jetzt nicht. Wie wäre es statt dessen mit einem Behelfsplan, nur für den Fall, daß du bei dem Vorspiel einbrichst?
Plan, dachte er. Das ist ein Wort, das du schon lange nicht mehr gebraucht hast. Als du nach Florida zurückkamst, sah es aus, als könntest du gar nichts anderes mehr sagen. Plan. Vielleicht hätte es sogar geholfen. Eines hast du jedenfalls in Florida gelernt: Es geht in deinem Leben nicht darum, wie du Plan A im Leben erfüllst, sondern darum, wie du mit Plan B zurechtkommst.
»Anaheim«, schrie ein Schaffner. »Bitte Vorsicht beim Aussteigen.«
Der Zug hielt mit einem Ruck an. Schwerfällig wie immer setzten sich die Reihen der nach draußen strebenden Passagiere in Bewegung. Auf dem Bahnsteig sah Digger die Zusteigenden Schlange stehen. Im Waggon war es heiß und schwül von der sengenden Sonne und den offenstehenden Türen.
Digger gähnte und nickte drei Nonnen zu, die an seinem 53Platz vorübergingen. Noch dreißig Minuten oder so, Taylor, dann wirst du in Sean Greens Luxuslimousine durch den frühnachmittäglichen Verkehr von L. A. zum Vorspiel deines Lebens fahren. Los, Digger. Überleg dir, was du machen willst, wenn du es nicht schaffst. Du willst dich doch nicht zum Narren machen. Du mußt dir einen Plan zurechtlegen.
Seine Augenlider wurden schwer. Angestrengt versuchte Digger, die Augen wieder zu öffnen; aber er hatte an diesem Morgen nur eine Stunde geschlafen – und die war von seinem ständig wiederkehrenden Alptraum beansprucht worden. Du mußt dich hier durchkämpfen, Taylor. Wenn das Vorspiel erstmal vorüber ist, kannst du schlafen, soviel du willst.
Wenige Augenblicke später fielen ihm schließlich doch die Augen zu. Schwarzweißbilder zuckten kreuz und quer unter seinen Augenlidern vorüber. Seine Gedanken jagten vor und zurück, zwischen dem, was er nach Ansicht der Leute mit seinem Leben anfangen sollte, und dem, was er selbst tun wollte.
Digger war das Leben nie in Klarheit erschienen – er hatte es nie deutlich in Schwarz und Weiß unterteilen können, obwohl er glaubte, daß sein katholischer Kinderglaube es so zu vereinfachen versuchte. Selbst wenn es um so wichtige Themen wie Gott, das Leben nach dem Tode und die Seele ging. Er hatte es schon vor langer Zeit aufgegeben, darüber nachzudenken.
Diggers Gedanken wanderten zurück in die Zeit, da er als kleines Kind auf alle Fragen des Katechismus die richtige Antwort gewußt hatte. Doch selbst die Kenntnis all dieser religiösen Dinge füllte die innere Leere nicht aus. Eigentlich verwirrte sie seinen Verstand, sein Herz und seine Seele noch mehr. Irgendwie paßten das Leben, das er lebte, und jenes, das er leben sollte, nicht zusammen. Soweit es ihn betraf, hatte die Religion von Grund auf versagt.
54
In Wirklichkeit trug Digger noch immer Zorn über seine katholische Erziehung mit sich herum. In seiner Nachbarschaft führten zwei Bürgersteige zu zwei verschiedenen Schulen. Sie wurden von allen nur »der katholische Bürgersteig« und »der öffentliche Bürgersteig« genannt – »öffentlich« war jeder, der nicht katholisch war.
Man lehrte ihn, was die meisten Religionen ihre Gläubigen lehren: daß sie die Erwählten seien. Nur Katholiken kamen in den Himmel. Als er ein wenig älter wurde, erkannte Digger, daß das nicht ganz stimmte. Es gab – zumindest im Katholizismus – eine Übereinkunft, nach der man in die Hölle kam, wenn man mit einer Todsünde auf dem Gewissen starb. Digger lernte schnell, wofür der Beichtstuhl gut war – er lösche all diese Schönheitsfehler wieder aus.
Ein paar Jahre nachdem Jonathan zu Verstand gekommen war, begannen einige dieser Lehren ihre Wurzeln in sein kleines Hirn zu senken: Sein Vater war Lutheraner und würde deshalb im Himmel keinen Einlaß finden. Man erzählte ihm, das Beste, was sein Vater erhoffen könnte, wäre, ins Fegefeuer zu kommen. Wird ungefähr dasselbe sein, wie sein Leben hier, dachte Digger. Diese Auffassung paßte ihm nicht, denn obwohl er seinen Vater selten sah, glaubte er dennoch, daß sein Dad der Größte sei. Keine Nonne konnte ihm etwas anderes erzählen. Er sprach nie über diesen kleinen Kampf in seinem Innern, doch still für sich machte er die Ansage: Strike Eins.
Die Nonnen waren strenge Zuchtmeister. Sie konnten hart, gemein und herrschsüchtig sein. Digger glaubte, sie seien die Hand Gottes, zur Erde gesandt, um alle Kinder im Zaum zu halten.
Als er vor dem Abschluß der Realschule stand, hatte der Aufruhr der Hormone in seinem Körper bereits begonnen. Eines Tages kam diese körperliche Entwicklung zur Sprache. 55Alle moralischen Probleme, über die man in der Klasse sprach, kreisten wie in den meisten Fällen um die Frage: »Ist es Sünde, wenn ich …?« Ein Junge von den hinteren Bänken fragte nach dem Zusammenhang zwischen Erektion und Sünde. Digger hätte nie geglaubt, daß jemand eine solche Frage stellen würde! Er hatte seit Monaten darüber nachgedacht, hatte jedoch nie gewagt, danach zu fragen.
Die Schwester antwortete in vollster Überzeugung: »Es ist eine läßliche Sünde.«
»Auch wenn man nicht daran denkt und es einfach so passiert?« fiel der Junge ein.
Ohne das leiseste Zögern gab die Schwester zurück: »Selbstverständlich.«
Digger fühlte sich auf der Stelle schuldig – das war etwas, was ihm sehr leichtfiel -, war jedoch zugleich verwirrt. Es leuchtete ihm ein, daß es eine Sünde war, wenn er »schmutzige« Gedanken im Zusammenhang mit den Mädchen in seiner Klasse hatte. Für seine Gedanken fühlte er sich verantwortlich. Doch manchmal geriet er aus dem Nichts heraus in Erregung; er dachte an gar nichts Bestimmtes, es passierte einfach.
In Gedanken begann er eine Berechnung für die Beichte aufzustellen. Mal sehen – ungefähr zwölfmal am Tag multipliziert mit den sieben Tagen der Woche; mal vier für den Monat. Er kam zu dem Ergebnis, daß er offenbar in ernsthaften Schwierigkeiten steckte. Nicht auszudenken, was für eine Strafe einen erst erwartete, wenn man selbst Hand anlegte! Im Flüsterton, doch laut genug, daß die Schwester ihn hören konnte, zischte Diggers Klassenkamerad: »Scheiße.«
Acht Jahre lang hatte im Umkreis von einer Meile um die Schule herum niemand ein solches Wort in den Mund genommen. Die Schwester kam auf der Stelle nach hinten und schlug dem Jungen so fest ins Gesicht, daß sie einen Abdruck 56hinterließ. Der Junge war wie betäubt. Die ganze Klasse war wie betäubt. Digger spürte den Schlag, als hätte die Nonne ihn getroffen. Er hatte genau dasselbe gedacht, hätte es aber nie ausgesprochen. Die Diskussionsstunde war offiziell vorüber – Strike Zwei.
Digger ließ in Gedanken all die Gelegenheiten an sich vorüberziehen, bei denen er für seine angeblich schlechte Spieltechnik auf dem Klavier auf die Fingerknöchel geschlagen worden war. Doch er überging all diese Züchtigungen als Schwinger und Fouls.
Zum letzten Pitch kam es, als er während seines zweiten College-Jahres zur Beichte ging. Er öffnete die Tür zum abgedunkelten Beichtstuhl und kniete nieder. Als er die Worte »Segne mich, Vater, denn ich habe gesündigt; seit meiner letzten Beichte sind zehn Monate vergangen« sprach, da unterbrach der Priester ihn auf der Stelle. Das Gesicht im Dunkeln hinter dem Schleier schickte sich an, ihm eine Lektion über die unangemessene Zeitspanne zwischen den Beichtgängen zu halten. Diggers erste Reaktion war Bestürzung. Er war stolz auf sich gewesen, weil er überhaupt zur Beichte gegangen war. Dann jedoch wurde er zornig. Er wollte dem Priester all das ins Gesicht schreien, was er an der Religion für falsch hielt: daß sein Dad nicht in den Himmel kommen könne; daß die Nonnen derart unrealistische Erwartungen an heranwachsende junge Männer stellten; daß Musik nur als formale Fertigkeit und nicht als Gefühlsausdruck gelehrt werde; daß man die Menschen mit Vorschriften, Verboten und Einschüchterungen erziehe, anstatt ihnen Liebe, Sinnerfüllung und Angenommensein zu vermitteln.
All das wollte er sagen – aber er tat es nicht. Während der Priester ihn noch mahnte, erhob er sich langsam von seinen Knien und ging hinaus, um – zumindest mit dem Herzen und dem Verstand – nie mehr zurückzukehren. Strike Drei.
57
»Los Angeles, Hauptbahnhof«, erscholl eine Stimme. »Endstation. Los Angeles, Endstation.«
Digger setzte sich mit einem Ruck auf und öffnete blinzelnd die Augen. Das Donnern eines vorüberrasenden Zuges erfüllte das Abteil. Die anderen Reisenden waren schon bereit zum Aussteigen. Der Schaffner ging den Gang entlang und brüllte noch einmal: »Nächster Halt Los Angeles.«
Digger rieb sich im Aufstehen die Augen und nahm seine Reisetasche aus der Gepäckablage. Mit Hilfe des Philosophiestudiums, das er auf dem College begonnen hatte, hatte er versucht, auf den Kern dessen zu stoßen, wonach, wie er glaubte, die Religionen möglicherweise suchten und wonach er suchen könnte. Aber da waren nie genug Worte, Ideen oder Konzepte, um die Leere in seinem Innern auszufüllen.
Digger schüttelte den Kopf und versuchte, sich wieder auf die Gegenwart zu konzentrieren. Los, Taylor. Nun bist du gleich da und hast noch keine Ahnung, wie Plan B aussehen soll. Es führt doch zu nichts, wenn du über den Grund deiner Leere nachgrübelst. Du glaubst doch nicht, daß du ein Vorspiel ohne eine Behelfsstrategie gewinnen kannst. Es wäre was anderes, wenn du noch zwei oder drei Vorspiele in petto hättest. Du mußt dir was einfallen lassen, wie du elegant und ohne viel Theater von einem zum anderen Satz überleitest. Du mußt alles geben, und trotzdem brauchst du einen Fluchtplan.
Der Lärm unterbrach seine Gedanken. Der Zug bremste, und das Getöse aufeinandertreffenden Stahls war ohrenbetäubend. Nebenan weinte ein Baby.
Großartig, dachte er. Schätze, ich muß Plan B in der Ruhe und Abgeschiedenheit der Luxuslimousine ausarbeiten, die Green herschickt. Gott sei Dank gibt es Sean Green.
Der Zug kam zum Stehen.
Ich hoffe bloß, daß der alte Green mich nicht verkohlt hat. 58Würde mir gar nicht gefallen, wenn ich die Warner Studios auf eigene Faust suchen gehen müßte. Das wäre dann ein richtiger Alptraum.
Die Reisetasche über der Schulter und den Koffer in der anderen Hand, trat Digger aus der Geborgenheit des Zuges und ging den Bahnsteig entlang ins Innere des Bahnhofs. Dabei musterte er die Gesichter der Leute, die zum Empfang der Reisenden gekommen waren. Man hatte ihm gesagt, er solle nach jemandem Ausschau halten, der ein großes Schild mit seinem Namen darauf trug. Während Digger mit der Menge die langen, breiten, hallenden Flure entlangging, wuchs seine Angst.
Er schaute zu einer Wanduhr hinauf. Bloß wenig mehr als drei Stunden noch bis zum Vorspiel, und ich trete hier immer noch auf der Stelle. Dabei weiß ich nicht mal, was ich tun soll, wenn ich dann da bin. Wär ich bloß nicht gekommen. Ich bin noch nicht reif für die Oberliga. Mich läßt doch keiner eine Filmmusik schreiben. Ich bin ein Niemand. Es gibt zigtausend erfahrene Komponisten und Songschreiber mit viel besseren Empfehlungen, als ich sie habe. Warum hab ich mich von Green da reinschwatzen lassen?
»Mister Taylor?« hörte Digger eine Frauenstimme irgendwo hinter sich rufen. »Mister Jonathan Taylor, wenn Sie mich hören können, heben Sie bitte die Hand«, ertönte die einschmeichelnde Stimme nun etwas lauter.
Digger folgte der Aufforderung.
»Ah, da sind Sie ja«, lächelte eine Rothaarige und löste sich aus dem Gedränge. »Also, ich bin Monica«, sagte sie und streckte ihm ihre weiß behandschuhte Hand entgegen. »Mister Green hat mich hergeschickt, um sicherzugehen, daß Sie rechtzeitig in die Warner Studios kommen. Lassen Sie mich die nehmen«, sagte sie und griff nach Diggers Reisetasche und seinem Koffer.
59
»Danke«, sagte er und reichte sie ihr. »Gehen Sie voraus.«
Sie schlängelte sich quer durch den überfüllten Bahnhof zu einem langgestreckten weißen Mercedes, der in der Ladezone parkte. Sie hatte mittlerweile einen so großen Vorsprung, daß er erst einmal warten mußte, bis eine ganze Reihe Taxis mit neuen Fahrgästen in fliegendem Start ihren Standplatz verlassen hatten und an ihm vorübergejagt waren. Als er die Fahrbahn überqueren wollte, durchfuhr ihn ein Gefühl von Panik, das er nur zu gut kannte:
Wie soll ich einem herannahenden Fahrzeug ausweichen? Ich muß vorsichtig sein und die Augen offen halten. Ich kann nicht bloß darauf hoffen, daß schon alles gut ausgehen wird.
Jedesmal, wenn er bei dichtem Verkehr eine Straße überqueren mußte, kamen Digger diese Gedanken. Blitzartig verschärften sich dann sein Wahrnehmungsvermögen und seine Vorsicht. Diese Empfindung hatte ihn immer verwirrt: Er war noch nie angefahren worden und kannte auch niemanden, dem das zugestoßen war – er hatte keinen Grund zur Furcht.
Er runzelte die Stirn, als er nun auf die stehende weiße Limousine zutrabte. Immer wenn er seinen Beinen Bewegung verschaffte, hatte er ein gutes Gefühl. Vielleicht würde ihm Jogging zur richtigen Gemütsverfassung verhelfen. Das sollte er tun, wenn er erst einmal bei den Warner Studios angekommen war: einen Platz zum Joggen suchen, wenn die Zeit reichte.
Monica hielt ihm die hintere Tür der Limousine auf. »Alles in Ordnung, Mister Taylor?«
Digger nickte und glitt auf das glänzend braune Lederpolster, das die Rückbank bedeckte. Monica nahm auf dem Fahrersitz Platz, ließ den Motor an und schloß elektronisch die Einwegscheibe hinter ihrem Sitz. Ein Telefon unter seiner Armlehne summte.
60
Digger nahm ab, ohne so recht zu wissen, was ihn erwartete. »Hallo?«
»Möchten Sie irgendwo anhalten?« säuselte Monica.
»Nein, danke«, antwortete er ein wenig entspannter. »Fahren Sie mich direkt zu den Warner Studios – so schnell Sie können, ohne dafür ein Strafmandat zu kriegen. Mir wär's lieb, wenn wir möglichst bald aus dem Verkehr rauskämen.« Er zögerte. »Ach ja. Ich werde versuchen ein kleines Nickerchen zu machen. Deshalb wäre ich Ihnen danbar, wenn Sie dafür sorgten, daß ich nicht gestört werde.«
»Aber selbstverständlich«, flötete sie.
Digger schaltete das Telefon aus, ehe er es wieder einhing. Jetzt konnte er ernsthaft meditieren. Als sein Finger gebrochen war, hatte er weder Softball noch Klavier spielen können und hatte daher viel Zeit gehabt, sich der Meditation zu widmen. Damit hatte er erst begonnen, als er nach Kalifornien gekommen war – doch meist schob er es so lange hinaus, bis er wirklich völlig überanstrengt war. Vielleicht lernte er eines Tages zu meditieren, ehe der Streß unerträglich wurde.
Digger schlüpfte aus seinen Turnschuhen, lehnte sich entspannt zurück und nahm eine bequeme Haltung auf dem Rücksitz ein. Er hatte das Gefühl, Schultern und Ohren seien miteinander verwachsen. Er schloß die Augen und konzentrierte sich aufs Atmen. Das war das Entscheidende: sich in das Atmen zu versenken – nichts anderes spielte mehr eine Rolle. Wenige Augenblicke später wurde sein Atem langsamer, sein Körper entspannte sich mit jedem Atemzug.
Sobald er entspannt war, überkam ihn eine Schläfrigkeit – und das Gefühl, daß irgend etwas nicht stimmte. Eine so starke Empfindung hatte er seit Florida nicht mehr gehabt. Sie erinnerte ihn an seine Vorahnungen in Key West, als die negative Energie – besonders gegen Ende – so außerordentlich 61stark geworden war. Er hatte seit einiger Zeit gewußt, daß bald alles aus sein würde, doch er war zu feige, Judy oder sich selbst gegenüber aufrichtig zu sein.
Digger war siebenundzwanzig, als er von Chicago nach Key West ging. Zwei Wochen waren seit dem beinahe tödlichen Wochenende vergangen. Er brauchte Zeit, um über sein Leben nachzudenken. Der Ausflug nach Florida versprach ein hübscher, kleiner Urlaub von ungefähr einem Monat zu werden. Dann würde er nach San Diego ziehen, um sein Leben neu zu beginnen. Digger hatte sich von dieser Stadt schon immer angezogen gefühlt, obwohl er noch nie dort gewesen war. Er war ganz – oder doch beinahe – sicher, daß dies der Ort war, an den er gehörte. Doch seine Ferien in Key West dauerten fast sechs Jahre. Gleich nach seiner Ankunft fuhr er mit demselben Boot zum Fischen, das sein Dad und er viele Jahre zuvor gemietet hatten. Der Kapitän erwähnte, daß er einen neuen Mann für die Besatzung des zehn Meter langen Fischerbootes brauche, und in einer für ihn ungewohnten Anwandlung von Spontanität bat Digger ihn um den Job. Er bekam ihn. Zumindest unterschied sich diese Arbeit erheblich von seinem alten Job als Sozialarbeiter, sagte er sich. Außerdem tat ihm die Veränderung gut. Wenn er morgens beim Aufstehen den salzigen Geruch der frischen Meeresbrise schmeckte und das Rauschen der Brandung hörte, fühlte er sich gestärkt.
Dann traf er Judy. Sie stand Tag für Tag an den Gulf Oil Docks, wenn sein Boot zum Auftanken kam. Digger hatte vorher nie einen »Aussie« kennengelernt und war begeistert von ihrer Sprache. Es war fast, als entlockte sie den bloßen Worten eine Musik, deren Zauber ihn verführte. Sie war von Kopf bis Fuß eine attraktive Frau, nur ein paar Jahre älter als er. Trotz ihrer Größe – um die einsfünfundsiebzig – bewegte 62sie sich wie eine Katze. Judy eröffnete ihm den Zugang zu gepflegteren kulinarischen Genüssen. Sie war nicht nur eine ausgezeichnete Köchin; sie machte darüber hinaus das ungewöhnlichste Essen zu einem sinnlichen Erlebnis.
Wenn er jetzt daran zurückdachte, wurde ihm klar, daß diese sinnliche Komponente sein klares Urteilsvermögen beeinträchtigt haben mußte. Es endete damit, daß er mit Judy ein Restaurant eröffnete. Damals schien es einfach, als habe alles so kommen müssen. Das jedenfalls sagte ihm sein Gefühl. Als sie den Plan ausheckten, vereinbarten sie, daß er in ihre Wohnung ziehen solle.
Doch kaum hatten sie den ›Känguruhbeutel‹ – mit »den besten Meeresfrüchten vom anderen Ende der Welt« – auf einem umgebauten Hausboot eröffnet, da änderten sich plötzlich alle Vorzeichen. Es war, als habe ein Entscheidungsträger im Planetensystem einen gewaltigen Stromschalter mit der Aufschrift »Zweikampf« betätigt. Am Ende wurde das ganze Abenteuer in Florida zum Alptraum. Seine Beziehung zu Judy durchlief mehrere Waschgänge – an, aus, heiß, kalt und zahlreiche Spülungen. Er hatte den alten Grundsatz vergessen: »Mach nie Geschäfte mit Freunden oder Geliebten.«
Genau wie in Chicago wußte Digger, daß er dieses Abenteuer hätte beenden müssen, bevor ihm der Schluß aufgezwungen wurde. Im Laufe des letzten Jahres wurde das Gefühl der Leere am stärksten. Doch wie üblich harrte er dennoch aus. Er konnte nicht fortgehen, denn dann hätte er zugleich sein Geschäft, seine Freunde und den Sport aufgeben müssen. Wer aber war er ohne diese Menschen und Aktivitäten?
Er erinnerte sich an einen besonders schmerzlichen Tag in Key West. Er hatte auf der Couch geschlafen und die Wohnung bei Tagesanbruch verlassen. Judy hatte schon etwa drei 63Jahre zuvor das Interesse am Sex verloren. Damals war er zu dem Schluß gekommen, daß sich die Dinge von allein wieder einrenken würden, wenn sie beide sich erst an die neue Routine gewöhnt hätten. Er irrte sich. Sie wollte nicht nur nicht mit ihm schlafen; manchmal wachte er mitten in der Nacht auf, weil sie, die tief und fest schlief, ihn mit Füßen trat. So landete er dann in jener Nacht auf der Couch.
Es war noch früh am Morgen, als er mit Bauplänen in der Hand im ›Känguruhbeutel‹ auftauchte. Judy war schon dort. Wie üblich war sie in der Küche beim Reinigen. Er versuchte, ihr eine neue Idee zu erklären, mit der er den Umsatz steigern wollte. Er hatte einen Freund gebeten, einen Grundriß mit einer leicht veränderten Ausstattung zu zeichnen.
Sie sagte kein Wort – putzte nur und schüttelte verneinend den Kopf.
»Verstehst du denn nicht?« flehte Digger. »Wir können das hier nur schaffen, wenn wir zwei- oder dreimal pro Essenszeit neue Gedecke auflegen«, sagte er und durchschritt das Unterdeck des zweistöckigen Hausbootes. In einer Hand hielt er den aufgerollten Bauplan, in der anderen ein Maßband. »So wird's gehen, Schatz. Willst du es dir nicht wenigstens mal anschauen?«
»Ich glaube kaum, Junge«, sagte sie blaß und mit zusammengekniffenen Lippen, während sie einen Blick in den schmutzigen Backofen warf. »Ich kenne doch deinen Plan: neue Ausstattung, schnellerer Wechsel, Wärmebüffets, Essen ohne Nährwert, den Kunden das Geld aus der Tasche ziehen und die verdutzten Gäste aufs Kreuz legen.«
»Die Gäste aufs Kreuz legen? Und was, glaubst du, machen wir jetzt? Verdammt noch mal, wir sind froh, wenn wir's schaffen, sie in einer beschissenen Stunde abzufüttern!«
»Du Scheißkerl!« schrie sie und warf eine Abwaschbürste nach ihm.
64
Er duckte sich, und die Bürste schlitterte über den Fußboden.
Judy brach in Tränen aus. »Wenn du glaubst, du kannst es besser, dann stell dich doch hierher und versuch mal, ob du schneller kochen kannst.
Er ging hin und hob die Bürste auf. Dann setzte er sich an einen der Tische und seufzte.
»Dieser Plan ist kein Kommentar zu deinen Kochkünsten, Judy«, sagte er schließlich freundlich. »Wir wissen beide, daß niemand das besser kann als du. Doch aufgrund unserer Unerfahrenheit haben wir dieses Lokal so eingerichtet, daß wir scheitern müssen. Gutes Essen ist eine Sache, aber dies ist ein Geschäft. Es kommt darauf an, Gewinne zu machen, und wir haben uns in die Scheiße geritten. Verdammt noch mal – gestern haben wir die Versicherungspolice für das Boot gekündigt, weil wir die Lieferanten bezahlen mußten!«
»Und was ist mit ›Den besten Meeresfrüchten vom anderen Ende der Welt‹? Ist das etwa nichts? Wie können sie die besten sein, wenn sie geradewegs von irgendwelchen bescheuerten Yankee-Heizplatten kommen?«
»Wir können Geld verdienen und trotzdem die besten Meeresfrüchte servieren. Wir brauchen dazu bloß einen Plan.« Er hob die Zeichnung auf. »Die Jungens im Gastronomieservice drüben würden uns die Einrichtung sogar im Tausch gegen freie Verpflegung überlassen. Willst du ihn dir nicht einfach mal anschauen?«
Sie fing wieder an zu schrubben und antwortete ihm nicht.
Digger kochte vor Wut. Der ihm mittlerweile wohlbekannte Schmerz im Magen wurde schnell stärker. Er nahm sein Meterband und warf die Tür hinter sich zu.
Judy tobte. »Und sieh zu, wie du deinen eigenen stinkigen Fraß los wirst, Kumpel. Ich hoffe, die Hölle friert zu, ehe ich deine verschlagene Yankee-Visage wieder zu sehen kriege!«
65
An jenem Tag zog Digger aus. Wenige Tage danach gab ihm Judy Bescheid, daß sie einverstanden sei, wenn er das Restaurant verkaufen wolle. Er hätte es besser wissen müssen.
Vierundzwanzig Stunden nachdem er die Anzeige aufgegeben hatte, meldete sich ein geeigneter Käufer für das Restaurant und machte ein gutes Angebot. Als Digger Judy anrief, um es ihr zu sagen, war er außer sich vor Erregung. Vielleicht würde alles am Ende doch noch gut. Vielleicht würden all der Kummer und all die harte Arbeit schließlich doch noch Früchte tragen. Er mußte das Telefon nur zweimal klingeln lassen.
»Wer ist da, bitte?« sagte sie in ihrem schnellen, näselnden Australisch.
»Ich bin's, Judy«, sagte er.
»Oh, hallo, Kumpel. Was gibt's?«
»Wir haben einen Käufer, Judy. Stell dir das vor! Wir haben wahr und wahrhaftig einen Käufer, der das Geld bar auf der Hand hat.«
»Wieviel?«
»Sechsundsiebzig. Aber in bar. Und er ist bereit, gleich morgen abzuschließen, oder wann immer wir wollen.«
Stille.
»Das entspricht nicht unserer Vereinbarung«, sagte sie kalt. »Wir hatten vereinbart, für einhunderttausend Dollar zu verkaufen.«
»Ich weiß, Judy, aber er zahlt in bar. Sonst zieht sich so was jahrelang hin, und man muß sein Geld vor Gericht einklagen, und man hat nur 'n Haufen Ärger. Das hier ist bares Geld. Ohne jedes Wenn und Aber.«
Sie räusperte sich. »Jetzt hör mir mal zu, Mister Taylor«, sagte sie, und ihre Stimme wurde lauter. »Ich kann deinen blöden Yankee-Bockmist einfach nicht mehr hören. Ich habe 66hunderttausend gesagt, und genauso hab ich's auch gemeint. Keinen Dollar weniger. Hab ich mich klar genug ausgedrückt, Kumpel?« schrie sie ihn nun an.
Digger kochte vor Wut. »Klar ist, daß du nie die Absicht hattest, zu verkaufen.« Er schmiß den Hörer hin.
Danach begann das bedrohliche Gefühl erst richtig sein scheußliches Haupt zu erheben. Er arbeitete den ganzen Tag auf dem Boot und kam abends todmüde nach Hause. Wenn er dann geduscht und gegessen hatte, hielt ihn eine starke negative Energie so lange gefangen, bis er an die Garrison Bucht hinunter ging, um zu überprüfen, ob mit dem ›Känguruhbeutel‹ alles in Ordnung war.
Da stand er dann und verbarg sich in der Dunkelheit. Er wollte unter keinen Umständen gesehen werden, mußte sich jedoch vergewissern, daß im Restaurant alles mit rechten Dingen zuging. Er kontrollierte die Vertäuung und lauschte auf mögliche Unmutsäußerungen der Gäste. Nach den Geräuschen zu urteilen, die er hörte, schien alles gutzugehen. Doch Diggers Empfindung, daß irgend etwas nicht stimmte, wurde nicht schwächer, sondern im Gegenteil noch stärker.
Wenige Nächte später zog er nach Restaurant-Schluß seine Taucherausrüstung an und schlüpfte unbemerkt in das warme Wasser des Golfs. Mit einer geliehenen Unterwasserlampe inspizierte er die Unterseite des Hausbootes. Während er nach schadhaften Stellen suchte, glaubte er den Schatten eines Mannes am hölzernen Steg stehen zu sehen.
Alles schien völlig in Ordnung zu sein. Natürlich wuchsen am Kiel ein paar Muscheln und Algen, doch es gab keinen Grund zur Beunruhigung – nichts Außergewöhnliches oder für die Sicherheit des Bootes Bedrohliches.
Als er sich auf den Steg hinaufzog, schaute er sich nach der Schattengestalt um, sah jedoch niemanden. Er zog Flossen und Maske aus. Eine leise vertraute Melodie wehte durch 67die warme Nachtluft. Es bereitete ihm Mühe, genau hinzuhören, denn seine Ohren waren noch voller Wasser. Doch klang es wie eine bekannte irische Ballade.
Digger ging in seine Wohnung zurück, doch es dauerte lange, bis er schlafengehen konnte. Ein Sturm zog auf, und die raschelnden Palmwedel schienen die Worte der Ballade nachzuwispern: »Bist du's nicht müde, vor dem Teufel zu flieh'n? Du weißt doch, er gleicht dir und mir aufs Haar.«
Als er erwachte, war das Gefühl noch bedrohlicher geworden. Ihm schien es, als sei er eben erst eingeschlafen. Er hörte nichts als den Regen, der gegen die Fenster, das Dach und die Außenmauern des Appartements prasselte, das er vor kurzem gemietet hatte. Der Lärm war so gewaltig, daß er ihn an die Hagelschauer in Chicago erinnerte. Doch nun heulte und sauste der Wind wie ein zorniges, in die Enge getriebenes Tier, das entfliehen wollte und dabei einmal in diese, einmal in die andere Richtung stürmte. Es wollte nicht ablassen. Seine Angriffe wurden mit jedem neuen Brüllen wütender und kraftvoller. Diggers Appartement knarrte und ächzte, während der Regen in Strömen auf das Haus niederklatschte.
Der ›Känguruhbeutel‹!
Digger schrak hoch und schaute nach draußen auf den Atlantic Boulevard. Ein Großteil der Straßenbeleuchtung funktionierte noch. Durch die Windböen hindurch konnte er die Schatten der Palmen sehen, die sich wie riesengroße Getreidehalme bogen und schaukelten. Einige waren schon umgeknickt und zu Boden gefallen. Zerbrochene Äste und Gartenstühle, Trümmer aller Art lagen auf Straßen und Höfen herum. Es war der schlimmste nächtliche Sturm, den er in Key West je erlebt hatte. Er schätzte, daß der Wind eine Geschwindigkeit von achtzig bis hundert Kilometern pro Stunde hatte.
68
Obwohl er wußte, wie gefährlich das war, mußte er irgendwie zum Restaurant. Er konnte nicht einfach hierbleiben und nichts unternehmen, während alles, wofür er und Judy Tag und Nacht geschuftet hatten, in Gefahr war. Das also war der Grund für seine negativen Empfindungen. Er mußte ans Wasser. Digger warf sich ein paar alte Sachen und einen Regenparka über. Er war sich nicht sicher, ob sein VW Käfer bei diesem Unwetter fahren würde. Nach einigen Versuchen sprang der Motor endlich an.
Ganz langsam kämpfte sich Digger zur Garrison Bucht durch. Wasser floß in Strömen über die Straßen, die übersät waren mit Palmblättern, Ästen, Zeitungen, umgekippten Mülltonnen und Fröschen. Der Sturm fegte auf seinem Weg alles hinweg. Der Ozean würde sehr schnell all diese Trümmer für sich beanspruchen. Er betete, daß es keine Überschwemmungen geben möge. Solange das Wasser nicht höher als dreißig Zentimeter auf der Straße stand, würde es gehen. Ein Abschleppwagen zischte vorüber und begrub ihn unter einem Schwall von Wasser. Doch der VW pflügte sich weiter voran. Im Grunde fühlte sich Digger trotz des Sturmes und der überfluteten Straßen auf irgendeine seltsame Weise durch den Regen wie gereinigt.
Schließlich erreichten Digger und der VW den Parkplatz neben der windgepeitschten Bucht. Er fuhr so nah wie möglich an die Helligen heran und richtete die oberen Scheinwerfer auf die tänzelnden und hüpfenden Boote. Es war zu dunkel. Er konnte den ›Känguruhbeutel‹ nicht erkennen. Er ergriff eine Taschenlampe und rannte den schwankenden hölzernen Anleger hinunter. Dabei leuchtete er durch den Regen in die Richtung, wo sein Hausboot hätte liegen sollen. Das Restaurant mußte da sein, sagte er sich. Es hatte schon schlimmere Stürme als diesen überstanden. Seine Augen spielten ihm wohl bei diesem Wind einen Streich.
69
Nein, daran lag es nicht. Es war nicht da. Alles, was er fand, waren im Wasser treibende Lebensmittel, Abfall, Tische, Stühle. Auf den Wellen tanzte ein Schild: »Die besten Meeresfrüchte vom anderen Ende der Welt«. Zerrissene Ankertaue trieben nutzlos auf dem wogenden, schmutzigen Wasser. Der ›Känguruhbeutel‹ hatte seine letzte Mahlzeit serviert.
Plötzlich spürte er einen Brechreiz: die gekündigte Versicherung; der Verkauf, der nie stattgefunden hatte; all die Arbeit; all die Stunden ohne Schlaf; all die Zeit, die er und Judy nicht einfach wie zu Beginn ihrer Bekanntschaft entspannt miteinander hatten genießen können; all die Zeit, in der er nicht hatte tun können, wozu er Lust gehabt hätte – Klavierspielen und Komponieren zum Beispiel; all die Plackerei für die Renovierung, die Fertigstellung, die Reinigung und Planung; all jene tausende und abertausende von Stunden kostbarer Zeit; all das hart erarbeitete Geld, das sie beide hineingesteckt hatten … verloren, für immer verloren. Und wofür das alles?
Diggers Haut wurde kalt und feucht, als sein Magen sich zusammenkrampfte. In einem einzigen kurzen, unwillkürlichen Augenblick ergoß sich alles, was in ihm gewesen war, ins weißschäumende Wasser.
»Mister Taylor?«
Digger spürte, wie jemand ihn an der Schulter packte.
»Mister Taylor, wir sind da.«
Er schoß von seinem Sitz empor. Die Sonne schien hell, und er saß auf dem Rücksitz der Mercedes-Limousine. Monica stand über ihn gebeugt.
»Heil und gesund«, lächelte sie und klimperte mit braunen Kinderaugen. »Warner Studios, Musikbühne Nummer vierundzwanzig, genau wie Mister Green gesagt hat.«
70
»Dein Wissen wird bald deine
Träume übersteigen«
»Mein Name ist Taylor«, sagte Digger zu dem majestätisch aussehenden Mann hinter der hohen, metallenen Sicherheitsschleuse. Er trug eine graue Uniform mit Goldtressen und ein Namensschild mit der Aufschrift: Al White. Direkt hinter ihm führte eine Eisentreppe mit Geländer ins nächste Stockwerk zu einer Stahltür. Neben dieser Tür stand in großen braunen Lettern »Tonstudio 24« auf der weißgekalkten Mauerwand.
»Man erwartet mich um sechs Uhr zu einem Vorspiel von Mr. Michaelson«, fuhr Digger fort.
Der hochgewachsene Sicherheitsposten, dessen silbergraue Haare tadellos geschnitten und dessen Fingernägel manikürt waren, schob ein Walkie-talkie zur Seite und überprüfte eine Namensliste auf seinem Klemmbrett. »Ah ja, Mr. Taylor«, sagte White. »Sie stehen auf meiner Liste. Aber Sie kommen ein bißchen zu früh.«
»Entschuldigen Sie«, sagte Digger, während er seinen Koffer absetzte und seine Reisetasche zurechtrückte. »Ich habe den erstbesten Zug von San Diego genommen und bin direkt hierhergekommen. Kann ich vielleicht hier irgendwo warten, falls Sie mich jetzt noch nicht einlassen können?«
White nickte. »Denke, das geht schon in Ordnung. Kommen 71Sie, ich zeige Ihnen Ihre Garderobe.« Der Sicherheitsbeamte steckte sich das Walkie-talkie an und ging ihm voran die Treppe hinauf.
Digger folgte ihm und ließ den Blick über das Gelände der Warner Studios schweifen, während er die Stufen erklomm. Auf der einen Seite des zweigeschossigen Studios war eine Straße errichtet, auf der »Serpico« oder »West Side Story« gedreht worden sein mochten. Auf der anderen Seite erstreckte sich eine Western-Kulisse, in der vielleicht die Außenaufnahmen für Szenen aus »High Noon« oder »Pale Rider« entstanden waren. In der Ferne sah er langgestreckte zwei- und dreistöckige Gebilde aus Backstein, die aussahen, als hätten sie immer wieder neue Anbauten erhalten. Die Gebäude waren durch Asphaltstraßen, Parkplätze und Gehsteige miteinander verbunden. Die Menschen bewegten sich – ob mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß, geradeso, als befänden sie sich auf dem Gelände irgendeines Großunternehmens. Sie schienen das Filmemachen nur als angenehme Routine zu betrachten.
Für Digger war sein Aufenthalt auf dem Filmgelände keinesweg Routine. Sein Herz klopfte, und es fiel ihm schwer zu atmen. Das anhaltende und stetig wachsende Gefühl, daß irgend jemand ihn bedrohte, ließ ihn nicht los; und dennoch kämpften seine Sinne mit der Erregung des Augenblicks. Er würde seine eigene Musik vorspielen; jemand wollte tatsächlich hören, was er geschrieben hatte.
Der Wachmann öffnete die Tür am Ende der Treppe und sagte: »Folgen Sie mir bitte.« Sie gingen einen langen Flur entlang, der in ein Dutzend Stufen mündete, die zu einer weiteren verschlossenen Tür führten. Die beiden Männer erklommen die Stufen. Auf einmal befanden sie sich im Innern eines luxuriösen Theaters mit abfallenden Reihen äußerst geräumiger Zuschauerplätze, dicken Teppichen und 72teurer Beleuchtung. Ganz oben an der rückwärtigen Wand sah Digger einen Projektions- und Beleuchtungsraum mit den üblichen Armaturen und Scheinwerfern, die auf die niedrige Bühne im Vordergrund gerichtet waren. In der Mitte der Bühne standen ein schwarzer Steinway und ein Toshiba Synthesizer nebeneinander vor einem roten Vorhang.
»Hier werden Sie vorspielen«, sagte der Wachmann und zeigte auf die Bühne, während sie hinten durch das Theater gingen. »Die Garderoben sind dort.« Er wies auf eine Tür an der gegenüberliegenden Seite gegen die Rückwand des Raumes hin.
Digger folgte ihm. »Wie ist die Akustik hier drin?« fragte er, während er seine Reisetasche ordnete.
»Hervorragend«, sagte der Wachmann. »Aber Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die geben nicht so viel darauf, wie Sie heute abend hier spielen. Die zeichnen das auf Band und Video auf. Später, wenn alles vorbei ist, kommen Mr. Michaelson und seine Crew dann wieder her und hören sich an, was Sie und die anderen hier stundenlang gespielt haben.«
Digger fühlte seine Kehle trocken werden. Stundenlang?
Der Wachmann öffnete die Tür zu den Garderoben und führte ihn einen weiteren langen, mit Teppichen ausgelegten Flur entlang. Sie gingen an mehreren Türen vorbei. »Ihre Garderobe ist genau geradeaus. Ihre Konkurrenten werden eine er anderen hier benutzen, aber Ihnen geben ich die beste, weil Sie zuerst hier waren und den weitesten Weg hatten. Sie ist schalldicht und hat ein eigenes Klavier und eine eigene Dusche. Sie hat sogar einen Kühlschrank und eine Bar – beide gut gefüllt.«
»Du liebe Zeit«, sagte Digger. »Vielen Dank. Ich hoffe, das bringt Sie nicht in irgendwelche Schwierigkeiten.«
»Ach wo«, sagte der Wachmann. »Keine große Sache – 73das kommt jeden Tag vor. Mr. Michaelson macht das immer so. Fast alle Schlüsselpositionen und Hauptrollen werden nach einer Anhörung auf der Bühne besetzt. Soweit ich weiß, macht das sonst keiner so, aber gegen den Erfolg kann man schlecht anstänkern. Die jungen Spunde, die in der Chefetage das Sagen haben, sind wenigstens gescheit genug, ihn machen zu lassen, was er will.«
White blieb stehen und streckte den Finger aus. »Sehen Sie die Tür am Ende des Ganges? Das ist der Bühneneingang, durch den Sie gehen, wenn Sie an der Reihe sind.«
Digger nickte.
White öffnete die Tür, neben der sie gestanden hatten. »Und dies ist Ihre Garderobe.«
Der Besucher aus San Diego trat ein. Der Geruch neuer Teppiche und Gardinen und frischer Farbe schlug ihm entgegen. Die Wände waren mit gebeiztem Eschenholz getäfelt. Eine Unterbrechung bildeten lediglich die hohen Spiegel rund um die Garderobe. Wandschränke und ein geräumiges Bad rundeten das Bild ab. An der angrenzenden Wand stand ein glänzender Flügel im Kleinformat. Samtcouches und Clubsessel waren für intime Gespräche um Kaffeetische aus Hartholz gruppiert. Frische Blumen und Topfpflanzen hatte man strategisch verteilt. Gegenüber dem Garderobenplatz wurde eine gutgefüllte Bar von einer überquellenden Schale reifer Früchte gekrönt.
Digger stieß einen Pfiff aus. »Mann, Sie haben mich also nicht verkohlt«, sagte er kopfschüttelnd, während er im Zimmer umherging. Er warf einen Blick ins Badezimmer und öffnete die Toilettentür. »Sehen Sie sich das bloß an. Eine Garderobe wie diese habe ich noch nie gesehen.«
»Sie waren also schon beim Film, Mr. Taylor?«
»Nein, bloß ein bißchen Amateurtheater in Florida und Chicago. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die 74meisten Garderoben, die ich kenne, sind kleiner als 'ne Briefmarke.« Er griff in seine Hosentasche. »Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, Mr. White. Das ist toll.«
Der Wachmann mit dem Silberhaar hob abwehrend die Hand. »Nein, danke. Ich darf kein Geld annehmen. Aber ich danke Ihnen für Ihre freundlichen Worte. Die meisten Leute, die hierher kommen, scheinen das als selbstverständlich anzusehen. Wenn Sie sich wohl fühlen, ist mir das Dank genug.«
»Das tue ich. Ich kann Ihnen nicht genug danken.«
White grinste. Dann ließ er Digger allein.
Digger hängte seine Reisetasche auf und duschte sich schnell. Dann schlüpfte er in ein paar Shorts und ein Polohemd. Es war noch zu früh, den Smoking anzuziehen.
Es ist Zeit, an der Musik zu arbeiten, Taylor. Deshalb bist du ja hier, erinnerst du dich? Du kannst den Augenblick der Wahrheit nicht ewig hinausschieben. Es muß einen Weg geben, vom ersten zum zweiten Satz überzuleiten, ob mit oder ohne deinen Freund, den kleinen Finger.
Er setzte sich ans Klavier und dachte an all die Jahre, die er gebraucht hatte, um sich wieder ins Spielen und Komponieren hineinzufinden. Nach den Ferien mit seinem Dad in Key West hatte er die Musik ganz aus seinem Leben verbannt.
Als sein Vater wenige Monate später starb, wusch Diggers Schuld die Noten aus seinem Kopf unddie Musik aus seinem Herzen. Vor drei Jahren hatte er damit begonnen, dieses »Konzert, das der Zuhörer harrte«, zu komponieren.
Er seufzte und versuchte, sich auf die erfreulichere Sicht der Dinge zu konzentrieren. »Schau doch, wie weit ich's gebracht habe«, sagte er, an das leere Zimmer gewandt.
Er starrte hinauf auf die achtundzwanzig Tasten. Warum fing er jetzt nicht einfach mit dem zweiten Satz an? Seine Gedanken schweiften zurück zum letzten Thanksgiving, das er mit seiner Mutter im Süden Chicagos verbracht hatte.
75
»Digger arbeitet an einer neuen Symphonie«, hatte sie ihren Freundinnen verkündet. »Sie sollten sie einmal hören, meine Damen«, sagte sie, während sie sich setzte, um an ihrem Chablis rosé zu nippen. »Es klingt wie Bach oder so etwas.«
Er war tiefrot geworden. Er wollte sie nicht in Gegenwart ihrer Freundinnen in Verlegenheit bringen, aber er hatte die übertriebenen Kommentare seiner Mutter zu seinem Klavierspiel satt.
»Ach, wir würden Ihrer Symphonie zu gerne hören«, sagte eine der Frauen. »Uns ist es gleich, ob sie fertig ist oder nicht. Spielen Sie uns doch wenigstens ein Stückchen daraus vor.« Er lächelte freundlich. »Das ist sehr lieb von Ihnen«, sagte er, aber ich fürchte, ich kann es nicht. Das Werk ist noch unvollständig.«
»Oh-h-h-h-h wie schade«, sagte seine Mutter und tupfte sich die Augen. »Wahrscheinlich ist dies das einzige Mal, daß ich die Gelegenheit hätte, mit anzuhören, wie mein eigener Sohn mir seine Symphonie persönlich vorspielt.«
Digger holte noch einmal tief Atem. »Mutter, wenn du schon versuchst, mich zum Vorspielen zu verleiten, dann kannst du das Stück wenigstens bei seinem richtigen Namen nennen. Es ist ein Klavierkonzert, keine Symphonie.«
»Symphonie, Konzert – das ist doch alles eins. Was soll das Theater? Ich geb nichts darauf, wie man es nennt. Ich will es dich nur spielen hören.«
Mit angehaltenem Atem stand er auf und schritt langsam zum Klavier hinüber. Niemand sagte ein Wort. Er setzte sich und begann zu spielen. Durch einen kraftvollen Akt des Willens war er in der Lage, den Zorn, den er in diesem Moment über seine Mutter empfand, zu vergessen und sich auf sein Spiel zu konzentrieren. Damals kam es plötzlich über ihn: eröffne den zweiten Satz mezzo forte und staccato, entwickle 76zu forte und ritardando und beschließe mit legato und adagio. Er schrieb das Stück beim Spielen neu, und diese neue Spielweise veränderte es von Grund auf. Das ganze Konzert erwachte zu neuem Leben. Die Frauen klatschten und jubelten ihm zu. »Bravo!« riefen sie, »Bravo! Da Capo!«
Diggers Mutter verschüttete beinahe ihren Chablis, als sie zu ihm eilte, um ihn auf die Wange zu küssen. »Das war wunderbar, Jonathan«, säuselte sie, »einfach wunderbar.« Sie küßte ihn noch einmal. »Ich bin so stolz auf dich.«
Jetzt, als er in der Garderobe der Warner Studios saß, flogen Diggers Finger über die Tasten. Er war sich kaum noch bewußt, wo er sich befand. Er sah nur das Gesicht seiner Mutter und hörte nur ihre Worte: »Ich bin so stolz auf dich.«
Ein lautes Klopfen an der Tür unterbrach seine Träumerei.
Erschreckt hörte Digger auf zu spielen und daß unbeweglich da. Er schüttelte den Kopf und versuchte, sich zurechtzufinden. »Wer ist da?«
»Eine Nachricht für Mr. Taylor.«
Digger öffnete die Tür. Ein Bühnenarbeiter überreichte ihm einen Brief. Er riß den von Hand beschrifteten Umschlag auf. Die Nachricht darin lautete:
Lieber Mr. Taylor,
vielen Dank, daß Sie auf meine doch sehr kurzfristige Benachrichtigung hin gekommen sind. Ich weiß, daß das, was ich Ihnen zumute (selbst für Hollywood-Maßstäbe) in höchstem Grade sowohl unüblich als auch nervenaufreibend ist. Bitte vergeben Sie mir dennoch: Die Erfahrung zeigt, daß mein unorthodoxes Auswahlverfahren zu positiven Ergebnissen führt.
Danke und viel Glück,
Philip Michaelson
77
P.S. Meine Mitarbeiter haben für alle Teilnehmer das Los gezogen; Ihnen ist der letzte Platz zugefallen. Ihr Vorspiel wird ungefähr um 19.30 stattfinden. Ich schicke jemanden, der Ihnen 15 Minuten vorher Bescheid gibt.
Digger sah auf die Uhr: siebzehn Uhr fünfundvierzig. Keine zwei Stunden mehr bis zu seinem Vorspiel, und er hatte den Übergang zwischen erstem und zweitem Satz noch immer nicht gefunden. Wahrscheinlich würde er mit der sicheren, aber biederen Überleitung antreten, die er heute morgen in seinem Häuschen gespielt hatte.
Jeder Muskel in seinem Körper war angespannt. Plötzlich fühlte er, wie ihn die Erschöpfung übermannte. So ähnlich mußte sich ein Marathonläufer fühlen, wenn er »gegen die Wand« rannte. Mein Gott, ich hab den ganzen Tag nicht richtig geschlafen; immer nur kurz gedöst. Er zog die Turnschuhe aus, fand im Wandschrank eine Decke und streckte sich auf der Couch aus.
Ein kurzer Schlaf wird mir guttun – meine Energie und meine Konzentration auffrischen, dachte er. Dieses Untergangs-Gefühl hat mich richtig ausgelaugt, und es scheint noch schlimmer zu werden. Ich brauche Schlaf. War es nicht Vince Lombardi, der gesagt hat, Müdigkeit mache Feiglinge aus uns allen? Wahrscheinlich habe ich deshalb das Gefühl, daß in meinem Leben alles den Bach runtergeht. Ich muß mich einen Augenblick entspannen – bloß ein paar Minuten -, dann bin ich gegen alles gewappnet.
Digger holte tief Atem und schloß die Augen. Er bediente sich seiner vielgeübten Muskel-Entspannungstechnik, wobei er mit den Füßen anfing und langsam bis zum Kopf vordrang. Als er spürte, wie sich all seine Muskeln entspannten, gab er sich ganz seiner Atmung hin.
Meditation. Das wäre jetzt das Richtige: Meditieren. Konzentrier 78dich aufs Atmen. Einatmen … Ausatmen … Er versenkte sich weiter in seine Atmung. Seltsamerweise fiel es ihm leichter als sonst. Er drang viel tiefer ein als je zuvor. Er fühlte sich jetzt schon leichter und leichter, fiel durch den dunklen Raum – wurde kleiner und kleiner, bis er sich nur noch seiner Atmung bewußt war.
Aus dem Nichts jagte ein Gefühl der Angst durch seine Adern. Der Alptraum begann. Sein schlaffer Körper wurde durch seine alte Wohnung gewirbelt. Wieder fühlte Digger den quälenden Schmerz, als er durch das Fenster flog und aufs Pflaster schlug. Er rang nach Luft. Er hatte das Gefühl, seine Haut würde von Nadeln zerstochen, als Wind und Regen auf seinen Körper einschlugen. Digger kam mühsam wieder auf die Füße. Er rannte, so schien es ihm, eine Ewigkeit lang den verlassenen Gehsteig hinunter. Sein Widersacher folgte ihm unbarmherzig. Digger sah in der Ferne einen Park und weitab von der Straße ein Haus. Er bemerkte, daß dort Licht brannte. Vielleicht waren Leute da, die ihm helfen konnten.
Jetzt, als er die Straße überquerte, kam es ihm vor, als liefe er schnell wie der Wind. Doch sein Verfolger war ihm noch immer dicht auf den Fersen.
Plötzlich hörte es auf zu regnen. Er lief durch den Park, und es war nicht länger Nacht. Die Sonne schien, und der Himmel war klar und strahlend blau. Kurz, es war ein herrlicher Tag. Der Park war weitläufig und grün und üppig und stellte einen überwältigenden Reichtum an Formen und Farben zur Schau. Digger fühlte sich an ein impressionistisches Gemälde erinnert: es gab Blumen und Planzen, Blattwerk und Vögel in allen Größen, Gestalten und Schattierungen. Ein kleiner Bach speiste einen glänzenden See, dessen stille Wasser einen friedlichen Himmel widerspiegelten.
Digger schaute zurück. Sein Verfolger hatte ein wenig aufgeholt 79und wirkte im Tageslicht noch größer. Er war ganz in schwarz gekleidet und machte einen kraftvollen, athletischen Eindruck. Langes, aschblondes Haar verdeckte sein Gesicht. Digger lief weiter. Wo ist das Haus, dessen Lichter ich gesehen habe?
Als er um eine Gruppe von Büschen und Bäumen bog, erblickte er das zweigeschossige Stuckgebäude mit dem beleuchteten Schild am Eingang:
»Himmelsbar«. Darunter stand in kleinerer Schrift: »Speisen und geistige Getränke«. Das Licht, das von dem Schild ausging, verbreitete einen sanften, einladenden Schimmer, der ihn anzog. Die Vorderseite des Hauses wurde durch eine Fassade aus Milchglas betont, die es ihm erlaubte, die Umrisse der Leute im Innern des Hauses zu erkennen. Endlich Hilfe, dachte er. Außer seinem Angreifer hatte er niemanden im Park gesehen. Er blickte noch einmal zu dem Schild hinauf. Er hatte das seltsame Gefühl, schon einmal – vielleicht sogar mehr als einmal – hier gewesen zu sein.
Als Digger die bronzene Türklinke berührte, überwältigte ihn schlagartig die Angst. Er hatte keine Ahnung, was ihn dort erwartete, doch fühlte er intuitiv, daß, sobald er die Bar erst einmal betreten hätte, sein Leben nie wieder so sein würde wie vorher.
Er zog die Hand zurück und steckte sie in die Tasche. Schauer liefen durch seinen Körper. Doch diese Schauer waren anders. Sie liefen nicht auf seiner Haut entlang, sondern durchströmten seinen Körper. Er hätte nicht sagen können, was stärker war – die Furcht vor dem Ungewissen im Innern der Bar oder die Angst vor weiteren Angriffen seines Verfolgers.
Er erinnerte sich, wie oft seine Unentschlossenheit ihm das Leben zur Hölle gemacht hatte: die Entscheidung, ob er seine Gefühle hinauslassen oder sie in sich verschließen sollte; sein 80Schwanken, ob er seinen Job in Chicago kündigen oder bleiben sollte; die inneren Auseinandersetzungen darüber, ob er Ruth und Judy verlassen oder die Sache durchstehen sollte; ob er seinem Vater nicht etwas, irgend etwas sagen sollte oder …
Er schaute in den Park und sah, daß der Gegner auf ihn zurannte. Er hatte die Schmerzen satt. Er blickte zum Eingang. Es war Zeit für etwas anderes. Er öffnete die Tür zur Himmelsbar.
Anfangs erschien es ihm dunkel. Es dauerte eine Minute, ehe sich Diggers Augen an die ungewohnte Beleuchtung gewöhnt hatten. Er blinzelte und versuchte, seine Umgebung genauer wahrzunehmen. Das erste, was er bemerkte, war, daß er sich anders fühlte: Angst und Furcht waren verschwunden, und der Kerl, der ihn verfolgte, erschien ihm für den Augenblick nicht mehr so bedrohlich.
Nachdem seine Augen sich an die Umgebung angepaßt hatten, erschien ihm das Licht sogar heller als draußen, nur weicher und weniger grell. Die Gegenstände wirkten durchsichtig. Er konnte Menschen essen und trinken sehen. Es war eine gut eingerichtete Bar.
Aus dem Nichts tauchte ein dunkelhäutiger Mann mit glänzenden, bis über die Schulter reichenden Haaren vor Digger auf. Er trug Jeans und ein Flanellhemd. Diggers Aufmerksamkeit wurde ganz von seinem breiten Lächeln in Anspruch genommen, das die blitzenden, ebenmäßigen Zähne des Mannes zeigte. Seine tiefbraunen Augen waren voller Liebenswürdigkeit und Lachen; er hatte große, wettergegerbte Hände. Digger überlegte, ob er wohl Indianer sei.
»Schoschone«, sagte der Mann ganz sachlich.
Diggers Kinnlade fiel herab, und der Mann brüllte vor Lachen. »Woher wußten Sie, was ich gedacht habe?« fragte Digger.
81
Die Leute in der Bar schauten sich um und sahen den lachenden Mann an.
»Es war langsam Zeit, Jonathan«, sagte der hochgewachsene, dunkle Mann, legte die Arme um Digger und umfing ihn wie ein großer Bär – fest, aber nicht zu eng. Dann ließ er ihn los und schenkte dem Neuankömmling ein breites Lächeln. »Schön, dich zu sehen«, sagte er, als begrüße er einen alten Freund.
»Sie kennen mich?« fragte Jonathan mit finsterem Blick.
Der Mann nickte, und sein Lächeln nahm einen ironischen Zug an. »Ja, ich kenne dich. Mein Name ist Ahmay. Komm, ich führe dich zu einem Platz. Wir haben viel zu besprechen.«
Als Ahmay seinen Namen aussprach, hatte Jonathan sofort das Gefühl, ihm schon einmal begegnet zu sein. Der Fremde ging voran, und Jonathan folgte ihm, wobei er sich umsah.
Das Lokal war groß. Es schien geräumig genug, um mindestens zweihundert Menschen Platz zu bieten. Die Wände waren mit einer Art von Kunst dekoriert, die Jonathan nie zuvor gesehen hatte. Sie erinnerte ihn an eine Mischung aus Holographie und Impressionismus. Einige der Wände waren mit kleinen, kreisförmigen Schilden behängt, die eine indirekte Beleuchtung hervorriefen. Kaminfeuer säumten eine Wand. In der gegenüberliegenden Ecke stand ein Flügel aus dunklem Eichenholz. Einige Tische und Stühle füllten die Mitte des Raumes aus. Doch die Gäste saßen hauptsächlich in kleinen Nischen mit hohen Wänden, in denen bequeme Samtsessel standen. In jeder Nische prangte ein glänzender, nagelneuer Tisch aus Hartholz. In dem glattpolierten Mahagoni spiegelte sich das indirekte Licht verborgener Beleuchtungskörper.
Die Bar selbst war aus kostbarem dunklem Mahagoniholz, 82das zu Tischen und Nischen paßte. Sie war etwa dreißig Meter lang, und ihre eleganten handgeschnitzten Formen beherrschten den Raum. Hinter der Bar brachten ähnlich schöne Mauersegmente und Spiegelelemente die Theke mit ihrem dunklen Holz noch besser zur Geltung. Geschickt verteilte Flora und Fauna verstärkten den überwältigenden Eindruck.
Als Ahmay Jonathan gegenüber in eine Nische glitt, änderte sich der Gesichtsausdruck des Indianers. Er beugte sich mit ernstem Blick nach vorn. »Ich hätte dir schon früher sagen sollen, wie schön es ist, dich so zu treffen.«
»Wovon reden Sie überhaupt?«
Der Indianer musterte seinen Gast. »Auf einen Teil deines Wissens wirst du dich sehr bald wieder besinnen, doch noch stehst du unter dem Überleitungsschock.«
Jonathan schüttelte den Kopf. »Entschulden Sie, Mr. Ahmay, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Überleitungsschock? Sind Sie sicher, daß ich der richtige Mann bin? Das ist nicht vielleicht ein Fall von Verwechslung oder so was? Ich habe schon genug Probleme, auch ohne daß man mich für jemanden hält, der ich nicht bin.«
Ahmay lächelte. »Die meisten Menschen machen diese Reise nicht, ehe ihre Zeit um ist. Lange Jahre bist du der einsame Bär gewesen, doch nun bist du in die Höhle zurückgekehrt. Wie das verirrte Bärenjunge hast du beschlossen, nach Hause zu kommen, ehe du dich auf einen neuen Pfad begibst.«
Jonathan stand auf, um die Nische zu verlassen. »Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wer Sie sind und wovon Sie reden. Alles, was Sie sagen, klingt für mich wie sinnloses Geschwafel. Ich möchte nicht unhöflich sein, Mr. Ahmay, aber ich muß jetzt gehen. Ich bin in großen Schwierigkeiten.«
83
Ahmays Lächeln vertiefte sich, als er sich das lange Haar aus den Augen strich. »Es tut mir leid«, sagte er und berührte Jonathans Arm. »Mein Tempo ist ein bißchen zu schnell für dich. Es wir dir bessergehen, wenn du etwas zu dir genommen hast. Betrachte mich als deinen persönlichen Maître d'hôtel.«
»Wofür denn?«
»Deinen Aufenthalt in der Himmelsbar. Mein Job ist es, für Information und Beistand zu sorgen. Ich werde während des gesamten Geschehens wie eine Art Ratgeber an deiner Seite sein. Du wirst hier den Namen Jonathan tragen. Doch ehe wir in die Einzelheiten gehen – möchtest du etwas bestellen? Unsere Karte hat nicht ihresgleichen.«
Die Flut der Gedanken, die ihm durch den Kopf schoß, machte ihn sprachlos. Essen. Er hatte seit heute morgen im Hardee's nichts mehr gegessen, und das auch nur aus der Hand. Es würde ihm guttun, wieder etwas zu essen.
»Hallo Jonathan«, sagte eine Frauenstimme hinter ihm.
Er schrak in seinem Sessel auf und sah eine schöne blonde Kellnerin mit geröteten Wangen neben sich stehen. Das farblich harmonierende Ensemble aus Rock und Kittel, das sie trug, entsprach dem Dekor der Bar, konnte jedoch ihre attraktive Figur nicht verbergen. »Ich bin wirklich froh, daß du dich entschlossen hast, wiederzukommen, Jonathan«, sagte sie und schlug ihren Bestellblock auf. »Was darf ich dir bringen?« Als sie von ihrem Block aufsah, trafen sich ihre Augen.
Ahmay hob schnell die Brauen und fixierte die Kellnerin mit strengem Blick. »Jonathan befindet sich im Überleitungsschock«, sagte er freundlich, »und braucht ein wenig zu essen, um sich wieder zurechtzufinden.«
Jonathan saß nur reglos da, wie versteinert durch den Blick dieser Frau.
84
»Er nimmt Truthahn, Kartoffelbrei und etwas Honiggebäck«, sagte Ahmay, und in seine Stimme schlich sich ein gereizter Unterton. »Und bring uns bitte noch zwei Tassen Mondtee.«
Die Kellnerin nickte und ging.
Jonathan starrte ihr nach. Irgend etwas an ihr beunruhigte ihn, doch er konnte sich nicht konzentrieren. Zuviel geschah auf einmal.
Ein paar Schritte entfernt drehte die Kellnerin sich um und erwiderte Jonathans Blick. Eine kurze Sekunde lang sahen sie einander in die Seele. Er war sich nicht sicher, doch er war fest davon überzeugt, ihr irgendwann und irgendwo schon einmal begegnet zu sein.
Ahmay gab ein Grunzen von sich. »Wenn du erstmal ein wenig Nahrung zu dir genommen hast«, sagte er, »wirst du diesen Ort besser verstehen.« Er wies auf seinen Kopf. »Wenn man hier drin lebt, fällt es einem schwer, alles zu begreifen. Wenn man hier drin lebt«, sagte er und klopfte sich auf die Brust, »ist es immer leichter.«
Jonathan wiegte den Kopf. »An diesem Ort ist nichts leicht«, sagte er und holte tief Luft. »Ich würde einfach gern wissen, wo ich bin, zum Teufel. Und wie kommt es, daß alle Welt meinen Namen kennt, aber ich niemanden? Wer war diese Frau?«
Ahmay hielt die großen Hände mit gespreizten Fingern und nach unten gekehrten Handflächen ausgebreitet. »Ich weiß, du bist verwirrt, Jonathan. Du wirst alles klarer sehen, wenn du gegessen hast. Warum entspannst du dich nicht die paar Minuten, bis dein Essen kommt? Es tut mir leid, daß wir so einen mißglückten Start hatten.«
»Mir auch«, sagte Jonathan und sah sich zum zweiten Mal im Raum um. »Das ist bestimmt eine der eigenartigsten Bars, in denen ich je gewesen bin.«
85
Sein Blick wanderte wieder zu den Schilden an der Wand. Alle trugen verschiedene Insignien: einige sahen aus wie ägyptische Hieroglyphen, andere wie chinesische oder japanische Schriftzeichen. Er konnte einen Schild erkennen, der aussah wie eine indianische Zeichnung. Ganz links entdeckte er einen, hinter dem grünes und dunkelviolettes Licht erstrahlte. Auf der Vorderseite des Schildes waren Dreiecke abgebildet, durch die Linien hindurchliefen. Sie erinnerten ihn an gezähmte Blitze. Rechts und links wurde dieser Schild von zwei identischen, höchst ungewöhnlichen Formen eingerahmt, die Jonathan für Bücherstützen hielt. In der oberen rechten Ecke war ein kleines Emblem zu sehen, das aus zahlreichen nebeneinanderliegenden und miteinander verbundenen Kreisen gebildet wurde.
Er sah sich den Schild genauer an und versuchte sich darüber klarzuwerden, ob er es wagen sollte, Ahmay eine weitere Frage zu stellen, auf die Gefahr hin, eine weitere Antwort zu bekommen, die er nicht verstand. Er war sich noch immer nicht sicher, ob er an diesem Ort bleiben solle. Er fühlte sich hier zwar wohl, doch noch immer beunruhigte ihn sein Verfolger und die Ahnung drohenden Unheils. Zwar hatte dieses Gefühl ein wenig nachgelassen, doch es war nicht verschwunden.
Während er nachdachte, wanderten seine Blicke durch den Raum zum äußersten Ende der Bar. Dort waren mehrere Türen in die Wand eingelassen. Er wandte sich um und schaute Ahmay an. Ein schwaches Lächeln spielte um den Mundwinkel dieses hochgewachsenen Mannes.
»Führen diese Türen zu den Gesellschaftsräumen?«
Ahmay räusperte sich. »In gewisser Weise schon.«
»Könnten Sie sich etwas genauer ausdrücken?«
»Ich könnte schon«, sagte er nickend. »Aber das wäre unfair, weil du meine Worte nicht verstehen würdest. Wenn es 86dafür Zeit ist, dann werden wir die Räume hinter diesen Türen aufsuchen, und du wirst verstehen und vielleicht sogar wissen.«
»Was wissen? Warum immer so unbestimmt?«
Die Kellnerin erschien mit Jonathans Essen. »Hier ist deine Bestellung«, sagte sie und stellte das Gedeck auf den Tisch. Leicht streifte ihre Hand die seine.
Das Herz sprang ihm fast aus der Brust.
»Du weißt ja, Jonathan«, fuhr sie mit einem offenen Lächeln fort, »daß wir noch eine ganze Menge nachzuholen haben. Wollen wir uns nicht zu einem kleinen Plausch treffen, wenn meine Schicht hier um ist?«
Jonathan sah zu der schönen Frau auf. Ein Schwall von Erinnerungen und Gefühlen erfüllte mit einem Mal seine Sinne: Er kannte sie. Sehr gut sogar.
Ahmay brummte ungehalten und sah die Frau zornfunkelnd an. »Du weißt es doch sehr genau, mein Fräulein. Ich habe dir gesagt, daß wir nicht bei dir haltmachen würden.«
Während der große Mann mit der Kellnerin sprach, rasten Jonathans Gedanken in eine andere Richtung. Er erblickte oder erfuhr ein ganz neues Phänomen: Es war, als liefen in seinem Bewußtsein gleichzeitig verschiedene Videos über ihn und diese Frau im Zeitraffer. Er sah sie beide vereint. Einige Szenen kamen ihm seltsam bekannt vor. Dann wieder flossen längst vergessene Gedanken und Emotionen an ihm vorüber, nur um wieder von neuen Szenen ausgelöscht zu werden. Ab und zu war im Hintergrund undeutlich ein Ausschnitt aus ihren Gesprächen zu hören, nur um durch neue Empfindungen in seinem Herzen übertönt zu werden.
»Es tut mir leid, Ahmay«, fuhr sie fort und ließ Jonathan für einen Augenblick außer acht, »ich konnte nicht anders. Als ich ihn gesehen habe …«
»Ich verstehe«, unterbrach sie Ahmay. »Aber jetzt muß er 87sich auf andere Dinge konzentrieren. Gib uns ein bißchen Zeit füreinander …«
»Ashle«, sagte eine kräftige Stimme, die klang, als käme sie aus einem Lautsprecher, »bitte melde dich umgehend im Konferenzraum Nummer vier bei Diane.«
Der heitere Gesichtsausdruck der Frau verschwand, und sie seufzte. »Entschuldige mich bitte, Jonathan«, sagte sie. »Ich muß fort.« Sie war schon im Gehen, da wandte sie sich noch einmal zu ihm um. »Denk dran, was ich dir sagte.«
Er war noch immer in die Bilder seines Innern vertieft. Als er sah, daß sie fortging, war alles, was er hervorstoßen konnte, ein »Ja«.
Als sie sich entfernte, fiel ihm auf, wie anmutig sie sich bewegte – so, wie er es noch bei keiner Frau gesehen hatte, die er kannte. Doch er war sich sicher, sie zu kennen. Er schaute sie genau an und versuchte, sich zu erinnern. Er schätzte, daß sie Ende zwanzig und etwa einen Meter achtzig groß war – größer als Ruth und Judy. Das naturblonde Haar der Frau war zu einem Knoten geschlungen und gab so den vollen Blick auf ihren makellosen, blütenweißen Teint frei. Noch einmal stellte er fest, daß ihre Uniform, die die Figur eher kaschieren sollte, nicht all ihre Kurven verbergen konnte.
Halt, Taylor, sagte er sich. Du wirst beobachtet. Okay – du hast gesehen, wie ihr euch geliebt habt, und es war wunderbar. Aber das ist noch kein Grund für lüsterne Seitenblicke. Wenn du dich bloß an ihren Namen erinnern könntest, an den, unter dem du sie gekannt hast. Es war nicht Ashle oder Diane. Es ist … ein Wort mit P, irgendwas Biblisches wie Peter oder Paul. Genau: Paula. Ich habe sie als Paula gekannt.
Allmählich kamen die Bilder wieder.
»Jonathan«, kommandierte Ahmay und holte ihn unsanft an den Tisch in der Bar zurück, »willst du nicht ein wenig von dem Mondtee versuchen? Das hilft bestimmt.«
88
»Ich kenne sie«, stieß er hervor. »Ich kenne sie. Sie heißt Paula. Ich kenne diese Frau wirklich.«
»Du hast recht«, sagte Ahmay und lachte ihn wieder an. »Es gibt noch viel mehr, was du weißt und nur vergessen hast. Dein Wissen wird sich exponentiell vergrößern, wenn du erstmal etwas gegessen hast.«
»Sie fangen schon wieder mit Ihren nebulösen Antworten an. Wenn ich das esse, hören Sie dann auch damit auf?«
»Meine Antworten sind nicht absichtlich unklar. Ich versuche, dir entsprechend deinem augenblicklichen Wissensstand zu antworten. Je mehr du ißt, und je mehr wir miteinander reden, desto größer wird dein Wissen. Du warst in andere Dimensionen und Wirklichkeiten vertieft, doch bald wirst du all die Dinge wissen, von denen ich spreche.«
»Wie wär's mit was ganz Einfachem?« fragte Jonathan. »Sowas wie: Wo zum Teufel bin ich?« Er wurde sich bewußt, daß er einem Fremden gegenüber normalerweise nicht so unhöflich war. »Was ist mit mir los? Ist dieser Ort wirklich, oder träume ich?« fuhr er fort. »Und was ist mit diesem Kerl, der mich hierher verfolgt hat – was ist mit ihm geschehen? Er müßte schon längst zur Tür reingekommen sein; er war doch dicht hinter mir.«
Ahmay lächelte verständnisvoll. »Du bist ein Suchender und ein Reisender, Jonathan«, sagte er. »Deshalb bist du hierhergekommen. Ein Großteil deiner selbst genießt die Reise ins Unbekannte, die Erregung. Meist ist das Ziel für dich nicht von Bedeutung. Nur ein Bär, der auf vielen Reisen außerhalb seiner Höhle gelebt hat, vermag das zu erkennen. Du bist wie ein Bär, der Mutter Erde durchstreift hat und müde geworden ist. Nun mußt du überwintern. Deshalb hast du es vorgezogen, in die Höhle zurückzukehren.«
»Wovon reden Sie? Bären und Mutter Erde? Das hört sich ja an wie 'ne Werbung für eine Sondersendung Natur und 89Umwelt oder so was.« Er zögerte. »Ich muß das hier essen; diese Ungewißheit macht mich ganz verrückt.« Er langte nach Messer und Gabel. »Ach übrigens, Ahmay, wissen Sie, daß ich in einer Stunde oder so ein Vorspiel habe?«
Der Indianer nickte und berührte sanft Jonathans Arm. »Versuche, dich auf diesen Augenblick einzulassen; du kannst viel von ihm lernen. Mach dir keine Sorgen, wir werden rechtzeitig zu deinem Vorspiel fertig sein«, sagte er. »Doch denke daran zu danken, ehe du ißt – etwas, was du verlernt hast.«
»Danken? Wofür? Ist das so 'ne Art religiöser Traum, hervorgerufen durch die Sehnsucht, von meiner Mutter anerkannt zu werden?«
»Dies ist kein Traum, Jonathan«, sagte Ahmay ruhig. »Dies ist viel mehr als ein Traum. Dies ist Wirklichkeit – eine Wirklichkeit weit jenseits deiner Wirklichkeiten, und dennoch Wirklichkeit. Und jetzt danke bitte und iß. Dein Wissen wird bald deine Träume übersteigen.«
90
»In deinem Innern sitzt eine schmerzhafte,
quälende Leere, die Linderung verlangt.«
Jonathan wollte schreien. Danken? dachte er. Jedesmal, wenn ich dieses Wort höre, muß ich an meine Mutter und diese Nonnen im Chicagoer Süden denken – hart, böse und herrschsüchtig. Ich möchte wissen, ob es bei Ahmay nicht einfach das ist: Herrschsucht. Manchmal benimmt er sich tatsächlich so.
Andererseits stimmt es, Taylor, daß du es verlernt hast, zu danken. Aber dann stimmt es auch, daß all deine Vorstellungen von Religion, persönlicher Lebensphilosophie und Spiritualität zu einem einzigen konfusen Brei geworden sind. Eine Erkenntnis, zu der du vor kurzem gelangt bist, ist, daß du Spiritualität auch erlangen kannst, ohne einer Religion anzugehören. Beide sind nicht voneinander abhängig. Das war ein großer Durchbruch. Nach all den Jahren katholischer Erziehung kannst du dich nicht erinnern, auch nur ein einziges Mal eine spirituelle Verbindung zu Gott geschaffen oder gefühlt zu haben. Ganz schön traurig, Taylor. Es wird höchste Zeit.
Jonathan bekreuzigte sich. »Gott, ich danke Dir«, sagte er und begann zu essen.
Ahmay lächelte. »Gut gemacht, junger Bär«, sagte er. »Ich weiß, das ist dir schwergefallen, aber es war ein wichtiger erster 91Schritt.« Er sah seinem Gast eine Weile beim Essen zu. »Außerdem war es das Zeichen für eine winzige Vertrauensbasis. Das war sehr nett. Danke dir.«
»Gern geschehen«, sagte Jonathan mit vollem Mund.
»Ich bin hier dein Begleiter. Je mehr du mir vertraust, desto mehr Antworten kann ich dir geben und dir verstehen helfen. Wenn du den Prozeß beschleunigen möchtest, dann haben wir auch dafür einen Weg.«
»Wie?« fragte Jonathan und schlürfte seinen Tee.
»Absolutes Vertrauen.«
»Was meinen Sie damit?«
Ahmay deutete auf Jonathans Hände. »Leg sie auf den Tisch.«
Er gehorchte.
»Ich werde jetzt deine Hände berühren. Wenn das, was dann geschieht, dir nicht gefällt, zieh die Hände weg. Verstanden?«
Jonathan nickte.
Ahmay legte seine mächtigen, wettergegerbten Hände über die Jonathans. Dem Besucher aus San Diego wurde schwindlig. Er schloß die Augen. Es war, als stünde er auf der Spitze eines sehr hohen Berges; es blies ein heftiger Wind. Er hatte das Gefühl, im nächsten Moment hinabzustürzen; dann war ihm, als träume er vom Fliegen. Er segelte auf dem Wind dahin – er war ein Vogel. Er warf einen Blick auf seine Schwingen. Er war ein Adler, und neben ihm flog ein weiterer Adler – größer und stärker und klüger als er. Doch ihm war, als würde er hinabstürzen.
»Dir kann nichts geschehen«, kam es ihm in den Sinn.
Die Landschaft unter ihm schien üppig und wunderschön; der Himmel war klar und warm. Es war so friedlich und still, daß er den Wunsch verspürte, aus eigener Kraft zu fliegen. Er schlug mit den Flügeln, und plötzlich war der zweite Adler 92verschwunden. Er fühlte sich so frei, daß ihm klar wurde, wie sehr er immer davon geträumt hatte, wirklich zu fliegen. Fliegen. Wie konnte er überhaupt fliegen? Er war doch kein Vogel. Die Landschaft wuchs ihm entgegen. Er fiel.
Auf der Erde taten sich zwei düstere Krater auf. Sie wurden größer und größer, kamen näher und näher. Er konnte nicht anhalten. Er begann, vor Furcht zu zittern; er würde sterben. Plötzlich erschien der zweite Adler an seiner Seite, und der Sturzflug war zu Ende. Er schlug mit den Flügeln. Am Himmel war es wieder friedlich und still.
Ahmay zog seine Hände fort.
Um Jonathan wurde es dunkel. Dann vernahm er die Geräusche der Bar. Er öffnete die Augen. Er fühlte sich nicht mehr schwindlig, doch sein Adrenalinspiegel war auf dem Höchststand. Ahmays tiefbraune Augen beobachteten ihn. »Was war das?« fragte Jonathan mit zitternden Händen.
Ahmay zuckte die Schultern. »Trink deinen Tee, dann fühlst du dich besser.«
Der Jüngere schüttelte den Kopf. »Ich fühle mich großartig. Mir ist so was bloß noch nie passiert. Es war aufregend und erschreckend zugleich. Wer bist du?«
Der Ältere lachte. »Ich habe es dir schon gesagt.«
Jonathan nahm einen Schluck Tee. »Ich weiß, was du gesagt hast, aber ich bin nicht sicher, ob ich es verstehe. Begleiter wohin? Dies ist doch keine gewöhnliche Bar, und du bist kein gewöhnlicher Schoschone.«
»Du hast recht«, sagte Ahmay, noch immer lächelnd. »Aber du lenkst ab. Ehe ich dir diese kleine Vorstellung bot, sprachen wir über Vertrauen. Was hast du für ein Gefühl? Hast du das Gefühl, du hast so viel Vertrauen in mich, daß wir ein paar Abkürzungen nehmen können? Bist du bereit, dein natürliches Mißtrauen zu vergessen, und das, was ich sage, ernst zu nehmen?«
93
Jonathan wiegte den Kopf auf und ab; dann begann er zu nicken. »Ja, ich glaube schon. Aber ich werde weiter Fragen stellen.«
»Das ist auch richtig so und soll so sein«, sagte Ahmay, und seine Miene wurde ernst. »Welche Fragen hast du im Sinn?«
»Laß uns auf den Bären und die Höhle zurückkommen, von denen du vorhin gesprochen hast«, sagte Jonathan. »Warum kehrt der Bär zurück?«
»Weil das sein Zuhause ist. Es ist ein Ort, wo Fragen beantwortet werden, wo die Leere erfüllt, der Lebensweg erhellt wird. Ein Ort, wo Körper, Herz und Verstand eine innigere Verbindung mit dem Geist eingehen können.«
»Dann ist dieser Ort meine Höhle?«
Ahmay lachte leise. »So könnte man sagen; er ist aber noch viel mehr.«
Jonathan atmete tief auf. »Dieses Essen war genau das Richtige.« Er trank noch ein paar Schluck Tee. »Und wie habe ich nun diesen Ort gefunden?«
»Wie so viele Fragen«, sagte Ahmay und strich sich das Haar aus den Augen, »trägt diese ihre Antwort schon in sich. Woran hast du in der letzten Zeit in deinem Leben gearbeitet?«
»In der Hauptsache an meiner Musik. Und ich habe versucht, meinen Körpe durch Atemtechnik und Dehnungsübungen zu entspannen. Ich habe sogar Yoga ausprobiert. Und seit ich in San Diego bin, habe ich an mir gearbeitet, um da hinzukommen, daß ich sage, was ich denke, und ausdrücke, was ich fühle, besonders, wenn es Ärger gibt …« Er hielt inne und versuchte sich zu erinnern. »In letzter Zeit meditiere ich, sooft ich kann.«
Ahmay nickte und lächelte. »Siehst du, ohne es zu wissen, hast du deine Frage selbst beantwortet. Du hast gesagt, du 94arbeitest an deinem Körper, am Verstand, an Herz und Seele. Ich habe dich beobachtet, wie du ganz allmählich auf den Ort der Stille zugetrieben bist. Als du nach Westen, nach San Diego, gezogen bist, hast du den Vier Winden erlaubt, frei und ungestört zu blasen. Die Stille und die Winde haben dich diesen Ort finden lassen.«
»Ist dieser Ort wirklich?« fragte Jonathan und schob die leeren Teller zur Seite.
»Deine Wahrnehmung ist deine Wirklichkeit!« rief Ahmay aus. Seine Stimme wurde laut: »Wo siehst du dich jetzt?«
Jonathan runzelte die Stirn. »Hier in der Einkehr, in dieser Nische, wo du auf mich einschreist.«
»Und davor?«
»Im Park, wo mich irgendein Verrückter verfolgt?«
»Und davor?«
Jonathan zögerte. »Mh-h-h«, versuchte er sich zu erinnern; er hatte es schon fast vergessen. »In Los Angeles … bei einem Schläfchen vor meiner Anhörung in den Warner Studios. Eigentlich beim Einschlafen; da hab ich versucht, mich auf meine Atmung zu konzentrieren – beim Meditieren.«
»Bist du in Wirklichkeit in L. A.?«
Jonathan nickte.
»Ist dieser Ort hier wirklich? Und als du zum Adler wurdest, war das Wirklichkeit?«
Er wand sich auf seinem Platz und kratzte sich am Kopf. »Ich weiß es nicht. In dem Moment schien mein Flug wirklich zu sein. Der Ort hier erscheint mir wirklich, weil du es sagst und ich dir glaube. Ja, ich schätze, er ist wirklich.«
»Aha«, lächelte Ahmay. »Jetzt fängst du an, die unterschiedlichen Ebenen der Wirklichkeit zu ergründen – oder sollte ich sagen, das Bewußtsein. Merke dir, es gibt einen großen Unterschied zwischen deinem Bewußtsein – oder deiner Wirklichkeit – und der Göttlichen Wirklichkeit.«
95
»Göttliche Wirklichkeit – was ist das?«
»Das Wesen Göttlicher Wirklichkeit ist ihr Sein, nicht mehr und nicht weniger. Sie war und ist und wird in jedem Augenblick der Ewigkeit sein. Die Göttliche Wirklichkeit wird auf vielerlei Weise im gesamten Universum offenbar. Sie kann sich im physischen Universum äußern, doch Manifestationen dieser Art sind bloße Reflexionen der Göttlichen Wirklichkeit.«
Jonathan starrte seinen Begleiter an. »Aber was hat denn Göttliche Wirklichkeit mit meiner Wirklichkeit zu tun?«
Ahmay grinste. »Du mußt dir die allumfassende Göttliche Wirklichkeit wie einen riesigen, hell leuchtenden Stern vorstellen. Von diesem Stern schießen unzählige Lichtstrahlen in den unendlichen Raum hinaus. Jeder dieser Lichtstrahlen wiederum enthält unzählige Lichtteilchen. Jedes Lichtteilchen steht für eine Seele. Je weiter sich die Teilchen von dem Stern entfernen, desto schwächer wird ihre Erinnerung an ihre Quelle. Aufgrund dieser Desorientierung beginnen sie, sich auf der Suche nach der Quelle fortzubewegen. Dies ist die treibende Kraft allen Lebens, die ich Die Bewegung nenne.«
»Und das trifft auf mich zu« fragte Jonathan.
»Nicht ganz. Das ist längst nicht alles. Stell dir dich selbst als eines jener Lichtteilchen vor. Du trittst in einen Raum namens Erde ein; an den Wänden hängen drei verschiedene Spiegel mit den Bezeichnungen: Physisch, Emotional und Intellektuell. Du schaust in diese Spiegel und siehst ein kleines Ich, ein hübsches Ich, ein entstelltes Ich, ein zorniges Ich, ein liebendes Ich, ein verängstigtes Ich, ein gewandtes Ich, ein wißbegieriges Ich oder ein unwissendes Ich.«
»Okay«, sagte Jonathan, »wenn ich also diese Seele bin und durch all diese Desorientierung zu einer Anschauung meines eigentlichen Wesens gelange, was hat das dann mit Jonathan Taylor zu tun?«
96
Ahmay rieb sich langsam die großen Hände. »Je länger und je intensiver eine Seele ihre physischen, emotionalen und intellektuellen Reflexionen wahrnimmt, desto größeren Wirklichkeitscharakter werden diese Reflexionen annehmen. Das ist für dich eine ebensolche Herausforderung wie für jeden anderen. Die Schwierigkeit für Jonathan Taylor besteht darin, daß das, was du als Wirklichkeit ansiehst, geradeso wirklich ist, wie ein guter Film auf Erden ein getreues Abbild des Lebens auf der Erde ist. Die fehlende Komponente ist die Spiritualität. Spiritualität ist das Wesen deines geistigen und seelischen Seins – deine Verbindung mit der Quelle oder der Göttlichen Wahrheit.«
Ahmay holte tief Luft. »Und nun zurück zu deiner eigentlichen Frage. Was du deine Wirklichkeit nennst, ist eigentlich deine Wahrnehmung – oder deine Kenntnis oder dein Bewußtsein – der Reflexionen der Göttlichen Wirklichkeit. Und Reflexionen sind nur dadurch wirklich, daß sie ein integraler Bestandteil der Göttlichen Wirklichkeit sind. Ohne die Göttliche Wirklichkeit jedoch gäbe es deine Wirklichkeit nicht.«
»Gibt es denn für mich überhaupt noch Hoffnung«, fragte Jonathan, »oder bin ich lediglich eine weitere verlorene Seele?«
»Es gibt berechtigte Hoffnung, doch zuerst mußt du erkennen, wie du dir selbst entgegengearbeitet hast.«
»Wie das?«
»Die meiste Zeit deines Lebens hast du dich selbst als eine spiegelbildliche Reflexion mit Namen Jonathan Taylor, den einzigen Sohn von Mr. und Mrs. Taylor, betrachtet, als Therapeuten, Ehemann, Restaurantbesitzer, Katholiken, Sportas, Musiker und Komponisten und – je nach den Erfahrungen, die du hier machst – vielleicht als Filmmusikkomponisten. Weil du dich in erster Linie in diesen Reflexionen 97wahrgenommen hast, konnte dein irdisches Leben bisher keine Erfüllung finden. In deinem Innern sitzt eine schmerzhafte oder quälende Leere, die Linderung verlangt.«
Jonathan schwieg. Er fühlte sich verwundbar und ängstlich. Hier in der Himmelsbar geschah etwas mit ihm, von dem er nicht wußte, ob es nur Einbildung war oder Wirklichkeit. Er hatte große Mühe, sich auf all das zu konzentrieren, was Ahmay sagte, weil er alle Augenblicke dasselbe ahnungsvolle Gefühl zu haben glaubte, das ihn überhaupt erst in die Bar getrieben hatte.
»Alles in Ordnung?« fragte Ahmay.
Jonathan nickte. »Ich höre dir zu.«
»Viele Menschen, die diese schmerzliche Leere empfinden, neigen dazu, in ihrem Denken und Handeln auf ihre so widergespiegelte Wahrnehmung zu reagieren. Um ihre Leere zu füllen, suchen diese Menschen Linderung in anderen Formen derselben schmerzvollen Leere, wie in neuen Beziehungen, mehr Geld, einer anderen Stadt oder dem Erwerb immer neuer Dinge. Dies jedoch verschafft ihnen nicht die erhoffte Erfüllung, und am Ende fühlen sie sich noch bindungsloser als vorher. Und genau das ist mit dir geschehen, stimmt's?«
Jonathan zuckte die Schultern. »Kann schon sein. Ich bin nicht ganz sicher. Ich versuche, diesen ganzen Kram zu verstehen, aber ich muß noch über eine ganze Menge nachdenken. Du hast recht, was mein Gefühl der Bindungslosigkeit angeht. Ich wußte, daß irgend etwas fehlt, ich wußte bloß nie, wie ich es nennen sollte.«
»Ich verstehe«, sagte Ahmay. »Der Trick, der einem die Idee, die schmerzhafte Leere durch Spiritualität zu ersetzen, begreiflich macht, ist, sich dessen bewußt zu sein, daß die Göttliche Wirklichkeit mehrdimensional ist, wobei die Spiritualität ihr innerstes Wesen bestimmt. Der erste Schritt zum Verständnis besteht darin, hinter die Bilder zu schauen, welche 98die Spiegel reflektieren. Du mußt dich und das Universum größer sehen als diese einengenden Reflexionen. Das Universum und du, ihr seid viel – viel umfassender oder, wie ich es nennen würde, ihr seid vieldimensional.«
»Das viele Denken«, unterbrach ihn Jonathan, »hat mich richtig durstig gemacht. Können wir was Kaltes zu trinken bestellen?«
»Gleich«, sagte Ahmay. »Wir wollen jetzt einen Spaziergang zu den Trainingsräumen machen. Auf dem Weg dorthin können wir etwas an der Bar bekommen.« Er schaute Jonathan in die Augen. Dabei musterte er ihn wie ein Adler, der seine Brut beim Fressen beobachtet. »Du mußt wissen, daß ich durchaus begreife, wie schwer das alles für dich ist. Dein Leben auf der Erde ist im Grunde eine Schule, wo die Kurse, wie in so vielen anderen Schulen, außerordentlich schwierig sind, weil es so viele Spiegelbilder gibt, die man verstehen und hinter die man blicken muß. Du und der Rest deiner Klassenkameraden, ihr habt keine leichte Schule gewählt.«
Jonathan hatte das Gefühl, als habe er Ahmays Worte schon einmal gehört. Es war, als beginne sich in seinem Kopf eine weitere Serie von Videos abzuspielen, ähnlich jener, die er gesehen hatte, nachdem Paula seine Hand berührt hatte. Was wohl mit ihr geschehen war? dachte er. Sie wollte mich am Ende ihrer Schicht treffen, wann immer das ist. Vielleicht kann sie mir helfen, mich zu erinnern. Irgendwie scheinen diese Erinnerungen in meinem Herzen, nicht in meinem Kopf eingeschlossen zu sein. Vielleicht noch tiefer in mir; vielleicht sogar in meiner Seele …
»Können wir jetzt gleich was zu Trinken besorgen?« fragte er. »Meine Kehle ist so trocken, daß ich schwören könnte, wir sind mitten im Tal des Todes.«
»Gute Idee«, sagte Ahmay, glitt aus der Nische und ging 99voran. »Da ist jemand, von dem ich möchte, daß du ihn kennenlernst. Du wirst ihn mögen.«
Jonathan spürte, wie die Angst in ihm aufstieg. Als sie sich der langgestreckten Bar näherten, fielen seine Blicke auf einen großen, gutgewachsenen Mann, der hinter der Theke arbeitete. Obwohl dieser Mann die Muskulatur eines Mittzwanzigers hatte, schloß Jonathan aus den Krähenfüßen um seine Augen und den grauen Strähnen in seinem sonst braunen Haar, daß er um die Vierzig sein mußte. Er schätzte, daß er mindestens eins dreiundneunzig war und ungefähr zweihundertfünfundzwanzig Kilo wog; er mochte vielleicht sogar einen guten Linebacker abgegeben haben.
»Mr. Taylor«, sagte der große, schmale Indianer, »ich möchte Sie einem Freund vorstellen.«
Jonathan lächelte und reichte dem Mann hinter der Theke die Hand. »Sehr erfreut, Zorinthalian.«
Augenblick mal, Taylor. Woher kam das? Du weißt seinen Namen, obwohl du diesen Mann noch nie im Leben gesehen hast.
»Ganz meinerseits, Jonathan«, sagte Zorinthalian mit tiefer Stimme und schüttelte ihm die Hand. Er servierte Jonathan ein Glas kaltes Wasser und überreichte Ahmay einen Umschlag.
Woher weiß er, wie ich heiße und daß ich Durst hatte? überlegte Jonathan, während er sich von dem kraftvollen Händedruck des Mannes löste. Einander widerstreitende Energieströme durchliefen Geist und Körper. Als er Zorinthalians Hand schüttelte, nahm ein Gefühl liebender Zuneigung von ihm Besitz, fast als wären sie Brüder oder sonst miteinander verwandt. Gleich darauf fluteten Szenen durch sein Bewußtsein aus anderer Zeit und anderen Orten, wo sie beide gelacht, gekämpft und geweint und gemeinsame Erfahrungen gesammelt hatten. Farben und Gerüche eines 100Ortes aus längst vergangener Zeit irrten ihm durch den Kopf.
Gleichzeitig verspürte er eine starke negative Kraft, die sehr nahe war und zuzunehmen schien. Hätte er es nicht besser gewußt, er hätte geschworen, daß diese negative Energie von Zorinthalian ausging. Doch das konnte nicht sein: Er fühlte eine unerklärliche Zuneigung zu diesem Mann. Jonathan schaute sich die anderen Leute in der Bar an. Es war nichts Besonderes an ihnen. Alle machten einen völlig harmlosen Eindruck. In seiner Nähe war niemand außer Ahmay und einem schlampig wirkenden Hilfskellner. Jonathan beschloß, über all das mit Ahmay zu reden, wenn nicht so viele andere Leute um sie waren.
»Das Essen wirkt anscheinend«, sagte Ahmay zu Zorinthalian und zeigte mit dem Umschlag auf Jonathan. Er wandte sich um und ging den Korridor hinunter auf die zahlreichen Türen zu. »Komm, kleiner Bär, du hast nicht viel Zeit und brauchst ganz entschieden ein bißchen Training.«
»Danke für das Wasser«, sagte Jonathan zu Zorinthalian.
»Immer zu Diensten«, antwortete der freundliche Koloß.
Jonathan folgte Ahmay. Die Türen, an denen sie vorübergingen, waren als Konferenzräume 1, 2, 3 und 4 gekennzeichnet. War Paula nicht mit Diana in Konferenzraum 4? Vielleicht konnte er irgendwo einen Augenblick mit ihr allein sein. Er mußte einen Weg finden, sich von Ahmay zu entfernen.
Die beiden Männer gelangten in einen weiteren Korridor und wandten sich nach rechts. Jetzt lautete die Bezeichnung an den fortlaufend numerierten Türen »Überleitungsraum«. Vor dem Überleitungsraum 6 hielten sie an. »Siehst du diesen Umschlag?« fragte Ahmay.
Jonathan nickte.
Der Indianer klopfte an die Tür. »Dieser Umschlag enthält 101Disketten, die ich in der Bibliothek besorgt habe. Ich glaube, sie werden für dich von Interesse sein.«
Ahmays Klopfen blieb ohne Antwort. Er öffnete die Tür und ging hinein.
Jonathan folgte ihm. Der Raum, der dieselbe ungewöhnlich weiche Beleuchtung hatte wie die Bar, vermittelte ihm ein angenehmes Gefühl von Vertrautheit. Das mit Teppichen ausgelegte Zimmer mußte ungefähr neun mal neun Meter messen. Das Mobiliar bestand aus mehreren Stühlen, einer Couch und einem Lehnstuhl. Er setzte sich in den Lehnstuhl. »Ich dachte, wir wollten in einen Trainingsraum gehen«, sagte er und zog sich seine Turnschuhe aus. Sie waren voller Steine, die ihn schon gedrückt hatten, als er in den Park gelaufen war.
»Dies ist ein Trainingsraum«, sagte Ahmay. »Hier kannst du Dehnungsübungen machen und beweglicher werden; und du kannst stärker werden. Die Transitionsphase ist die eigentliche Trainingsphase.«
Jonathan überlegte, ob er Ahmay darauf hinweisen solle, daß das Wort »Training« für ihn eine andere Bedeutung habe als für Jonathan, beschloß aber, lieber zu schweigen. Er sah sich im Zimmer um. An der einen Wand standen technische Geräte, zu denen offenbar ein Videorekorder, ein Radio, ein CD-Player ein Video Disk Player, Keyboard und Bildschirm eines Computers, eine Kontrolltafel und noch andere elektronische Apparate gehörten, die er nie zuvor gesehen hatte.
Ahmay öffnete den Umschlag, zog etwas heraus, das aussah wie eine zu klein geratene CD und legte es in den CD-Player.
Klaviermusik erklang – ein Konzert, das Jonathan nie zuvor gehört hatte. Es klang wie Mozart, aber er wußte, daß es das nicht war. Auch das Klangsystem war das beste, das er je 102gehört hatte. Es war so gut, daß er das Gefühl hatte, er spiele selber Klavier. Er spürte den Nachhall in seinen Fingern, Händen und Armen prickeln. Er fühlte sich besänftigt – fast so als stünde er unter Drogen, nähme das Geschehen im Raum jedoch ganz bewußt wahr.
Entspann dich, Taylor. Hör auf, dagegen anzukämpfen. Laß dich mit dem Strom treiben. Wer weiß, wo das alles hinführt; du mußt loslassen. Du bist nicht in L. A., und du spielst nicht Klavier, auch wenn es sich vielleicht so anfühlt. Das macht nichts. Was zählt, ist, daß dieser Ahmay dich aus irgendeinem Grunde mag und versucht, dir zu helfen. Also paß auf, was er dir zu sagen hat. Wehtun kann es nicht, vielleicht hilft's sogar. Vergiß nicht, daß du in einer Stunde oder so ein Vorspiel hast. Vielleicht findest du hier einen Weg, das Problem mit deiner Musik und deinem Finger in den Griff zu kriegen. Quatsch, das sind doch bloß Wunschträume. Wirkliche Probleme lassen sich nicht im Traum lösen. Aber was für ein Traum!
Ahmay ist ein toller Typ. Ich hab noch keinen Indianer getroffen, der so freundlich und klug und heiter war. Naja, so viele Indianer hast du ja nun auch wieder nicht kennengelernt, genaugenommen. Die paar, die du gekannt hast, lebten in Chicago und in Florida und waren bloß vorüberhuschende Schatten in deinem Leben. Du warst nie wirklich mit einem befreundet. Und dann erst dieser Zorinthalian. Mein Gott, was für ein Roß! Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen, aber er scheint keiner von der gefährlichen Sorte zu sein. Ich kenne ihn irgendwoher, aber ich will verdammt sein, wenn ich mich dran erinnern kann. Das ist so wundersam. Mir ist, als wären wir Brüder: Ich kenne – warum, weiß ich nicht – seinen Namen aus irgendeinem unbekannten Abschnitt meines Lebens. Aber welchem? Ich kann für jedes Jahr in meinem Leben Rechenschaft ablegen. 103Es gab keinen Zorinthalian. Unter diesem Namen nicht und unter keinem anderen. Daran hätte ich mich erinnert. Und dann war da dies unglaubliche Gefühl, das ich hatte, als er mir die Hand gab. Ich habe mich noch nie so ruhig und friedlich und freundschaftlich geliebt gefühlt wie in jenem Augenblick. Das ist verrückt.
Und was ist mit dieser Paula? Mein Gott, sie ist wahrhaftig schön! Ich kenne sie. Wir haben uns geliebt, und wir waren die besten Freunde. Mir platzt noch der Schädel. Wieso kommt es mir vor, als kenne ich sie so genau und kann mich dann kaum an ihren Namen erinnern? Wann könnte ich sie kennengelernt haben? Nicht in Chicago und nicht in Florida und ganz bestimmt nicht in Kalifornien. Das Gefühl drohender Gefahr scheint sich fürs erste gelegt zu haben. Wenn ich bloß wüßte, wie ich das Problem in den Griff kriegen soll. Ob Ahmay wohl weiß, was ich jetzt denke, wo er doch meine Gedanken lesen kann?
Ahmay war noch damit beschäftigt, die Geräte an der Wand einzustellen. Er drehte an ein paar Knöpfen und betätigte kurz nacheinander zwei Schalter. In der Wand links von Jonathan erschien ein winziges Licht. Ein haarfeiner Strahl kam etwa einen Meter über dem Boden aus der Wand und traf ungehindert auf der gegenüberliegenden Wand auf, wo er sich zu einem großen Kreis erweiterte, der fast vom Boden bis zur Decke reichte.
»Was ist denn das?« fragte Jonathan, der sich noch immer benommen fühlte.
»Das ist VF Licht«, antwortete Ahmay sachlich.
Jonathan versuchte, sich zu konzentrieren und eine weitere Frage zu formulieren. Seine Gedanken flossen träge und entspannt. Es war bequemer, den Lichtstrahl zu betrachten. Das erinnerte ihn an seine Kinderzeit in Chicago. Er hatte immer gern im Wohnzimmer gesessen und den Staubteilchen 104zugesehen, die mit einem Sonnenstrahl von draußen hereinschwebten. Diese umherwirbelnden Staubteilchen überraschten ihn immer von neuem. Sie waren immer da, doch er nahm sie nur wahr, wenn er sie in einem Sonnenstrahl erblickte.
Das VF Licht, das Ahmay eben in Gang gesetzt hatte, war ein heller, weißer Lichtstrahl, in dem winzige Partikel kreisförmig entgegen dem Uhrzeigersinn umherschossen.
»Was bedeutet VF?« fragte Jonathan und kratzte sich am Kopf.
»Vibrationsfrequenz oder Schwingungsfrequenz«, antwortete Ahmay und knipste noch weitere Schalter an. »Eines der Universalprinzipien besagt, ›Alles ist Energie‹, und eines deren Gesetze besagt, ›Alle Energie hat ihre ureigene Vibrationsfrequenz‹. Du bist Energie, und du hast deine eigene VF.«
»Na und?«
»Und hier ist deine Chance, eine jener informativen Abkürzungen zu nehmen, von denen wir vorhin sprachen«, sagte Ahmay und wandte sich Jonathan zu.
»Was?« Jonathan bemühte sich, seine Gedanken zu ordnen. Das Klavierkonzert erklang noch immer, schien aber leiser geworden zu sein. »Ich verstehe nicht, wovon du redest.«
»Es ist ganz einfach«, sagte Ahmay. »Du brauchst nichts weiter zu tun, als ins Licht zu treten. Das Licht wird dann deine VF messen und auf der Stelle wissen, wer du bist. So ähnlich wie beim Fingerabdruck.«
»Und was dann?«
»Und dann wirst du die Himmelsbibliothek betreten können. Sie enthält unter anderem die Berichte sämtlicher Reisen, deine eingeschlossen. Genauer gesagt ist sie im Besitz von Beschreibungen all dessen, was sich je im Universum ereignet 105hat. Und sie ist – durch deine VF – über die augenblickliche Ebene deines Bewußtseins informiert. Jede Ebene bringt einen anderen Grad der Bewußtheit mit sich.«
Noch immer in dem Bemühen, sich zu konzentrieren, schüttelte Jonathan den Kopf. »Ahmay, ich versteh's einfach nicht. Wenn das Licht weiß, wer ich bin – was dann? Was wird dann geschehen, das mir helfen soll?«
Ahmay lachte gutmütig. »Dann wird das Licht imstande sein, dir auf einer dir verständlichen sprachlichen und logischen Ebene weitere Fragen weitere Fragen über Spiritualität oder reflektierte Wirklichkeit zu beantworten. Denn was nützen dir schließlich Antworten, die du nicht verstehst?«
Jetzt beginnt es Sinn zu machen, dachte Jonathan. »Und woher weiß das Licht, was ich fragen will? Liest es meine Gedanken oder frage ich einfach laut heraus oder was?«
Ahmay grinste noch immer. »Also, es geht folgendermaßen: du trittst mit dem ganzen Körper in das Licht. Dann stellst du laut die Fragen, die du stellen möchtest. Die Antworten wirst du entweder gesprochen, in musikalischer Form, auf dreidimensionalem Video, in Form virtueller Realität oder auch auf alle vier Arten gleichzeitig erhalten. Das kann ziemlich anstrengend werden. Wenn du das Gefühl hast, daß es dir zuviel wird, kannst du aus dem Licht heraustreten, dich hinsetzen und wirst dennoch die Antwort hören oder sehen können. Doch wenn du nach der vollen ›Erkenntnis‹ strebst, dann solltest du während der ganzen Dauer der Antwort im Licht bleiben.«
»Und wo wirst du während dieser ganzen Zeit sein?«
»Ich werde ganz einfach hier sein«, sagte Ahmay. »Ich werde dich nicht verlassen. Wenn du eine Frage hast oder dir irgend etwas unklar ist, dann wirst du es mich wissen lassen. Denk dran: Ich bin dein Begleiter.«
Jonathan nickte. Jetzt war er beruhigt. Er vertiefte sich 106noch ein paar Minuten in den Anblick des Lichtes; dann stellte er sich neben den Strahl. Zögernd hielt er seine Finger ins Licht, dann die Hand und schließlich den ganzen Arm. Pastellfarbenes Licht schien in kleinen Wellen aus dem Teil seines Körpers zu strömen, der sich im Lichtstrahl befand. Erschrocken zog er ruckartig den Arm und die Hand aus dem Licht.
Ahmay brach in ein lautes, heiseres Gelächter aus.
»Was is'n da so komisch?« schnauzte Jonathan ihn an. »Du tust so, als wäre ich blöd oder so was, bloß weil ich überrascht war. Von diesen Farben hast du mir überhaupt nichts erzählt.«
Ahmays Gelächter verstummte, und er runzelte die Stirn. »Zuerst einmal«, sagte er freundlich, »bist du nicht blöd. Zum zweiten kennst du die Farben, weil du sie schon im VF-Licht gesehen hast. Wahrscheinlich hast du es bloß vergessen. Ich ahnte nicht, daß du so viel vergessen hast, und das hat mich überrascht. Es tut mir leid, wenn es so aussah, als hätte ich über dich gelacht.«
»Was meinst du damit; was hab ich vergessen?«
»Du weißt viel mehr als dir bewußt ist«, sagte Ahmay und setzte sich auf einen Stuhl. Er kreuzte die langen Beine mit den abgetragenen Cowboystiefeln und strich sich das Haar mit seinen narbigen Händen aus den Augen. »Ich will dir ein Beispiel sagen. Immer wenn du umziehst, packst du deine Sachen in Kartons. Für unser Beispiel nehmen wir jetzt einmal an, daß einer dieser Kartons versehentlich in deiner Garage unter ein paar Büchern oder Möbeln stehengeblieben ist. Nach Jahren entdeckst du den Karton wieder. Du öffnest ihn ganz gespannt, weil du weder weißt, woher er kommt, noch, was darin ist. Eigentlich kennst du seinen Inhalt. Dein Gedächtnis braucht bloß ein paar Minuten, um damit rüberzukommen.«
107
Jonathan fuhr sich mit der Hand durchs blonde Haar und den muskulösen Nacken hinunter. »Wie soll ich denn je wissen, wieviel ich schon mal gewußt habe?«
»Deshalb sind wir ja in diesen Raum gegangen. Ich versuche, den Prozeß zu beschleunigen. Das ist der ganze Sinn dieses VF-Lichtbündels: dir beim Erinnern zu helfen. Ehe man auf die Erdenschule geht, leert man die Taschen seines Seelengedächtnisses: Mir war nicht klar, wieviel du vergessen hast. Daß eine so alte Seele wie du sich nicht mehr an die Farben im VF-Strahl erinnern könnte, kam mir einfach bloß komisch vor. Das war für mich, als hättest du deinen Namen oder die Nationalität deiner Eltern vergessen. Ich muß zugeben, daß mein Leben hier in der Himmelsbar mich vergessen läßt, wie dominierend irdische Wahrnehmung sein kann. Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe.«
»Ich versteh schon«, sagte Jonathan. »Entschuldige, daß ich grob zu dir war.«
Ahmay schmunzelte. »Danke, junger Bär.«
Jonathans Blick wurde finster. »Gibt's da drin noch mehr solche Überraschungen?« fragte er mit einer schnellen Kopfbewegung gegen den Lichtstrahl.
Ahmay lachte schallend. »Natürlich sind da drin noch mehr Überraschungen. Das Geheimnis besteht darin, sich nicht gegen die Überraschungen zu sträuben und auf das Unerwartete gefaßt zu sein. Warum solltest du diese ganze Übung auf dich nehmen, wenn du schon wüßtest, was dich erwartet? Es gehört zur Entwicklung, sich von neuen ›Erkenntnissen‹ überraschen zu lassen. Das ist ja der Spaß an der Sache.« Er zögerte und sprach mit ernster Miene weiter. »Los, Jonathan, entspann dich. Das ist nicht der Tod oder die Folter. Das ist ein Abenteuer. Laß es einfach geschehen.«
108
»Balance ist der natürliche Zustand
des Universums …«
Jonathan atmete tief durch und wandte sich dem Lichtstrahl zu, der aus der Wand kam. Vorsichtig hielt er seine Hand wieder hinein, und wieder sah er die zahlreichen Farben, die von ihm ausströmten. »Mann, das ist so unheimlich«, sagte er zu Ahmay. »Ich weiß nicht, ob ich mich je daran gewöhnen werde.«
»Du wirst dich gleich ganz wohl fühlen«, sagte Ahmay. »Ich treibe mich noch ein Weilchen hier herum, dann geh ich auf einen Schwatz zu Zorinthalian. Wenn du mich brauchst, ruf einfach, und ich werde hier sein.«
Jonathan nickte zustimmend und schob dann vorsichtig den ganzen Körper ins Licht. Augenblicklich fühlte er sich wie in einer anderen Welt. Er nahm nur noch das Licht wahr. Die Tatsache, daß er sich in der Einkehr und dort zusammen mit Ahmay in einem eigenen Überleitungsraum befand, trat in den Hintergrund seiner Gedanken. Er konzentrierte sich ganz auf das Licht, das nun allein im Zentrum seiner Wahrnehmung stand.
Ein leises, durchaus angenehmes Prickeln durchlief seinen Körper, und er schaute an sich hinunter, um zu sehen, was geschah. Es war, als könne er durch sich hindurch bis auf sein Rückgrat sehen. Ein rötlicher Farbton kam aus seiner 109Wirbelsäule hervor; dann entdeckte er einen orangenen Schimmer, der genau unterhalb seines Bauchnabels seinen Anfang nahm, und einen gelben Lichtschein, der vom Solarplexus ausging.
»Was geht hier vor?« fragte er.
»Bitte drücke dich genauer aus«, sagte eine klare männliche Stimme in einer tiefen Tonlage.
Jonathan runzelte die Stirn und bemühte sich angestrengt, Ahmay in den Vordergrund seiner Gedanken zurückzuholen. Er blickte sich um und sah ihn mit gekreuzten Beinen auf der Couch sitzen. Das war nicht Ahmays Stimme, sagte er sich. Ahmays Stimme ist heller und poetischer. Abgesehen von ihrem penetranten Klang erzeugte diese neue Stimme in Jonathans Innerem eine Schwingung wie ganz bestimmte tiefe Töne aus dem Stereogerät oder bei einer Symphonie. Diese unbekannte Stimme mußte jemand anderem gehören. »Wer bist du?« fragte Jonathan und wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Farben zu, die seinem Körper entströmten.
»Ich bin Ramda.«
»Wo bist du?«
»Hier bei dir im Licht.«
»Aber ich sehe dich nicht.«
»Richtig, aber dennoch bin ich da. Die Göttliche Wirklichkeit braucht keinen Augenschein zur Bestätigung ihres Wahrheitsgehaltes.«
Jonathan war verwirrt. »Warum bist du hier bei mir?«
»Ich bin deine Schnittstelle für die Himmelsbibliothek«, sagte Ramda. »Ich habe die Aufgabe, die von dir angeforderten Informationen zugänglich zu machen und die Antwort dann so zu formulieren, daß sie dir verständlich wird.«
»Okay«, sagte Jonathan und betrachtete nacheinander den Lichtstrahl und die seinem Körper entströmenden Farben, »was geschieht mit mir in diesem Moment?«
110
»Nichts.«
»Was soll das heißen?«
»Mit dir geschieht nichts.«
»Was haben dann alle diese Farben zu bedeuten?«
»Sie geschehen dir nicht; sie sind du selbst«, sagte Ramda. »Was du – etwas verschwommen – wahrnimmst, ist dein Ätherleib. Du kannst es auch als Lichtpartikel bezeichnen, deine Seele.«
»Und was tut das Licht?«
»Es reflektiert das, was bereits vorhanden ist.« Ramda zögerte. »Ich möchte vor dir ein Reflexionsinstrument aufstellen, ganz ähnlich dem, was du einen Spiegel nennen würdest. Dieses Instrument wird jeweils das reflektieren, was du dir selbst erlaubst zu sehen.«
Augenblicklich erschien im Lichtstrahl vor Jonathan ein lebensgroßer glänzender Apparat, in dem er dieselben roten, orangenen und gelben Farbtöne von seinem vollständig bekleideten Körper ausströmen sah. Doch diesmal sah er mehr Farben als zuvor: aus der Brustgegend kam grünes Licht; Himmelblau umschloß seine Kehle; Indigo leuchtete um seinen Hinterkopf; Violett schwebte über seinem Scheitel. Es war nur schade, daß es sämtlichen Farben offenbar an Klarheit und Aussagekraft mangelte.
Jonathan erinnerte sich an einen Trick, den, wie er beobachtet hatte, die Leute benutzten, wenn sie versteckte dreidimensionale Bilder betrachteten. Das sogenannte »Hintersehen« oder »Hintersuchen« dient dazu, das 3-D-Bild in den Brennpunkt zu holen. Man konzentriert den Blick auf die Peripherie der Bildseite, und wenn man es richtig macht, »erscheint« das »versteckte« Bild dann mehrdimensional. Er beschloß, es mit dieser Technik bei Ramdas Reflexionsgerät zu versuchen.
Zuerst erschien ein unbestimmter, verschwommener Fleck; 111doch nach wenigen Minuten zeichneten sich die Farben immer klarer ab. Die neue Methode der Wahrnehmung bewährte sich. Er sah sein Spiegelbild deutlich vor sich: ein schwaches, bläuliches Licht umgab seinen ganzen Körper.
»Was meinst du, wenn du Seele sagst?« fragte Jonathan.
»Deinen Geistkörper.«
»Und was ist damit?«
»Er ist immer bei dir. Im Grunde«, sagte Ramda, »nimmt deine Seele einen weitaus größeren Raum ein, als dir bewußt sein mag. Der physische Teil deiner selbst ist eine bloße Reflexion deiner Seele. Um also deine Frage zu beantworten: du selbst bist deine Seele. In diesem Augenblick jedoch vermagst du lediglich Bruchteile deines Geistkörpers zu erkennen.«
Jonathan runzelte die Stirn, während er versuchte, nachzudenken. »Was haben die Farben zu bedeuten, die ich in deinem Reflexionsgerät sehe?«
»Das sind Energieleitpunkte. Am einfachsten erkläre ich es dir vielleicht, indem ich dir sage, daß diese Farben, die du erkennst, wenn du in diesem Lichtstrahl stehst, der Kitt zwischen deinem Körper und deiner Seele sind. Sie ermöglichen es dir, dich in dieser physischen Welt zu bewegen und dennoch in Kontakt mit dem geistigen Teil deiner selbst zu bleiben.«
»Aber warum sind es so viele verschiedene Farben? Warum sind sie nicht alle gleich?«
»Das rote Licht am unteren Ende deiner Wirbelsäule steht im Einklang mit deinem physischen Sein und allem, was mit deinen Überlebensstrategien zusammenhängt. Das orange Licht mit deiner Kreativität und Sexualität, und das gelbe, vom Solarplexus ausgehende, mit Intellekt und Stärke. Grün steht für dein Herz.«
»Und warum sehe ich dann in der Herzgegend pinkfarbene Stellen? Was hat das zu bedeuten?«
112
»Hmmm«, machte Ramda. »Du bist sehr aufmerksam, Jonathan. Gute Frage. Jedem der Knotenpunkte sind mehrere Farben zugeordnet. Zum jetzigen Zeitpunkt erläutere ich dir erst einmal die grundlegenden Lichtenergien. Da kein Mensch wie der andere ist, wäre für jeden eine andere VF erforderlich, um eine Angleichung zu erzielen. An sich ist Pink eine eher weibliche Energie, bekommt dir jedoch ausgezeichnet: sie hilft dir bei der Balance – etwas, worüber wir uns später eingehender unterhalten werden. In deinem besonderen Fall bedeutet Pink: Risse in den Mauern, die dein Herz umschließen – den Mauern, die du aufgebaut hast, um dich vor emotionalen Verletzungen zu schützen. Das Pink, das du hier siehst, ist deine Farbe für liebende Hingabe in einer intimen Beziehung.«
Jonathan seufzte. Es geschah so viel auf einmal, daß er Mühe hatte, über alles gleichzeitig nachzudenken. Intime Beziehung? Wer konnte das sein? Paula. Er fühlte, wie sein Herzschlag aussetzte, als er daran dachte, wie er versuchen würde, sie zu treffen, wenn er und Ahmay auf ihrem Weg über den Korridor am Konferenzraum Nummer 4 vorüberkommen würden. Er wollte wieder mit ihr zusammensein, vor allem wollte er mit ihr über all das reden, was sie zu anderer Zeit an anderem Ort füreinander gewesen waren. Er vermißte sie.
Er schaute sich seine Herzgegend an. Schon nahm das Pink eine tiefere Färbung an.
»Alles in Ordnung?« fragte Ramda.
Jonathan nickte.
»Laß uns weitermachen. Das Himmelblau um deine Kehle steht für die Ausdrucksmöglichkeiten deines Selbst. Immer wenn deine Kehle sich eng anfühlt, mußt du dich fragen, für welche Regung deines Herzens oder welchen Gedanken du keinen Ausdruck findest. Es gibt ein energetisches Gesetz, 113das besagt: ›Alle Energie muß fließen‹. Dieses Prinzip muß befolgt werden, wenn dieser spezielle Leitpunkt seine Balance bewahren soll.
Der Punkt der dritten Wahrnehmungsstufe trägt die Farbe Indigo, die die Intuition stimuliert und deine Verbindung mit den mehrdimensionalen Aspekten deines Seins intensiviert.
Die Farbe Violett über deinem Scheitel zeigt deinen Leitpunkt zur Spiritualität und zu Gott an.«
Jonathan verwirrte die Vielfalt dieser Farben, doch dank Ramda sah er nun allmählich klarer. Bei der Erwähnung seines Scheitels schaute er in das Reflexionsgerät und bemerkte über seinem Kopf etwas Neues, eine größere Anzahl von Leitungspunkten. Sie waren klein und schwach und farblos. Ein Lichtstrahl entströmte seiner Schädeldecke. Das anfangs schmale Lichtbündel verbreiterte sich in der Aufwärtsbewegung.
»Was passiert da oben über meinem Kopf?« fragte er.
»Neue Leitungspunkte«, antwortete Ramda. »Sie verbinden dich mit den verschiedensten Aspekten deiner selbst und des Universums. Du wirst diese Energien nutzen, aber erst wenn deine Balance ausgeglichener sein wird. Als erstes mußt du an deinen Alltagsverbindungen arbeiten. Da gibt es viel zu tun.«
Jonathan nickte und schaute weiter in das Reflexionsgerät. »Wäre sicher schön, wenn mein Spiegel zu Hause so funktionierte.«
»Das könnte er«, sagte Ramda.
»So was habe ich in meinem Spiegel aber noch nie gesehen.«
»Was wolltest du denn darin sehen?«
»Meinen Körper.«
»Und genau den hast du gesehen«, sagte Ramda. »Auf ihn hatte sich deine Wahrnehmung eingestellt. Du hast dein 114Blickfeld eingeengt und konntest deshalb dein spirituelles Selbst nicht erkennen. Das ist nur Gewohnheitssache – eine Gewohnheit, die sich ändern läßt.«
Jonathan stand da und betrachtete die Reflexionen. Je länger er »dahinterblickte«, desto größer die Klarheit und Intensität der Farben. Kaum begann er jedoch darüber nachzudenken, was hier geschah, schienen die Farben zu verblassen und ganz zu verschwinden.
»Wenn das passiert«, fragte er, in der Annahme, Ramda wüßte, was er soeben gedacht hatte, »ist das Teil des Universalprinzips?«
Ramda lachte leise. »Das ist ja vorzüglich, Jonathan«, sagte er. »Es ist ermutigend, wie du dein Handeln nach der neuerworbenen Bewußtheit ausrichtest. Die meiste Zeit weiß ich tatsächlich, was du denkst. Es sind die Emotionen, mit denen wir Schwierigkeiten haben – sie eignen sich nicht zur Quantifizierung. Auf jeden Fall gratuliere ich dir zu deiner Bereitschaft, ein neues Bewußtsein auszuprobieren.«
»Danke«, sagte Jonathan mit sich selbst zufrieden.
»Um deine Frage zu beantworten«, fuhr Ramda fort, »ja, die Farben, die du gesehen hast, sind Reflexionen deiner Seele, und die werden von Universalprinzipien bestimmt.«
»Würdest du mir die Universalprinzipien erklären?«
Ohne Vorwarnung verschwand das Reflexionsgerät und wurde umgehend durch einen anderen, sehr viel größeren Apparat ersetzt. Das klare, plastische Bild auf seinem Monitor funkelte in dem Lichtstrahl, der sich aus der Wand ergoß. Der Apparat, der Jonathan in der Höhe um einiges überragte und eine Breite von etwa einem Meter achtzig hatte, erinnerte ihn an einen riesigen interaktiven Computer-Bildschirm. Im Hintergrund des Bildes schimmerte ein flirrendes Purpur, und am oberen Rand standen in goldenen Lettern die Worte »Kläre mich über die Universalprinzipien auf«. In 115der Mitte darunter las er: »Universalprinzipien«. Dazu waren vier getrennte Dialogfelder abgebildet, die alle mit einer anderen Aussage überschrieben waren. Sie lauteten: »Alles Ist Energie«; »Alle Energie Steht In Wechselseitiger Verbindung«; »Das Wesen Der Energie Ist Ihr Sein«; »Energie Strebt Immer Nach Balance«.
Jonathan sagte kein Wort, entschied sich jedoch, das Dialogfeld mit der Überschrift »Alles Ist Energie« zu wählen. Das Bild änderte sich und zeigte nun weitere Möglichkeiten auf. Er erkannte bald, daß der Computer die Fähigkeit besaß, unendlich viele, umfassende Informationen historischer, kultureller und wissenschaftlicher Art über Energie zu liefern. So schloß zum Beispiel ein Unterabschnitt zu dem Stichwort »Abendländische Naturwissenschaften« mit der Aussage: »Das Aufkommen des Elektronenmikroskops befähigte den Menschen schließlich zu der Erkenntnis, daß die Grundbausteine des Universums sich tatsächlich in ständiger Bewegung befinden.«
»Ich erwarte von dir nicht, daß du sämtliche Informationen auf dem Bildschirm auswendig lernst, Jonathan«, sagte Ramda. »Sie sind lediglich für den Fall gedacht, daß du sie zum Verständnis der Universalprinzipien benötigst.«
Jonathan nickte und drückte »Return«. Auf dem Monitor war wieder das Ausgangsbild zu sehen. Jonathan wählte das Dialogfeld mit der Überschrift »Alle Energie Steht In Wechselseitiger Verbindung«. Was folgte, war eine weitere verständliche Erörterung des Themas einschließlich der Einheitlichen Feldtheorie, Einsteins Relativitätstheorie, der Chaostheorie, der Hologrammtheorie, der Quantenmechanik und selbst des Prinzips vom Hundertsten Affen, demzufolge Information oder Energie innerhalb der Arten unabhängig von der räumlichen Distanz ausgetauscht wird, mit dem Ergebnis einer kritischen Massenexpansion des Wissens.
116
Ein Absatz aus diesem Unterabschnitt prägte sich Jonathan besonders ein: »Mit dem Aufkommen der Quantenphysik betrachtete die Forschergemeinschaft im späten zwanzigsten Jahrhundert das Universum und den Menschen nicht länger als bloße Konglomerate von Atomen, sondern entwickelte das Erklärungsmodell der ›Energiefelder im ewigen Wandel‹. Das Verständnis menschlicher Existenz wandelte sich von einem Kosmos aus Teilstücken, Dingen und Objekten zu einem ständig sich verändernden ›Ganzen aus miteinander verbundenen Energien‹. Jeder Mensch steht so mit jedem anderen Menschen, der Natur, dem Planeten und dem Universum in Verbindung. Das Universum ist eine Einheit aus aufeinander wirkenden, aneinander teilhabenden, Neues erschaffenden Energien.«
Er drückte »Return«, bereit zum nächsten geistigen Erkundungsgang mit dieser speziellen Hardware. Er fühlte sich gestärkt. Neugier bestimmte all sein Denken und Handeln. Wenn alles Energie ist, überlegte er, wie soll man dann eine Energieform von der anderen unterscheiden?
»Auf dieselbe Weise, wie ich deine Identität feststellen kann«, unterbrach Ramda. »Mit Hilfe der VF-Vibrationsfrequenz.«
Auf dem Bildschirm vor Jonathan leuchtete eine neue Darstellung auf mit der Überschrift: »Jede Energie hat ihre eigene unverwechselbare Vibrationsfrequenz«. Darunter ein weiteres Dialogfeld mit dem folgenden Menü: »Physisch«, »Emotional«, »Intellektuell«, »Spirituell« und »Persönliche Beispiele«. Er wählte das letzte.
Augenblicklich erschienen auf dem Bildschirm gestaltlose Bilder, die gleich darauf von den Farben des Regenbogens abgelöst wurden. In der Mitte des rechten Bildrandes waren von unten nach oben die Farben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett zu sehen. Am linken Rand standen Zahlen.
117
»Was haben diese Zahlen zu bedeuten?« fragte Jonathan.
»Sie stehen für Vibrationsfrequenzen. Beachte bitte, wie die Zahlen von unten nach oben ansteigen und die Farben sich von unten nach oben von rot nach violett verändern.«
»Einige Zahlen am oberen Bildrand haben aber keine entsprechenden Farben am rechten Bildrand. Warum nicht?« fragte Jonathan.
»Was du auf der rechten Seite des Bildschirms siehst, ist ein Lichtspektrum. Dort, wo du keine den Vibrationsfrequenzen auf der linken Seite entsprechenden Farben siehst, sind sehr wohl Energien vorhanden, die aber außerhalb des Wahrnehmungsbereiches des menschlichen Auges liegen, wie etwa Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen. Das ist ein visueller Ausdruck der Tatsache, daß es Wirklichkeiten gibt, die jenseits der fünf menschlichen Sinne liegen.«
Jonathans Augen weiteten sich. »Ah, ich verstehe. So ähnlich wie das Gehör des Hundes gegenüber dem des Menschen. Die Töne sind zwar da, nur, daß der Mensch sie nicht hören kann.«
»Genau«, sagte Ramda.
Die Regenbogenfarben erloschen, und es erschien eine Pauke. Jonathan berührte sie mit dem Mittelfinger. Ein tiefes, dumpfes »doooom« klang durch den Raum, doch dann begann die Pauke von allein, mit weichem, rhythmischem Schlag zu spielen. Danach kamen eine Violine, die die Hauptmelodie spielte, dann eine Oboe und eine Flöte, die zarte Gegenstimmen dazu entwickelten. Es traten noch verschiedene Musikinstrumente in Erscheinung, ehe schließlich ein Klavier auftauchte. Jonathan berührte es und lauschte, als das Thema der Violine aufgenommen wurde und das Klavier eine Vielzahl neuer Gegenmelodien hinzu improvisierte, die alle über eine Reihe von Überleitungen und Transpositionen zum Hauptthema zurückführten.
118
Jonathan wurde klar, daß er hier auf eine völlig ungewohnte Weise Musik hörte: Er konnte seine Aufmerksamkeit einem einzelnen Instrument, dem Zusammenspiel mehrerer oder auch dem gesamten Ensemble widmen. Das war es, worum er sich immer bemühte, wenn er selbst komponierte – hier jedoch gelang es ihm tatsächlich! Je nachdem, auf welches Instrument oder welche Instrumentgruppe er sich konzentrierte, veränderte sich sein Empfinden deutlich: die Pauke vermittelte ihm ein Grundgefühl der Körperlichkeit, das Klavier veranlaßte ihn zur Selbstbetrachtung, die Violine rief eine emotionale, die Flöte eine ätherische oder spirituelle Empfindung hervor.
Er bemerkte, daß am linken Bildrand Zahlen standen, die die Vibrationsfrequenzen der Musikinstrumente angaben. Ohne jede Vorwarnung veränderte sich die Darstellung auf dem Bildschirm, die Musik jedoch ertönte weiter aus dem Hintergrund.
Zuerst erschien ein Felsblock, dann eine sonnendurchglühte Schotterstraße, ein wunderbarer Bambusstock, ein Golden Retriever und zuletzt ein Mensch. Jedes neue Bild wies einen höheren VF-Wert auf. Danach zeigte der Bildschirm, wie sich die menschliche Gestalt, die soeben erschienen war, und ihre VF einander näherten und miteinander verschmolzen.
Als nächstes sah Jonathan sein eigenes Bild und seine VF auf dem Schirm. Daraus entwickelte sich eine vierdimensionale Darstellung seiner selbst mit unterschiedlichen VF-Angaben und den Farben Rot, Grün, Gelb und Violett.
»Verstehst du, was du da siehst?« fragte Ramda.
»Ich glaube schon«, sagte Jonathan. »Diese Farben habe ich am Anfang gesehen, als ich in deinen Lichtstrahl trat.«
»Das ist vollkommen richtig«, sagte Ramda. »So weit, so gut. Am Anfang, als du in meinen Lichtstrahl kamst, haben 119wir uns über die Farben der Energieleitpunkte unterhalten; jetzt unterhalten wir uns über die Farben von Energiesystemen. Du bestehst aus vier unterschiedlichen Energiesystemen, die zum Zweck dieser Übung nacheinander durch vier verschiedene Farben repräsentiert werden: das physische – dargestellt durch die Farbe rot; das emotionale – grün; das intellektuelle – gelb; das spirituelle – violett. Jedes dieser Energiesysteme hat seine eigene VF. Alle vier Systeme zusammengenommen bilden eine fünfte VF, aus der deine individuelle Identität geschaffen ist – von deiner Welt Jonathan Taylor genannt. Du bist eine eigene, einzigartige Energie, die ihrerseits zugleich mit der Gesamtheit aller Energien, der Göttlichen Wirklichkeit, in Verbindung steht. Und dieser gesamte Entwurf ist ein Beispiel eines Universalprinzips.«
Jonathan nickte. »Ich glaube, ich verstehe.«
»Wenn du also glaubst zu verstehen«, sagte Ramda, »jetzt folgt der wichtigste Teil.«
»Und was ist das?«
»Schau auf den Bildschirm.«
Im nächsten Augenblick war der Bildschirm leer, und die Musik verstummte. Die vier Farben erschienen in Form riesiger Rechtecke; über jeder Farbe lag der entsprechende VF-Wert.
»Wie du siehst«, fuhr Ramda fort, »bist du außer Balance; deine physischen, emotionalen und intellektuellen Bereiche sind weitaus dominanter als die spirituellen.«
Jonathan nickte und atmete tief. Allmählich verstand er. Die schmerzliche Leere, die er all die Jahre mit sich herumgetragen hatte, bekam endlich einen Namen. Die quälende Unzufriedenheit, die ihn von Chicago nach Key West und von dort nach San Diego getrieben hatte. Aus demselben Grund hatte er vergessen, wie man bei Tisch dankte: er hatte seine eigene Spiritualität preisgegeben. Bei anderen Menschen, 120selbst bei Mary, der Kellnerin im Hardee's, nahm er sie wahr. Doch ihm selbst bedeutete sie nicht mehr als eine intellektuelle Fingerübung – etwas, über das man nachdenken und es ernsthaften Erwägungen unterziehen mußte. Er hatte sich nicht in eine neue verwirrende, schuldgepeinigte Hölle wie jene stürzen wollen, durch die er dank der Religion gegangen war. Doch jetzt erkannte er seinen Irrweg. Spiritualität war etwas, woran er arbeiten mußte; ohne sie war er weniger, als er sein konnte; und das war schlecht.
»Mangelhafte Logik«, unterbrach Ramda. »Operator-Fehler.«
»Was?« sagte Jonathan. »Wer glaubst du eigentlich, wer du bist, in meine intimen Gedanken einzudringen?«
»Wir haben noch weitere Informationen zu erfassen«, sagte Ramda. »Du kannst keine Schlüsse aus unvollständigen Daten ziehen.«
»Wovon redest du da?«
Der Bildschirm flimmerte, und die Worte »Das Wesen Der Energie Ist Ihr Sein« erschienen.
»Warum sprichst du immer in Rätseln?« stöhnte Jonathan.
»Warum hörst du nicht mehr zu? Ich bin auf Ahmays Wunsch hier, um dir zu helfen, die Himmelsbar und dich selbst besser verstehen zu lernen. Damit werde ich nur dann Erfolg haben, wenn du mich deine Fragen nach den Universalprinzipien vollständig beantworten läßt.«
»Entschuldigung«, sagte Jonathan. »Ich dachte, du seist fertig.«
»Laß uns über das sprechen, was auf dem Bildschirm steht: ›Das Wesen Der Energie Ist Ihr Sein‹.«
»Genau das gleiche hat mir Ahmay über die Göttliche Wirklichkeit erzählt«, sagte Jonathan. »Heißt das, daß Göttliche Wirklichkeit und Energie ein und dasselbe sind?«
121
Ramda schwieg einen Augenblick. »Ja und nein. Ich will es dir erklären. Die Energien haben zwar alle unterschiedliche Vibrationsfrequenzen, sind jedoch durch die Göttliche Wirklichkeit miteinander verbunden. Daher sind Energie und Göttliche Wirklichkeit im Grund dasselbe. Kannst du mir folgen?«
»Ich glaube schon«, nickte Jonathan.
»Und nun zurück zu ›Das Wesen Der Energie Ist Ihr Sein‹. Wenn es auf der Erde keine Menschen gäbe, wer würde dann bestimmen, was Gut und Böse ist? Was, wenn zum Beispiel ein Atomteilchen ein anderes rammte oder eine Amöbe einen anderen Organismus verschlänge, wenn ein Löwe eine Antilope tötete und fräße, ein Hai eine Robbe verschlänge, oder wenn das Meer für die einen frischen Fisch bereithielte, die anderen aber in seinen Fluten ertrinken ließe? Am Himmel kollidieren die Sterne, neue werden geboren, Novae entstehen; ist das gut oder böse? Jedes Ereignis ist ein neues Beispiel von Energie, und jedes Ereignis ist Teil der Göttlichen Wirklichkeit. Die Frage nach Gut oder Böse wird lediglich durch den Menschen aufgeworfen. Stimmst du mir zu?«
Jonathan zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist etwas komplizierter.«
»Du hast recht«, sagte Ramda. »Das war eine kluge Antwort. Meine Frage ist etwas komplizierter. Aber du wirst doch zugeben, daß die Menschen, wie es in dem Song ›Nights in White Satin‹ heißt, ›bestimmen, was recht ist und was bloßer Wahn‹? Sie mögen recht oder unrecht haben, sie geben Wertungen ab. Ist das nicht eine korrekte Aussage?«
»Das ist eine korrekte Aussage.«
»Und genau darauf will ich hinaus. Indem sie werten, beschränken sie sich und andere. In diesem Fall: Ich habe dich unterbrochen, als du dir sagtest, ohne Spiritualität seist du ein schlechter Mensch. Es wäre mir lieber, wenn du darüber 122nachdenkst, diese Aussage dahingehend neu zu formulieren, daß ›Jonathan Taylor ohne Spiritualität außer Balance ist‹.«
Jonathans Augen weiteten sich. »Balance? Was bedeutet das?«
»Das letzte Universalprinzip lautet: ›Alle Energie Strebt Nach Balance‹. Balance ist der Naturzustand des Universums – wie der Kreis. Ein vollkommener Kreis ist immer im Gleichgewicht. Der Planet Erde befindet sich aufgrund seiner gegensätzlichen Pole und seiner Balance zwischen der Sonne und den anderen Planeten eures Sonnensystems immer im Gleichgewicht. In der Elektronik gibt es einen positiven und einen negativen Pol. Im Menschen gibt es eine helle und eine dunkle Seite. Beide Seiten zusammen stellen das Gleichgewicht her. Wie das Beispiel des Kreises zeigt, ermöglicht es die Balance allen Dingen, nach endgültiger Klarheit, nach der Vervollkommnung ihrer selbst zu streben. Ohne Balance führen alle Dinge – auch der Mensch – ein unharmonisches Leben. Durch Balance wird Vervollkommnung oder Einssein möglich: Einssein mit dem Schöpfer, Gott, der Göttlichen Energie, der Universellen Kraft – welchen Begriff du auch verwenden magst.«
Jonathan dachte einen Augenblick nach. Er spürte, wie er müde wurde. Doch er wollte die Unterhaltung zu Ende führen. Ahmay hatte recht: Manchmal war die Sache ziemlich anstrengend.
»Das erscheint mir logisch«, sagte er. »Es ist genau wie in der Musik: Ohne Balance zwischen den einzelnen Orchesterteilen leidet die Harmonie, die Kontrapunktik, die Durchführung der Themen, die Perfektion. Auch wenn man nur ein einzelnes Instrument für sich betrachtet, sagen wir das Klavier zum Beispiel, dann hätte eine Komposition weniger Tiefe, würde sie in der Hauptsache mit nur einer Hand oder in nur einer Oktave gespielt.«
123
»Genau«, sagte Ramda. »Hinzu kommt, daß die Vorstellung von Gut und Böse die Spaltungstendenzen fördert. Die Gefühle von Isolation und Bindungslosigkeit sind nur eine Folge davon. Dies widerspricht den Prinzipien, über die wir uns bereits unterhalten haben: ›Alles Ist Energie‹ und ›Alle Energie Steht In Wechselseitiger Verbindung‹. Wenn alles miteinander in Verbindung steht, dann ist Bindungslosigkeit ausgeschlossen.« Ramda hielt inne. »Kannst du mir folgen?«
Jonathan nickte, konnte jedoch kein Wort hervorbringen. Plötzlich überfiel ihn die Einsamkeit; er kämpfte mit den Tränen. Die Worte »Spaltung«, »Bindungslosigkeit« und »Isolation« hallten wieder und wieder in seinem Gedächtnis nach. Das bist du, Taylor, dachte er. Abgespalten, bindungslos und isoliert. Du lebst allein, hast keine Frau, keine Freundin, keine Kinder, gehst Tag für Tag zur Arbeit, machst dich kaputt und sprichst kaum einmal mit jemandem. Selbst deine Nachbarn kennst du kaum. Du bist völlig allein, Taylor. Du bist Mister Isolation. Wie konntest du deinen Karren bloß so in den Dreck setzen?
Ich schätze, dachte er, es hat eine ganze Menge mit meiner Erziehung zu tun. Naja, das stimmt nicht so ganz. Komm schon, jetzt klingst du schon so wie die Leute, die du in Chicago beraten hast – an allem waren immer nur die anderen schuld. Du kannst deine Eltern oder die Kirche oder deine Erziehung nicht für deine Isolation verantwortlich machen; du hast schließlich die Wahl getroffen. Es stimmt, daß Spaltung auf der Welt eine große Rolle spielt. Es beginnt mit »gut« und »böse« und führt von da aus über: Satan gegen St. Michael; Katholiken gegen Protestanten; Christentum gegen Atheismus; Liberale gegen Konservative; Nord gegen Süd; Totalitarismus gegen Demokratie; Freiheit gegen Sklaverei. Doch du, Taylor, du bist derjenige, der die Wahl hat, diese Ideen aufzunehmen, zurückzuweisen oder in ihnen aufzugehen. 124Du und sonst niemand. Es fällt einfach schwer, zuzugeben, daß du so viele deiner siebenunddreißig Jahre »außer Balance« gelebt hast, so einsam und allein. So … unvollkommen.
»Alles in Ordnung?« fragte Ramda.
Jonathan nickte. »Ich glaube …« Er schluckte. »Also ist Energie nur einfach da«, sagte er. »Weder ›gut‹ noch ›böse‹; nur ein Sein. Ungefähr so wie die Gefühle. Das habe ich damals als Therapeut gelernt. Gefühle sind weder gut noch böse; sie sind einfach. Was wir daraus machen, das zählt. Genauso ist es mit der Energie: Alles ist Energie, es steht miteinander in Verbindung und ist einfach da. ›Gut‹ und ›böse‹ sind Wertungen, nicht Energie. Energie kann außer Balance geraten, doch das ist ein unnatürlicher Zustand, weil alle Dinge von Natur aus nach ihrer Vollendung streben – nach ihrer höchsten und angemessensten Bestimmung sozusagen.«
»Wieder richtig, Jonathan«, sagte Ramda. »Du machst wirklich Fortschritte. Jetzt wollen wir über den Unterschied zwischen Spaltung und Dualität sprechen.«
»Was ist Dualität?«
»Dualität ist ein Aspekt der Wirklichkeit«, sagte Ramda, »ein Bestandteil der Universalprinzipien, der unabhängig davon existiert, ob er erkannt wird oder nicht. Die Spaltung ist lediglich eine Glaubenssache, die oft mehr als alles andere mit der Wahrnehmung zu tun hat. Der Gedanke der Dualität jedoch beruht auf der Voraussetzung, daß in jedem Augenblick alles gegenwärtig ist, dann ist alles Eins, und jedes Teil muß das Ganze in sich tragen.
Das aber bedeutet«, fuhr Ramda fort, »daß jeder Augenblick deines Erlebens, jeder Gegenstand deiner Betrachtung und jeder Mensch, mit dem du Umgang hast, sein eigenes Ganzes, seine Balance oder Vollkommenheit in sich trägt.
125
Wenn du glaubst, die Verbindungen zu deiner Welt seien abgebrochen, wird sich diese ›self-fulfilling prophecy‹ scheinbar bewahrheiten. Du wirst die Isolation deiner Welt schmecken, spüren, sehen, aber das ist eine Illusion. Dualität besagt, daß alles Teil der Einheit ist; alles existiert zugleich.«
Jonathans Gesicht verfinsterte sich. »Soll das heißen, daß das was du siehst, nicht das ist, was es zu sein scheint, sondern daß in Wirklichkeit viel mehr dahintersteckt?«
»Erinnerst du dich noch daran, wie du mit Ahmay über den Satz ›Deine Wahrnehmung ist deine Wirklichkeit‹ diskutiert hast?«
»Ja.«
»Genau darum geht es«, sagte Ramda. »Deine Wirklichkeit beruht auf deiner Wahrnehmung. Verändere deine Wahrnehmung, und du veränderst deine Wirklichkeit. Hast du das jemals versucht?«
Jonathan dachte einen Augenblick nach. »Ich glaube schon«, sagte er dann. »Ich erinnere mich, wie ich einmal ein Auto kaufen mußte und deshalb eine Straße in San Diego entlangging, die ›die Automeile‹ genannt wird, weil die Händler dort auf alle möglichen verschiedenen Automarken spezialisiert sind. Ein Geschäft bot einen Wagen einer Marke an, von der ich noch nie gehört hatte: einen Miada, ein nettes kleines zweisitziges Sportkabrio. Als ich dem Verkäufer erzählte, daß ich diesen Wagen nie zuvor gesehen hätte, lachte er. Er sagte mir, das Auto sei schon über ein Jahr auf dem Markt und es wäre mit Hilfe einer millionenteuren Werbekampagne in Zeitungen und Zeitschriften wie auch in Rundfunk und Fernsehen hochgepuscht worden. Das kam mir seltsam vor, bis ich dann nach Hause fuhr. Auf dem Weg erinnere ich mich, vier Miadas gezählt zu haben. Ich nehme an, meine Wahrnehmung hatte sich verändert.«
»Das ist eine zutreffende Analogie zum Begriff der Wahrnehmung«, 126sagte Ramda. »Doch den folgenden Aspekt der Dualität wirst du möglicherweise nur schwer nachvollziehen können: Wenn du etwas siehst, das du als gut bezeichnen würdest – zum Beispiel jemanden, der einer Gemeinschaft aus der Not hilft und dafür vergöttert wird, bedenke, daß es da im selben Augenblick eine dunkle Seite gibt. Und umgekehrt, wenn du den Fernseher anstellst und die Grausamkeit eines Individuums siehst, mußt du wissen, daß es auch eine warmherzige, liebevolle Seite dieses Menschen gibt. Das ist Dualität. Sie ist Teil des Balance-Gedankens. Das Leben ist nie ein Entweder-Oder, sondern immer ein Sowohl-Als-Auch. Alle Energie ist im Zustand der Balance. Du, Jonathan, stehst vor der Herausforderung, deine Wahrnehmung zu verändern und die Balance zu suchen, sie zu leben und zu empfinden.«
Und wie soll ich das machen? überlegte Jonathan. Es wäre ja schön, wenn etwas von diesem Theorieexkurs mir helfen würde, mein Problem beim Vorspielen zu lösen.
»Du wirst die Bedeutung sehr bald verstehen«, sagte Ramda. »Bleib erstmal noch ein wenig bei mir. Ein paar Punkte vorweg.
Es stellt sich die Frage, was zu tun ist, wenn etwas, besonders ein Mensch – sagen wir, du selbst – außer Balance ist. Unser Gespräch entwickelte sich aus deiner Feststellung, etwas, das du getan hattest, sei ›schlecht‹. Ich regte an, du solltest dich genauer ausdrücken, indem du dein Verhalten als außer Balance bezeichnetest. Du fragst dich nun vielleicht, was kann ich tun, um zur Balance zu kommen? Wie mache ich das?«
Jonathan schüttelte den Kopf und warf die Hände in die Höhe. »Wenn man doch mal einen Gedanken für sich behalten könnte«, sagte er heiter. »Ich habe das Gefühl, als stünde ich ohne Kleider hier.«
127
Ramda kicherte. »Für mich tust du das auch.«
»Ein Computer mit Sinn für Humor. Sieh mal einer an!« Jonathan schwieg einen Augenblick. »Natürlich hast du recht. Wie kann ich also meinen Mangel an Balance ausgleichen?«
»Indem du die dunkle Seite ans Licht bringst«, erwiderte Ramda. Der Bildschirm erwachte zum Leben. Videoaufnahmen des Mondes und der Erde liefen nebeneinander ab. Langsam holte die Kamera beide in Nahaufnahme heran. »Diese zwei Planetenkörper sind treffende Beispiele zu unserer Frage. Die dunkle Seite des Mondes kennt die Sonne nicht; sie ist abgespalten und isoliert. Das Ergebnis ist ein Ort der Ödnis und der Kälte, an dem es fast kein Leben gibt. Die Erde aber ist auf ihrem Umlauf mit all ihren Seiten dem Licht der Sonne ausgesetzt. Das Ergebnis ist ein fruchtbarer, vor Leben blühender Planet, auf dem sich Wachstum und Überfluß entfalten.« Die Kamera zeigte nun die unterschiedlichen Oberflächen beider Planeten im Vergleich. »Sind wir uns da einig, Jonathan?«
»Und wie soll ich meine dunkle Seite ans Licht bringen?« fragte er.
»Indem du nicht in dem Glauben lebst, die dunkle Seite sei von dir abgespalten; indem du von der dunklen Seite lernst; doch vor allem, indem du über sie sprichst«, sagte Ramda. »Indem du dich nicht davor fürchtest, dir ihre Existenz und den Grund ihrer Existenz einzugestehen. Das ist der Weg. Wenn sie erst einmal ins Licht menschlicher Worte gerückt ist, wird sie weniger mächtig erscheinen und weniger schwierig ins Gleichgewicht zu bringen sein.«
»Hmmm«, machte Jonathan. »Darüber muß ich erst nachdenken.«
»Das Allerwichtigste ist, daß du dir das Wort PEIS merkst.«
128
»Ist das so was wie ein Geheimcode?« fragte Jonathan scherzhaft.
»So ungefähr«, sagte Ramda. »Genaugenommen bedeutet es: das Physische, das Emotionale, das Intellektuelle und das Spirituelle – das, was sich beim Menschen in der Balance befinden muß.«
»Wie kannst du denn das wissen? Du bist ein Computer. Was weißt du schon über das menschliche Dasein?«
»Jonathan … ich bin weit mehr als ein Computer.« Er zögerte. »So viel kann ich dir sagen: Ich war einst ein Mensch. Ich glaube, ich weiß eine ganze Menge über das menschliche Dasein. Doch ob du mir glaubst oder nicht spielt für die Wahrheit meiner Worte keine Rolle. PEIS – darauf kommt es an; auf die Balance zwischen allen vier Bereichen.«
Jonathan seufzte. »Das klingt, als hätte ich für die nächsten paar Minuten genug zu tun.«
Wieder kicherte Ramda.
Der Bildschirm leerte sich, dann erschienen neue Sätze: »Bedenke, daß jeder einzelne sich mit der ihm gemäßen Geschwindigkeit seiner Balance annähert. Du bist ewig. Warum so hastig?«
»Heißt das, ich kann die Hände in den Schoß legen und nichts tun?«
»Aber sicher, wenn du das willst«, gab Ramda zurück. »Nur denk daran, daß alles Energie ist. Energie ist immer in Bewegung – entweder auf die Balance zu oder von der Balance fort. Beim Menschen bedeutet das entweder Seelenfrieden oder Angst; niemals kannst du beides zu gleicher Zeit empfinden. Wenn du dich dafür entscheidest, dich allzulange zurückzulehnen und nichts zu tun, wirst du mit aller Wahrscheinlichkeit außer Balance geraten und dich äußerst unbehaglich fühlen.« Er hielt inne. »Da ich weiß, daß du es nicht gerne siehst, zögere ich, deine eigenen Gedanken zu zitieren.«
129
»Warum einen absoluten Rekord brechen, Ramda? Wo du grad so schön am Zug bist.«
»Hast du mit dir selbst nicht von einer ›quälenden Unzufriedenheit‹ gesprochen, nachdem wir uns darüber unterhalten hatten, wie der Mensch durch einen Akt des Willens über die Verteilung seiner Gesamtenergien auf das physische, das emotionale, das intellektuelle und das spirituelle Energiezentrum entscheidet?«
»Das stimmt.«
»Dann weißt du also bereits, worüber ich spreche. Die Kehrseite der Medaille ist folgende. Wenn du wie ein Huhn ohne Kopf herumrast, in der Hoffnung, deinen eigenen Erwartungen gerecht zu werden, wirst du wahrscheinlich den Intellekt im Vergleich mit den übrigen Energiezentren überbetonen. Auch das wird ein Ungleichgewicht bewirken.«
Jonathan streckte sich und gähnte. »Ich langweile mich nicht, Ramda. Mein System ist nur überladen. Ich glaube, ich brauch eine Pause. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Mal abgesehen davon, daß ich meine ›dunkle Seite‹ mit anderen diskutiere und erforsche, was kann ich sonst noch tun, um mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen?«
»Weiter meditieren und dich entspannen. Wenn du an den Punkt kommst, an dem du jetzt bist – entmutigt von der allzugroßen Anstrengung – und dich einfach entspannst und dich fallenläßt, dann kann es sein, daß du deiner Balance ein ganzes Stück näherkommst und es nicht einmal merkst. Dann geschieht es nämlich, daß du dir selbst erlaubst, auf deinen Körper zu hören, deine Emotionen zu empfinden und deine Intuition zu spüren. Auf die Außenwelt machst du einen untätigen Eindruck, doch in Wirklichkeit tust du eine Menge. Schriftsteller, Maler und Komponisten könnten anders gar nicht arbeiten. Das ist ein wesentlicher Abschnitt der Reise, und er heißt ›seinen Gedanken freien Lauf lassen‹.«
130
Jonathan schüttelte verwirrt den Kopf. »Was?«
»Fasse zusammen, was wir bisher besprochen haben«, sagte Ramda.
»Jetzt?« fragte Jonathan. Ohne ersichtlichen Grund hatte er plötzlich Angst, genau wie zu Anfang, als er die Himmelsbar betrat. »Ich bin ein wenig überwältigt von alldem. Können wir eine Pause machen?«
Im Raum war es still. Jonathan bemerkte, daß Ahmay fortgegangen war.
»Natürlich«, sagte Ramda. »Ich verstehe, daß das für dich ein bißchen viel auf einmal ist.« Er kicherte. »Du kannst jetzt Paula suchen gehen. Das hast du doch in Wirklichkeit vor, oder?«
Jonathan errötete und mußte über sich selbst lachen.
131
»Du kannst keine Verbindung eingehen … ehe du dich
von deiner Angst gelöst hast.«
Jonathan trat aus Ramdas Lichtstrahl in den leeren Überleitungsraum. Ihm fiel ein, daß Ahmay gesagt hatte, er werde möglicherweise in die Bar gehen, um sich mit Zorinthalian zu unterhalten. Jonathan war geistig völlig erschöpft von seiner Sitzung mit Ramda, doch nun umklammerte die Angst plötzlich jeden seiner Gedanken. Es war dieselbe panische Furcht, die ihn in die Himmelsbar getrieben hatte. Er fühlte, daß sein Verfolger wieder in der Nähe war und ihn verletzen, vielleicht sogar töten wollte. Aber niemand außer ihm war in diesem Raum.
»Ja … das stimmt«, sagte Jonathan und stürzte zum Waschbecken. Er mußte etwas Kaltes trinken. Ein kleiner Imbiß oder ein bißchen Obst würden auch nicht schaden. Vielleicht war sein Blutzucker ein wenig abgesackt, und er sah Gespenster. Was sollte schon passieren? Er war in der Himmelsbar. Hier konnte ihm niemand etwas tun, oder?
Auf der Suche nach einem Glas öffnete er die Schranktüren und fand ein sauberes, leeres Marmeladenglas. Er füllte Wasser hinein, setzte sich in einen der Clubsessel und trank. Seine Hände zitterten so stark, daß er Mühe hatte, nichts zu verschütten.
In diesem Moment öffnete sich die Tür, und herein kam 132derselbe Hilfskellner, der hinter der Theke gestanden hatte, während Jonathan sich mit Zorinthalian unterhielt. Er trug ein Gestell mit sauberen Gläsern. Von Jonathan nahm er keine Notiz, starrte in Ramdas Lichtstrahl und ging dann auf die Schränke neben dem Waschbecken zu.
Jonathan sprang auf und lief auf die gegenüberliegende Seite des Raumes, wo er sich hinter einer Couch verbarg. Aufgepaßt, Taylor, sagte er sich. Da ist irgend 'ne faule Sache im Gang. »Ahmay!« schrie er laut. »Ich brauch dich jetzt hier!« Er suchte den Raum nach einem Gegenstand ab, mit dem er sich hätte verteidigen können; er war sicher, daß der Barkeeper jeden Augenblick auf ihn losgehen würde.
Der Barkeeper ging seiner Arbeit nach und warf hin und wieder einen kurzen Blick auf das Lichtbündel, das der Wand entströmte. Er stellte die sauberen Gläser in den Schrank und öffnete eben die Tür, als Ahmay hereintrat. Die beiden Männer machten einen Bogen umeinander.
»Ist alles in Ordnung?« wandte sich Ahmay an Jonathan, als er nähertrat und Jonathan in der Ecke kauern sah.
Jonathan gab keine Antwort. Er war ganz damit beschäftigt, den Raum zu beobachten, und wartete darauf, daß sich der unsichtbare Angreifer verraten würde. Dabei hielt er das fast leere Marmeladenglas so fest umklammert, daß seine Finger schon ganz weiß wurden.
Der Hilfskellner war verschwunden, und das Gefühl, daß sich irgend etwas Furchtbares ereignen werde, wurde schwächer; doch noch immer hatte Jonathan das Gefühl, daß ihn jemand verfolgte. Der Kellner kann es nicht sein, sagte er sich. Irgend jemand anders ist hinter mir her.
»Was ist los?« fragte Ahmay. »Ist irgendwas hier drin passiert? Du siehst so kampfbereit aus.«
»Irgend jemand ist hier drin«, sagte Jonathan mit zitternder Stimme, und seine Blicke irrten hin und her.
133
»Was meinst du damit?« sagte Ahmay verwundert. Er ging zu Jonathan hinüber. »Hast du etwas gesehen?«
»Ich kann ihn fühlen. Es ist genau wie zu Anfang, als ich in die Bar kam. Ich wußte, daß er das ist; ich konnte ihn bloß nicht sehen.«
»Ich verstehe«, nickte Ahmay. Er strich sich das lange schwarze Haar hinter die Ohren. »Und wie fühlst du dich jetzt, in diesem Moment?«
»Jetzt geht es mir besser. Aber ich weiß, daß es nur ein Trick ist. In dem Augenblick, wo du weggehst, wird er sich wieder zeigen. Während wir miteinander reden, versteckt er sich irgendwo hier drin.«
»Also schön, dann wollen wir nach ihm suchen.«
Die beiden Männer öffneten alle Schränke, untersuchten jedes Möbelstück und öffneten alle Türen. Es war niemand da.
Jonathan schüttelte den Kopf. »Anscheinend drehe ich durch«, sagte er. »Du mußt mir einfach glauben: es ist jemand hier drin. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas sicherer gewußt. Ich fühle noch jetzt seine Gegenwart. Ich bilde mir das nicht nur ein, Ahmay.«
»Ich glaube dir.«
»Ich hab dich nicht hergerufen, um irgendwelchen Phantomen nachzujagen.«
Ahmay lachte leise. »Das weiß ich.« Er schwieg und lächelte in sich hinein, während er sich in einem der Clubsessel niederließ. »Phantome jagen kann durchaus Spaß machen, aber … das ist eine andere Geschichte. Du hast mich wieder hergerufen, weil du zu Tode erschrocken warst. Genau darum hatte ich dich gebeten, und genau das hast du getan. Die Frage ist: Was machen wir jetzt?«
Jonathan setzte sich in den Sessel neben ihm. Aus irgendeinem Grund fühlte er sich entspannter, weniger ängstlich. 134»Naja, ich hoffe sehr, daß du ein wenig Licht in dieses ganze Chaos bringen kannst. Ich tappe im dunkeln, und außer Ramda ist sonst niemand da.«
Ahmay räusperte sich. »Ich glaube, du mußt mit Ramda sprechen. Ich verspreche dir auch, diesmal die ganze Zeit über hierzubleiben. Da ich weiß, daß du es eilig hast, empfehle ich dir Ramda, er kann dir am besten helfen.«
Jonathan schloß die Augen und schüttelte den Kopf. Dann holte er lange und tief Luft. »Schon gut, schon gut, ich werde mit Ramda sprechen. Du verlangst ein bißchen viel, Ahmay. Du hast mich gebeten, dir zu vertrauen, und ich habe es dir versprochen. Es wäre aber nicht schlecht, wenn Ramda jetzt ein paar Antworten parat hätte, denn sonst müssen wir uns noch mal ganz von vorn über das Vertrauen unterhalten.«
»Das ist ein faires Angebot«, sagte Ahmay.
Ohne ein weiteres Wort stand Jonathan auf und begab sich wieder in das helle Lichtbündel, das noch immer der Wand entströmte.
»Ramda«, sagte Jonathan, »ich brauche deine Hilfe.«
Der Lichtstrahl flackerte, und es ertönte ein Surren wie bei einem Kurzschluß. Seltsame Mißtöne drangen aus dem Strahl.
»Beruhige dich«, riet ihm Ahmay. »Erst wenn du dich beruhigst und dich von deiner Furcht befreit hast, kannst du die Verbindung zu Ramda herstellen. Das erhöht deine VF.«
Jonathan kämpfte gegen seine Gefühle an, um sich konzentrieren zu können. Er wußte, daß Ahmay recht hatte. Also gut, tief durchatmen, dachte er. Denk an den Lake Shawano und wie du mit Papa Fischen warst – das war eine entspannende Zeit. Gut so, gut so, es geht mir schon besser.
»Willkommen zurück«, sagte Ramda. »Das ging schnell.«
»Ich habe ein Problem«, sagte Jonathan. »Ich brauche deine Hilfe.«
135
»Ich weiß«, sagte Ramda. »Doch zuerst wollen wir auf das zurückkommen, worum ich dich bat, ehe du eine Pause einlegen wolltest.«
»Du batest mich, das zusammenzufassen, was wir besprochen hatten?«
»Genau.«
Jonathan schloß die Augen. Wie er es beim Meditieren gelernt hatte, löste er sich innerlich von all der Angst und Furcht, die er soeben empfunden hatte. Dann rief er sich ins Gedächtnis, wie er und Ramda mit der Göttlichen Wirklichkeit und seiner eigenen Seele begonnen hatten. Danach ging es um … mal nachdenken – ach ja, um Energie und Universalprinzipien. Als nächstes war die Vibrationsfrequenz (VF) dran und das PEIS in allen Energien, besonders beim Menschen. Dann kam die Balance als natürlicher Zustand des Universums, dann … was kam dann? Aha – der Unterschied zwischen Spaltung und Dualität. Danach sind wir auf einen Satz von Ahmay zurückgekommen: Deine Wahrnehmung ist deine Wirklichkeit. Und zum Schluß ging es um … laß mich nachdenken – ach ja … den Zweck des Ganzen: Alles strebt nach Balance.
»Ja«, sagte Jonathan und konzentrierte sich mit noch immer geschlossenen Augen auf seine Gedanken, »ich glaube, ich kann mich an das meiste erinnern, worüber wir diskutiert haben.«
»Das stimmt«, sagte Ramda. »Öffne die Augen.«
Während Jonathans Augen geschlossen waren, war der Computer-Monitor wieder erschienen und flimmerte nun hell. Jeder seiner Gedanken von eben war in großen goldenen Lettern vor purpurnem Hintergrund auf dem Bildschirm erschienen. »Um Gottes willen, Ramda, hättest du mich nicht wenigstens vorher warnen können? Wird von nun an alles, was ich denke, auf diesem Bildschirm zu sehen sein?«
136
Ramda lachte leise. »Nein, Jonathan. Ich möchte bloß etwas festhalten. Was du da auf dem Bildschirm siehst, ist die visuelle Manifestation eines weiteren Gesetzes der Energie. Es lautet: ›Energie Erschafft Form‹ – in diesem Falle Gedanken.«
»Großartig!« sagte Jonathan. »Das erklärt alles. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, daß ich dich gefragt habe. ›Gedanke Erschafft Form‹, ja? Jetzt verstehe ich vollkommen, warum ich glaube, daß mich jemand umbringen will und warum in diesem Raum hier Leute sind, die gar nicht da sind. Brillant, Ramda. Ganz einfach brillant.«
»Wirst du ein bißchen gereizt, Jonathan?«
»Das kann man wohl sagen. Außerdem hab ich es satt, Fragen zu stellen und dann statt Antworten Rätsel vorgesetzt zu kriegen!«
»Sag mal, hast du je in Ruhe darüber nachgedacht, daß du womöglich die Antworten bekommst und sie nur nicht verstehst? Oder daß du dir nicht die Mühe machst, sie genügend zu durchdenken, wenn du sie zu hören bekommst? Wenn die Antworten so einfach zu begreifen wären, dann würdest du doch jetzt keine Hilfe brauchen, oder?«
»Ja, das ist wahr. Ich erkenne, daß ich womöglich selbst die Ursache all meiner Mißverständnisse bin, doch diese Erkenntnis nützt mir nichts, da meine Zeit hier so kurz bemessen ist. Ich möchte verstehen. Wirklich.«
»Wir wollen beim Denken anfangen. Verstehst du, was ich mit dem Satz ›Gedanke Erschafft Form‹ meinte?«
»Nicht genau. Es hört sich an, als wolltest du sagen, daß Gedanken Energien seien, die meinen Körper verlassen und sich dann im physischen Bereich manifestieren.«
»Du bist nahe dran«, sagte Ramda. »Alles Ist Energie, einschließlich der Gedanken. Und wie du weißt, hat alle Energie eine Vibrationsfrequenz oder VF. Laß uns ein hypothetisches 137Beispiel wählen. Nehmen wir Gewalt in der amerikanischen Gesellschaft. Es beginnt mit Ignoranz: mit der Ansicht, daß Gewalt ein geeigneter Weg zur Problemlösung sei. Dieser Gedanke nun hat seine eigene VF. Dieser Gedanke hat weder Energie geschaffen noch Energie zerstört. Er hat der Energie lediglich eine neue Form gegeben – eine neue Vibrationsfrequenz.
Da alle Energie in wechselseitiger Verbindung steht, hat dieser Gedanke nun zweierlei Folgen. Zum einen wird er im Individuum eine Neuverteilung der PEIS Energiesysteme bewirken; danach wird das Individuum in Übereinstimmung mit diesem Gedanken handeln. Der Gedanke wird so lange in statischem Zustand verharren, bis ein anderer Gedanke ihn entweder verändert oder zu ihm im Widerspruch steht. Bis zu diesem Grade wird also dieser neue Gedanke, daß Gewalt ein annehmbares Verhalten zur Lösung von Konflikten sei, im Individuum verbleiben. Mit anderen Worten: Im Grunde ist der Mensch das, was er denkt.« Ramda zögerte. »Soweit einverstanden?«
»So weit, so gut«, gab Jonathan zurück.
»Danke. Zum zweiten wird mit dem Gedanken folgendes geschehen: Er wird mit dem Rest des Universums in Verbindung treten. Da alle Energie ihre eigene VF besitzt und danach strebt, sich mit anderen Energien gleicher VF zu vereinigen, wird diese umformatierte Energie darüber hinaus neue Verbindungen mit Energien gleicher VF eingehen. Dieser Prozeß der Neuanbindung wiederum ist ein weiterer Beweis dafür, daß der Gedanke Form erschafft.« Wieder hielt Ramda inne. »Noch immer einverstanden?«
Jonathan nickte. »Ich sehe noch immer nicht ein, was das alles mit mir und meiner Angst zu tun hat.«
»Wir haben es gleich geschafft. Unser hypothetisches Beispiel geht davon aus, daß Gewalt eine annehmbare Lösung 138von Konflikten darstellt. Dieser Gedanke ist außer Balance und wird sich auf die Suche nach weiteren Energien von annähernd derselben VF begeben, die sich ebenfalls außer Balance befinden. Schließlich wird das von Gewalt geprägte Verhalten der Individuen untereinander zur Folge haben, daß auch im weiteren Umfeld die Balance verlorengeht. Diese Gedanken werden mit ähnlichen VF verschmelzen und sich in familiärer Gewalt äußern, in Gewaltverbrechen, in Bandenkriminalität, in bürgerkriegsähnlichen Konflikten wie in Irland, Bosnien und Ruanda, im Genozid und schließlich in regionalen Kriegen und Weltkriegen.«
Ramda schwieg, während Jonathan über diese These nachdachte.
»Was das Denken also hervorbringt«, fuhr Ramda fort, »ist eine Variation des beliebten amerikanischen Sprichwortes: Du mußt nur fest genug an etwas glauben, dann bekommst du es auch. Zwei einfache Beispiele aus dem, was ihr Kino nennt, drängen sich dazu auf: In ›Peter Pan‹ bringt Peter die Kinder dazu zu fliegen, indem er sie davon überzeugt, daß sie es können; und sie tun es. In ›The Music Man‹ bringt Professor Harold Hill die Kinder dazu, zu musizieren, indem er die ›Gedanken-Methode‹ anwendet. Obwohl sie keine wirkliche musikalische Ausbildung gehabt haben, glauben sie, auf ihren Instrumenten spielen zu können; also tun sie es. Jonathan, siehst du nun eine Verbindung zu deiner Situation?«
Wieder tat Jonathan einen langen, tiefen Atemzug. »Ich glaube, ja. Du willst damit sagen, daß die Furcht und die Panik, die ich noch vor wenigen Augenblicken empfunden habe, irgendwie durch mein Denken hervorgerufen wurden?«
»Richtig.«
»Und da ich weiß, daß ich keine derartigen Gedanken gehabt 139habe, müssen sie von irgend jemand anderem gekommen sein. Daher muß die Frage lauten: wer hat diese Gedanken gedacht, die mir das Gefühl gaben, mein Leben sei in höchster Gefahr? Ist das richtig?«
»Nein, das trifft es nicht.«
»Na gut, was dann?«
»Du wirst dir die Antwort selber geben müssen«, sagte Ramda. »Bedenke, daß ich weder dein Vater oder deine Mutter, noch dein Vormund bin. Meine Aufgabe ist es nicht, dich vor dir selbst zu schützen, sondern dir den Weg zu weisen. Im Grunde aber ist es deine Reise.«
»Warum willst du meine Frage nicht beantworten?«
»Das habe ich schon getan.«
Jonathan begann, die Hände auf dem Rücken, auf und ab zu laufen, blieb aber im Licht. »Das hast du schon getan, ja? Ich sehe, ich muß mir noch ein paar Gedanken machen. Ich will dir noch eine Frage zum Thema Denken stellen. Was ist mit der Sprache? Wenn ich einen Gedanken habe und ihn nicht ausspreche, hat das dieselbe Wirkung, wie wenn ich es täte?«
»Ausgezeichnete Frage. Worte haben einen ungeheuren Einfluß auf die Wirkung eines Gedankens. Indem du deine Gedanken aussprichst, verstärkst du sie, weil du ein intellektuelles Bemühen in eine physische Form bringst. Der Akt des Sprechens verleiht dem Gedanken nur noch mehr Macht. In deiner Welt können ausgesprochene oder geschriebene Gedanken hinsichtlich ihrer formbildenden Wirkung in etwa hundertmal so machtvoll sein wie unausgesprochene oder ungeschriebene Gedanken.«
Jonathan ging weiter auf und ab. »Und das gilt sowohl für Gedanken, die außer Balance sind, wie für solche, die sich in Balance befinden?«
»So ist es.«
140
»Wer entscheidet, ob ein Gedanke in oder außer Balance ist?«
»Niemand. Er ist es oder er ist es nicht. Niemand entscheidet.«
Jonathan hielt im Gehen inne. »Wie sollen wir Menschen das verstehen?«
»Ihr könnt es nicht verstehen«, sagte Ramda. »Ihr könnt es nur erkennen, indem ihr den Universalprinzipien folgt. Wenn ein Gedanke die Harmonie erhöht, dann muß er sich in Balance befinden; wenn ein Gedanke die Disharmonie begünstigt, dann muß er außer Balance sein. Und Harmonie ist etwas, das du als Musiker doch wohl ohne Schwierigkeiten erkennen dürftest. Bist du nun zufrieden?«
»Vom Intellekt her schon«, sagte Jonathan, während er, um seine Spannung zu lösen, den Kopf kreisen ließ und sich streckte. Es passiert zuviel auf einmal, dachte er. »Ich weiß nicht, wie es mir ergehen wird, wenn ich versuche herauszufinden, was in und was außer Balance ist. Doch du hast mir eine Menge zum Nachdenken gegeben, und genau das möchte ich jetzt tun: nachdenken gehen.«
»Scheint mir vernünftig«, sagte Ramda. »Aber vergiß nicht: Denken ist nur ein Teil des Erkenntnisprozesses.«
»Danke für deine Hilfe, Ramda. Entschuldigung, wenn ich gereizt war.«
»Macht nichts. Du kannst jederzeit wiederkommen.«
Jonathan trat aus dem Lichtstrahl wieder in den Überleitungsraum. Diesmal wartete Ahmay auf ihn. Er saß in seinen ausgeblichenen Jeans noch immer mit gekreuzten Beinen in einem Clubsessel und starrte an die Decke. Als Jonathan zu ihm trat, schaute ihm der Indianer in die Augen und grinste über beide Ohren. »Na, junger Bär, hattest du eine interessante Reise mit Ramda?«
Jonathan verdrehte die Augen. »Puh, ich muß hier raus. 141Ich brauche frische Luft und was zu trinken und was Warmes zu essen. Mir ist, als hätte ich gerade den Mount Everest bestiegen!«
»Gemacht«, lachte Ahmay. »Laß uns zu Zorinthalian gehen; ich lad dich ein. Er weiß genau, was dich wieder auf die Beine bringt.«
Jonathan und Ahmay verließen den Überleitungsraum und gingen über den Flur zurück zur Bar. Der Duft von frisch zubereiteten Speisen und warmem Brot stieg Jonathan in die Nase, und sein Magen knurrte. Er erinnerte sich an Paula, als sie am Konferenzraum Nummer 4 vorüberkamen. Ich wünschte, ich könnte jetzt gleich mit ihr reden, dachte er. Jemand, der nicht ganz so doktrinär wie Ahmay und Ramda ist, wäre eine willkommene Abwechslung. Die zwei drehen mich richtig durch den Fleischwolf.
Ein vergessener Gedanke stieg in Jonathans Bewußtsein auf. Das Problem ist, daß die Zeit rast, und meine Kräfte schwinden. Es kann sein, daß ich jeden Augenblick von hier fort und zu dem Vorspiel in Los Angeles muß. Ich brauche unbedingt was zu essen oder zu trinken, das mir die Kraft gibt, all die »Perlen der Weisheit«, die ich von Ramda und Ahmay erhalten habe, einzusammeln und in mich aufzunehmen. Sie meinen es ja gut, aber ich lauf schon auf Reserve. So geht es einem, wenn man nicht regelmäßig ißt. Wie oft muß man dir das eigentlich in den Kopf hämmern? Wenn du keine Rücksicht auf deinen Körper nimmst, wie kannst du dann von ihm erwarten, auf dich Rücksicht zu nehmen? Hoffentlich hat Zorinthalian ein paar Tricks im Ärmel. Dabei fällt mir ein: Wenn ich ihn zum Reden bringe, erinnere ich mich vielleicht plötzlich wieder, wo wir uns schon mal begegnet sind.
Ahmay setzte sich an die Bar, und Jonathan nahm neben ihm Platz. Er erinnerte sich, daß er das letzte Mal an der Bar 142die gleiche Empfindung drohender Gefahr gehabt hatte wie im Überleitungsraum mit Ramda. Ramdas Erklärung über die formbildende Kraft der Gedanken änderte nichts an der Tatsache, daß Jonathan wieder dieselbe Furcht empfand. Er beschloß, sie diesmal zu ignorieren.
»Meine Herren?« Zorinthalian stand vor ihnen und wartete auf ihre Bestellung. »Möchten Sie essen oder trinken oder beides?«
»Beides«, polterte Ahmay los. »Unser junger Bär«, fuhr er fort und zeigte einen mächtigen, schrundigen Daumen auf Jonathan, »kriegt ein Glas von der Hausmarke und die Karte. Ich nehme noch etwas Mondtee. Aber diesmal will ich ihn kochend heiß. Die letzte Tasse war so kalt, daß ich dachte, das wäre Eistee ohne Würfel.«
Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, als auch schon das Bier, der Tee und das Menü auf der Theke vor Jonathan und Ahmay standen.
»Wie hast du denn das gemacht?« staunte Jonathan und nahm einen kräftigen Schluck von seinem Bier. »Das ist die schnellste Bedienung, die mir je begegnet ist, und ich bin selbst Kellner gewesen, verflixt noch eins.«
Der große Mann hinter der Theke lächelte freundlich und sah Jonathan in die Augen. Der Besucher aus San Diego fühlte, wie ein Prickeln seinen ganzen Körper durchlief; sein Angstpegel fiel. »Übungssache«, sagte Zorinthalian und ging seiner Arbeit nach, wobei er Jonathan noch immer in die Augen schaute. »Das ist reine Übungssache.«
Ahmay schlürfte seinen Tee und studierte die Karte.
»Weißt du, Zorinthalian, das sieht alles so gut aus, daß ich gar nicht weiß, was ich bestellen soll. Bringst du mir einfach irgendwas?«
Der Kellner nickte Ahmay zu und wandte sich an Jonathan. »Und du? Willst du schon bestellen?«
143
Aus Gründen, die er selbst nicht durchschaute, fühlte sich Jonathan weitaus besser, und er stürzte den Rest seines Bieres hinunter. »Ich möchte noch so eins und … bestell doch für mich auch mit. Was diese Hausmarke auch sein mag, es ist das wohlschmeckendste Bier, das ich je getrunken habe.«
Fast wie durch Zauberhand erschien das zweite Bier, und Jonathan begriff kaum, wie schnell sich seine ganze Einstellung verändert hatte. Nachdem Zorinthalian das Besteck aufgelegt hatte, ging er fort, um andere Gäste zu bedienen.
»Na, was meinst du, junger Bär«, fragte Ahmay und grinste wie ein Honigkuchenpferd, »wirst du die Kurve kriegen?«
Jonathan nickte energisch. »Ich kann einfach nicht glauben, wieviel besser ich mich fühle. Noch vor einer Minute habe ich wirklich geglaubt, es wäre unmöglich, all das Zeug, was du und Ramda mir erzählt hattest, zu verdauen. Ich hatte das Gefühl, von einem wildgewordenen Güterzug gerammt worden zu sein. Ich war fast so weit, daß ich aufgegeben hätte.«
Ahmays Lächeln verschwand, und seine Miene wurde ernst. »Nun ja, wir haben eine ganze Menge Material bearbeitet, aber du kannst damit umgehen. Da bin ich sicher. Und wenn du dich erdrückt fühlst, dann ist meist der Zeitpunkt gekommen, sich auf die Grundlagen zu besinnen: Die Universalprinzipien. Mit ihnen kannst du nie irren, und aus ihnen läßt sich immer wieder etwas Neues lernen.«
Jonathan nickte. »Wie die wechselseitige Verbindung aller Energie.«
»Genau. Und was bedeutet diese Aussage deiner Meinung nach im Zusammenhang mit all den neuen Ideen, mit denen Ramda und ich dich bombardiert haben?«
Jonathan runzelte die Stirn und nippte an seinem Bier. »Daß ich mein Wahrnehmungsspektrum erweitern, neue 144Sehweisen berücksichtigen soll. Das bringt mehr Balance und größere Harmonie, also eine weitere Steigerung der Balance mit sich.« Er zögerte. »Etwas, das Ramda sagte, ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: ›Bedenke, daß jeder einzelne sich mit der ihm gemäßen Geschwindigkeit seiner Balance annähert. Du bist ewig. Warum so hastig?‹«
Ahmay lachte leise. »Richtig. Wie man auf Erden sagt: ›Mach mal halblang, Junge‹! Du schaffst das schon. Da habe ich keinen Zweifel. Laß dich einfach mal treiben, Mann. Ich meine, das ist doch total cool, oder?«
Jonathan lachte. »Ich weiß nicht, ob ich dem hintergründigen Witz eines Computers und den indianischen Weisheiten eines Schoschonen an ein und demselben Tag gewachsen bin.«
»Schoschonenhäuptling für dich, du Bleichgesicht.«
Beide brachen in herzliches Lachen aus.
Zorinthalian trat hinzu und servierte Teller mit warmen Speisen. »Bitte, laß es mich wissen, wenn du das nicht magst, Jonathan. Für dich wird es ein ganz neuer Geschmack sein, aber ich glaube, du wirst es mögen. Außerdem wirst du dich danach besser fühlen.« Dann ging er.
Jonathan probierte das Essen; es schmeckte köstlich. »Hmmm. Das schmeckt ja großartig«, sagte er und schluckte den nächsten Bissen hinunter, während er über Zorinthalians Worte nachdachte. Er hatte Zorinthalian nicht erzählt, daß es ihm nicht gutging.
»Du lieber Gott, Jonathan«, sagte Ahmay zwischen zwei Bissen, »wie oft sollen wir deine Gedanken noch lesen, bis du es begreifst? Die ganze Belegschaft hier hat telepathische Kräfte. Deshalb machen wir ja hier auch die große Kohle.«
Wieder mußten beide lachen.
Mann, also besser kann es gar nicht werden, dachte Jonathan. Gut zu essen, gut zu trinken und ein Freund, mit dem 145man lachen kann. Es ist schon lange her, daß du einen Freund hattest, mit dem du so richtig aus dem Bauch lachen konntest, Taylor. Aber es ist unheimlich, dieser Raum und die ganze Umgebung kommen mir seltsam bekannt vor. Ich hab das Gefühl, als wäre ich schon mal hier gewesen, und doch kann ich mich an nichts genau erinnern.
Er schaute sich die übrigen Gäste der Bar an.
Sieh dir all diese Leute an; es sind so viele. Sie sehen mich an, als ob sie mich kennen würden, und mir ist, als würde ich auch sie kennen. Aber mir kommt kein einziger Name in den Sinn. Und dennoch habe ich, während ich hier sitze und mit Ahmay und Zorinthalian zusammen lache und Witze mache, ein Gefühl von Familie und Freundschaft, wie ich es so schon lange, lange nicht mehr gehabt habe. Es gibt nur eins, was das Ganze noch vollkommener machen würde – Paula.
Jonathan schaute zu Ahmay hinüber. Der schlürfte seinen Mondtee. Jonathan verspürte in der Mitte seines Rückens ein Gefühl aufsteigender Wärme. Der Hitzekegel bahnte sich einen Weg durch seinen Körper zur Herzgegend. Als die Wärme an Intensität zunahm, begriff er, daß das Gefühl nicht vergehen würde. Er wirbelte auf seinem Barhocker herum, um zu erfahren, warum. Es war Paula. Sie stand genau hinter ihm.
Er fühlte, wie sein Herz einen Sprung tat. Ihre überwältigende Schönheit nahm ihm den Atem. Da stand sie, das blonde Haar zu einem festen Knoten gebunden, die großen braunen Augen fast auf gleicher Höhe mit den seinen. Sie schienen ihn um irgend etwas zu bitten. Er rief sich ihre Worte ins Gedächtnis, ihren Wunsch, mit ihm nach Ende ihrer Schicht zu sprechen, und wieder schossen diese Bilder durch sein Bewußtsein. Er sah sie beide zusammen in anderer Zeit und an anderem Ort, Hand in Hand, sie küßten sich, nackt, lachend, einander fest in die Augen schauend.
146
Sie wandte sich an Ahmay: »Ich weiß, was du sagen willst, aber ich will nur eine Minute mit Jonathan reden.«
Ahmay warf ihr einen langen Blick zu und stand auf. Ein leises Lächeln umspielte seine Mundwinkel, als er Jonathan kurz ansah, ehe er sich zum Gehen wandte. Er sagte zu Jonathan: »Wir haben noch viel zu besprechen. Zorinthalian weiß, wo du mich findest, wenn du fertig bist.« Dann ging er.
Als Ahmay sich entfernte, nahm Paula Jonathans Hand und führte ihn an einen freien Tisch. Auf dem Weg dorthin fiel ihm der Flügel wieder ins Auge. Das Instrument sah verloren aus, so allein in einer Ecke. Alle Tische waren voller Menschen, die lachten, aßen und sich unterhielten; und niemand schien sich für das Klavier zu interessieren. Schließlich fand Paula einen freien Tisch. Sie schlüpfte in die Nische und zog Jonathan neben sich. Ihre Knie berührten sich. Ihre Blicke senkten sich ineinander, und Paula nahm seine beiden Hände in die ihren. Er fühlte, wie ihre zarten, kräftigen Finger sanft seine Handflächen streichelten.
Ihre braunen Augen richteten sich gefühlvoll auf ihn und drangen tief in sein Inneres, bis auf den Grund seiner Seele. Er fühlte, wie sein Herz sich überschlug. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte er das Gefühl, als sei er wieder auf der Highschool im Süden Chicagos.
»Du weißt immer noch nicht, wer ich bin, nicht wahr?« flüsterte sie.
Er schüttelte verneinend den Kopf. »Ich gebe mir wirklich alle Mühe«, sagte er, und sein Herz klopfte vor Freude, ihr so nah zu sein. Am liebsten hätte er laut gesungen. Ein größeres Glück konnte er sich nicht vorstellen. »Es ist, als hätte ich von dir geträumt und kann mich nun nicht an den Traum erinnern.«
»Wir haben uns in deinen Träumen besucht«, sagte sie, »und wir sind uns viele Male im Leben begegnet. Was ich dir 147jetzt sagen will, wirst du nicht ganz verstehen. Aber ich möchte, daß du von mir läßt. Du hast dich in deinem gegenwärtigen Leben schon viel zu lange an diese Erinnerung geklammert. Die Erinnerung an mich aber hat dich daran gehindert, dich auf wichtige Beziehungen einzulassen.«
Jonathans Blick wurde finster. Sein Herz füllte sich mit Furcht und Zweifel. »Was sagst du da? Ich habe dich eben erst gefunden, und da sagst du mir, ich soll dich vergessen? Das glaubst du doch selber nicht!«
»Ein Teil von dir erinnert sich an mich«, fuhr sie fort. »Und das ist der Teil, der mir Sorgen macht. Er sucht mich in deiner Welt, wo ich nicht bin – zumindest nicht in der Gestalt, die du dir wünschst. Diese fehlgeleitete Wahrnehmung veranlaßt dich, dein Herz vor anderen zu verschließen, die dich lieben möchten.«
Jonathan lächelte. »Paula, das ist doch völlig verrückt.«
Ihre Augen weiteten sich, und sie sah erschrocken aus. »Du kennst meinen Namen. Ein wenig erinnerst du dich doch, nicht wahr?«
»Ja, aber nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen«, sagte er. »Und ich weiß, daß ich dich liebe.«
»Wenn du dich an diesen Gedanken klammerst, wird das die Balance in deinem Innern stören«, rief sie aus. »Es ist besser, wenn du losläßt.«
»Ach, laß doch jetzt das alberne Geschwätz!« Er nahm sie bei der Hand. »Komm mit, ich will dir etwas zeigen.«
Er schlüpfte aus seinem Sessel und zog sie hinter sich her. Sie gingen auf den Flügel zu. Schlagartig waren die Leute in den Nischen und an den Tischen wie elektrisiert vor Aufregung. »Los, Jonathan!« rief jemand, als sich das Paar dem Klavier näherte.
»Was tust du?« sagte Paula. »Ich werde furchtbare Schwierigkeiten bekommen. Ich sollte eigentlich arbeiten.«
148
»Entspann dich«, sagte er. »Du gehörst doch zu mir. Das dauert nur eine Minute. Es wird dir gefallen. Ich widme es dir.«
Sie wollte etwas sagen, schwieg jedoch und ließ seine Hand los. Dann neigte sie den Kopf zur Seite und atmete tief ein, während er auf den Klavierhocker rutschte. Ihre großen braunen Augen füllten sich mit Tränen.
Er hauchte in seine Hände und rieb sie aneinander. Dann setzte er sich zurecht und begann, den ersten Satz aus seinem Konzert zu spielen. Jetzt spürte er, wie die Emotionen seine Adern durchpulsten und sein ganzes Sein erfüllten. Genau darum hast du dieses Stück geschrieben, erinnerte er sich. Laß es einfach fließen. Laß die Energie fließen.
Er schloß die Augen. So ist es richtig. Schön ruhig und langsam am Anfang. Du hast keine Eile. Du hast es hier mit einem ganzen Konzert zu tun. Laß dir Zeit. Denk dran, keiner außer dir hat Noten. Du kannst von vorn bis hinten improvisieren, wenn du magst. Oh, das tönt gut. So gut hast du es noch nie gespielt.
Er dachte an Paulas schönes Gesicht, an ihre Tränen und ihre Sorge um sein Glück. Ihm war, als müsse er weinen vor Freude, ihre Liebe gefunden zu haben. Doch er spielte weiter. Er wollte sie umarmen und ihr sagen, daß er sie in jedem Augenblick, alle Tage, Jahr um Jahr bis in alle Ewigkeit lieben werde, auch wenn er wußte, daß sie gleich für unbestimmte Zeit wieder an ihre Arbeit würde gehen müssen. Und er spielte weiter.
Dann kamen ihm Ahmay und Ramda und Zorinthalian und der absurde Zwischenfall im Überleitungsraum wieder in den Sinn. Er hatte das Gefühl, das Tempo anziehen zu müssen, und er spielte weiter. Er konnte es nicht fassen, mit wie vielen Informationen und neuen Gedanken man ihn seit seiner Ankunft überschüttet hatte. Jetzt spielte er schneller. 149Wo führt das alles hin? Ich habe hier überhaupt kein Zeitgefühl. Warum denke ich bloß immer, ich müsse mich furchtbar beeilen? Ach ja … L. A. Mensch Digger, Junge, je länger du hier bist, desto schwerer fällt es dir, dich an das Leben in Südkalifornien zu erinnern, das hinter dir liegt. Jetzt wird mir die Zeit tatsächlich knapp. Die Leute, die bei dem Vorspiel vor ihm auftraten, dürften nicht mehr allzu lange brauchen, und das bedeutete, er würden diesen Ort verlassen und sich von Paula trennen müssen.
Dieser Gedanke jagte ihm Schauer durch die Seele, und er verlangsamte sein Spiel. Die Vorstellung, sie nicht sehen und mit ihr zusammen sein zu können, erfüllte sein Herz mit Traurigkeit. Wenn er nun aufhörte zu spielen und sie gegangen wäre, würde er gegen Einsamkeit und Ablehnung ankämpfen müssen. Er hätte ihr das nicht aufzwingen sollen. Er dachte immer nur an sich. Die Balance läßt zu wünschen übrig, Taylor. Beim Gedanken an Ahmay und seine Verrücktheiten unterdrückte er ein Lächeln. Der Satz ging zu Ende. Er hörte auf zu spielen und öffnete die Augen.
Paula stand noch immer neben dem Klavier. Tränen liefen ihr über die Wangen. Im Restaurant und von der Bar hallte donnernder Applaus wider. »Gut gemacht, Jonathan«, schrie ein aufgeregter Gönner, »wo zum Teufel warst du so lange, Junge?«
Paula berührte seine Hände, während die Menge weiter jubelte. Die vertraute Wärme prickelte ihm durch Hände und Finger. »Das war wunderschön«, sagte sie. »Danke. Du hast eine große Begabung. Aber ich muß fort. Denk an meine Worte: Du mußt mich gehen lassen.«
»Und du denk an meine Worte«, gab er zur Antwort.
»Ich werde dich noch einmal sehen, ehe du fortgehst. Dir wird dann manches klarer sein.« Sie wandte sich zum Gehen.
150
»Geh nicht«, sagte er und versuchte ihre Hände zu berühren. Er fühlte die Qual in seinem Herzen, fast zu groß, als daß er sie ertragen konnte. »Bitte verlaß mich jetzt nicht. Ich bin noch nicht zu Ende.«
Die Menge hatte sich mittlerweile erhoben und jubelte ihm zu.
Sie blieb stehen, kehrte um und trat ganz nah an ihn heran. »Jonathan, bitte mach es uns beiden nicht noch schwerer.« Noch immer rannen Tränen über ihr Gesicht. Er fühlte, wie seine eigenen Wangen feucht wurden. »Wir sind uns schon so oft begegnet.« Sie wischte die Tränen von seinem Gesicht und küßte ihn sanft auf den Mund. »Ich liebe dich von ganzem Herzen, doch es ist besser für dich, wenn du mich freigibst. Wir sprechen später noch darüber.« Sie küßte ihn noch einmal. »Dein Publikum wartet, und ich will hören, was du mit dem zweiten Satz machst. Wie ich höre, macht er dir manchmal etwas Probleme.«
Sie zwinkerte ihm zu und schlenderte auf die Konferenzräume zu.
151
»Was die (Welt) wirklich braucht …
sind mehr Diener.«
Während Jonathan neben dem Flügel stand und Paula nachsah, die im Flur zu den Konferenzräumen verschwand, kroch eine Leere in sein Herz. Mit zwei schnellen Handbewegungen wischte er sich die Tränen von den Wangen. Was Sekunden zuvor noch Begeisterung und überwältigende Freude gewesen war, hatte sich nun in einen hohlen Schmerz verwandelt, der, so glaubte er, nicht enden würde, bis er und Paula wieder zusammen wären. Der Beifall der Gäste hielt an, doch er hörte ihn kaum. »Nochmal! Zugabe!« schrien sie. Jonathan hob die Hand. Die Menge verstummte.
Er räusperte sich und schluckte. »Ich danke Ihnen für den freundlichen Applaus«, sagte er und schaute in die gespannten Gesichter überall im Raum. »Ich habe bemerkt, daß viele von Ihnen mich kennen, und daß ich schon lange Zeit nicht mehr hier bei Ihnen war. Was ich soeben gespielt habe, war der erste Satz eines noch im Entstehen begriffenen Werkes, das, wie Sie unschwer hören werden, noch weiter bearbeitet … werden muß.«
»Spiel uns alles vor«, schrie einer aus der Menge. »Klingt doch großartig.«
»Das finde ich auch«, sagte ein anderer, und alle klatschten.
152
Wieder hob Jonathan die Hand. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, von Ihnen allen«, sagte er und schaute sich um. »Zuerst muß ich jetzt die Mahlzeit beenden, die meine Gastgeber für mich bereitet haben. Mein jugendlicher Körper hier …« Er klopfte sich auf die Magengegend, und alle lachten. »Wie Sie sehen, benötigt mein armer Körper hier ein wenig aufbauende Nahrung.« Er atmete tief ein. »Danach habe ich noch ein paar Verabredungen, und wenn dann die Zeit noch reicht, werde ich an dieses wunderbare Klavier zurückkehren und den Rest des Stückes spielen. Inzwischen möchte ich Ihnen dafür danken, daß Sie mich so freundlich aufgenommen haben, gerade jetzt, wo ich Ihre Unterstützung wirklich dringend gebrauchen kann.« Er nickte dem einen oder anderen in der Menge zu. Mancher winkte ihm, als ob er ihn besonders gut kenne. »Noch einmal vielen Dank«, sagte er und begab sich an die Bar.
Die Menge brach in tosenden Beifall und Hochrufe aus. Als er an der Theke angelangt war, kamen einige der Gäste hinzu und schüttelten ihm die Hand. Jonathan ging auf jede ihrer Bemerkungen mit einem Wort des Dankes ein. Schließlich legte sich der Aufruhr, und er durfte seine Mahlzeit beenden.
Als er eben die Gabel zur Hand nahm, um mit dem Essen zu beginnen, räumte Zorinthalian das gebrauchte Geschirr ab und ersetzte es durch eine frische, dampfende Portion desselben Gerichtes. Der muskulöse Barkeeper blickte Jonathan in die Augen und hob die Brauen. »Nicht schlecht gespielt. Aber wenn du was essen willst, kann es genausogut frisch und warm sein, oder? Es gibt nichts Schlimmeres als kaltgewordene Mahlzeiten.«
Jonathan nickte zustimmend. »Danke«, sagte er und begann zu essen. »Das war sehr aufmerksam von dir.«
Er aß noch ein paar Bissen und überließ sich dann den Bildern, 153die jetzt sein Bewußtsein erfüllten. Bilder einstiger Brüderlichkeit und Freude, die er in Zorinthalians Gesellschaft vor langer Zeit empfunden hatte. Natürlich wußte dieser Koloß von einem Mann genau, was ihm durch den Kopf ging, und sprach dennoch nicht darüber. Dafür mußte es einen Grund geben. Jonathan beschloß, die Sache vorerst auf sich beruhen zu lassen.
»Du weißt«, fuhr er fort, »daß ich dich beobachtet habe. Ich gebe gerne zu, daß du der beste Barkeeper bist, der mir je begegnet ist.«
Zorinthalian lächelte, während er die Theke wischte. »Danke, Jonathan. Von einem Mann deiner Urteilskraft, deiner Kenntnis und deiner Erfahrung betrachte ich das als wirkliches Kompliment.«
»Gern geschehen«, sagte Jonathan. Schätze, ich habe genau seinen Ton getroffen, dachte er. »Aber ich glaube, du bist mir sehr ähnlich: Kaum sitzt du an einer Theke, gehst du automatisch deine Checkliste durch.«
Zorinthalian schien verblüfft. »Was für eine Checkliste?«
»Du weißt doch«, sagte Jonathan, »nach der man einen Barkeeper beurteilen kann: wie er sich dem Gast präsentiert; seinen Augenkontakt; wieviel er redet; was er sagt; ob er sich zuviel oder zuwenig um den Gast kümmert; wie er mit Beschwerden umgeht; ob er in erster Linie am Wohlergehen des Gastes oder am Trinkgeld interessiert ist; wie er auf magere Trinkgelder reagiert; ob er die Bedürfnisse des Gastes vorausahnt; wie schnell er Gedeck und Gläser abräumt; wie gut er sich in Speisen und Getränken auskennt. Bei mir ist das schon beinahe zwanghaft«, fuhr er fort. »Jedenfalls hast du besser abgeschnitten als alle anderen, mich selbst eingeschlossen.«
Zorinthalian lachte, während er unter der Theke Ordnung machte. »Wie gefällt dir die Arbeit im Restaurant nach all 154den Jahren?« fragte er. »Wie schaffst du es, dich immer neu zu motivieren?«
Jonathan zuckte die Achseln und nahm einen Schluck Bier. »Ich glaube, es sind die Leute, für die ich weitermache«, sagte er. »Bei der Arbeit oder während eines Spiels reden die Jungs manchmal Klartext. Meist höre ich dann bloß zu. Wenn die Leute aus sich rausgehen, dauert es nicht lange, bis man feststellt, daß wir alle so ziemlich im selben Boot sitzen. Keiner von uns rechnet damit, daß er den Rest seines Lebens im Restaurantgeschäft verbringt. Das ist nichts weiter als ein Sprungbrett. Die Frage, die alle beschäftigt, ist, was wird der nächste Schritt sein? Wegen dieser Frage lassen wir wohl einander nicht aus den Augen. Wir spüren diese unerklärliche Gemeinsamkeit, aber wir können nicht herausbekommen, wozu sie gut sein soll.«
Der Kellner unterbrach seine Arbeit und blickte Jonathan prüfend an. »Vielleicht kannst du gerade das hier herausfinden, während du hier bist. Vielleicht ist dein nächster Schritt nicht so sehr ein Was, sondern ein Wie.«
Ein Paar machte Zorinthalian Zeichen. »Eine Rund für alle«, sagten sie. »Wir wollen einen Toast ausbringen.«
Blitzschnell goß Zorinthalian jedem, der an der Bar saß, ein Glas Wein ein. »Wir wollen auf unsere nächste Reise anstoßen«, sagte die Frau. »Auf daß wir dabei etwas lernen.«
»Zum Wohl, zum Wohl«, sagten alle und stießen an.
Zorinthalian blieb vor Jonathan stehen. »Weißt du übrigens«, sagte er, »als Mitglied der Zunft, worin der Brauch, beim Toast anzustoßen, seinen Ursprung hat?«
»Nein, nicht genau, aber ich kann dir eine Erklärung wiedererzählen, die ich mal gehört habe«, lachte Jonathan. »Im Mittelalter haben die Herren vom Adel des öfteren versucht, sich gegenseitig umzubringen, indem sie den Wein vergifteten. Wenn sie aber mit ihren Pokalen zusammenrasselten 155und der Wein von einem Pokal in den anderen hinüberspritzte, dann war das eine Lebensversicherung.«
Zorinthalian brüllte vor Lachen. »So eine abscheuliche Geschichte kann man auch nur auf der Erde zu hören kriegen! Ich will dir sagen, wie man es mir erzählt hat. Ein scharfsinniger Diener hat festgestellt, daß beim Toast alle Sinne außer einem gebraucht werden: die Farbe des Weines konnte man sehen, das Bouquet konnte man riechen, man konnte fühlen, wie einem der Wein über die Lippen rann, und wenn man trank, konnte man den Wein schmecken. Doch ein Geräusch gab es nicht – einer der Sinne war bei der Prozedur übergangen worden. Dem Genuß des Weines fehlte die Balance, solange, bis das Geräusch hinzukam. Ergo: scheppernde Pokale oder klingende Gläser.«
Jonathan lächelte. »Eindeutiger Beweis dafür, daß der Planet Erde mehr Barkeeper braucht: damit sichergestellt ist, daß beim Toast jeder ein Glas hat. Auf diese Weise fördern wir die Balance – und niemand wird bestreiten, daß die Erde mehr Balance nötig hat.«
»Was dem Planeten Erde wirklich fehlt«, sagte Zorinthalian, »sind mehr Diener. Die Sozialarbeiter, Pfleger und Tagesmütter, Lehrer, Krankenschwestern, ehrenamtlichen Helfer, Außendienstmitarbeiter, die Barkeeper, Kellner und Kellnerinnen und viele andere arbeiten in ihren Berufen als wirkliche Diener. Eure Gesellschaft legt offenbar mehr Wert auf physische Balance. Intellektuelle, emotionale und spirituelle Balance belegen einen armseligen zweiten Platz. Eine solche Gewichtung ist in sich schon außer Balance und wird, wenn man dieser Entwicklung freien Lauf läßt, zu einem weiteren Mangel an Balance führen.«
»Wird sich das jemals ändern?« fragte Jonathan.
»Der Umschwung ist schon da. Es beginnt damit, daß eine wachsende Zahl von Menschen ihr Leben dem Dienen widmet; 156und die Geschäfte hier in der Himmelsbar laufen immer besser. So wie du statten uns viele Menschen auf der Mitte ihrer Reise einen Besuch ab.«
Zorinthalian beugte sich zu ihm hinüber. »Zum Schluß noch etwas zu den Eigenschaften eines guten Dieners: Er muß ein gutes Gedächtnis haben. Er muß sich bewußt sein, wer er ist, was er tut und warum er es tut. Und danach muß er handeln.«
Der Barkeeper entfernte sich, um dem Hilfskellner am anderen Ende der Theke beim Abräumen eines Tabletts mit Gläsern zu helfen.
Es war offensichtlich, daß Zorinthalian im Augenblick nicht daran dachte, Jonathan in das Geheimnis einzuweihen, das mit ihrer Bekanntschaft an anderem Ort und zu anderer Zeit verbunden war. Nur Geduld, sagte Jonathan sich immer wieder; es hat wirklich keine Eile damit.
Plötzlich kehrte das Gefühl drohender Gefahr zurück, das er im Überleitungsraum verspürt hatte. Er sah sich um. Nichts hatte sich verändert. Zorinthalian und der Hilfskellner von vorhin standen hinter der Theke. Weder an der Bar noch im Restaurant waren neue Gäste eingetroffen. Niemand in seiner Nähe sah verdächtig oder bedrohlich aus. Er stürzte sein Bier hinunter.
Ahmay glitt auf den Hocker neben ihm. »Na, na«, sagte er, »es wird Zeit, daß du ernsthaft auf deinen Körper Rücksicht nimmst.«
Jonathan blickte lächelnd zu Ahmay hinüber. »Das Essen und die Getränke sind wunderbar. Es ist unglaublich, was für einen Unterschied das macht. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch.«
»Vielleicht bist du das auch, junger Bär«, sagte Ahmay. »Vielleicht bist du das auch. Bist du bereit, deine Reise fortzusetzen?«
157
»Voll und ganz«, sagte Jonathan mit einem energischen Nicken. »Aber vorher möchte ich dich noch etwas fragen.«
Ahmay wandte sich um und schaute seinem Gast in die Augen. »Leg los.«
»Weißt du, warum ich andauernd diese übermächtigen Angstgefühle bekomme? Gerade geht's wieder los, und das macht mich noch verrückt.«
»Ja, ich weiß.«
Jonathan starrte dem Indianer in die Augen, und kalte Schauer überliefen ihn; er war sich nicht sicher, ob er die nächste Frage wirklich stellen wollte. »Würdest du mir sagen, warum? Und zwar jetzt gleich?«
Ahmay winkte Zorinthalian heran. »Jonathan hat eine Frage«, erklärte er dem Barkeeper. »Er fragt, ob ich weiß, warum er diese ständigen Gefühle drohender Gefahr habe. Ich sagte ihm, ich wisse es. Nun will er, daß ich es ihm sage. Was meinst du?«
Zorinthalian zuckte die Achseln. »Naja, ich glaube, er ist soweit.«
»Wollt ihr damit sagen, ihr wißt beide Bescheid?« platzte Jonathan heraus.
Die beiden Männer nickten.
»Also würde sich bitte einer von euch beeilen, es mir zu sagen, ehe ich den Verstand verliere?«
»Aber natürlich«, sagte Zorinthalian. »Es ist der Hilfskellner. Er ist derjenige, der dich scheinbar verfolgt. Er ist es auch, der dich hier reingejagt hat.«
»Aber der sieht dem Burschen, der mich verfolgt hat, überhaupt nicht ähnlich. Wie kann er dann derselbe sein?«
Die Männer lachten leise. »Er kann sein Äußeres beliebig verändern. Das ändert nichts daran, wer er ist.«
»Also wer ist er?«
»Für dich, Jonathan, ist es nicht so sehr eine Frage des 158Wer, sondern des Was«, sagte Ahmay. »Und das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Das mußt du selber herausfinden.«
Lange Zeit herrschte Stille, während Jonathan nachdenklich die Gesichter der beiden betrachtete, um sich darüber klarzuwerden, was er nun tun solle.
»Ist das euer Ernst?«
Die beiden nickten.
»Barkeeper«, schrie einer der Gäste.
»Wenn du mich brauchst, pfeif nur«, sagte Zorinthalian im Gehen.
In Jonathan drehte sich alles.
»Das ist alles halb so schlimm, junger Bär. Solange du mit einem von uns zusammen bist, bist du hier in Sicherheit. Der Hilfskellner hat einfach Spaß daran, die Leute fertigzumachen. Im Grunde hat er seinen Zenit schon überschritten. Hier nimmt ihn keiner so richtig ernst.«
Jonathan schüttelte den Kopf. Er wollte sichergehen, daß er sich nicht verhört hatte. »Dann gehört das für euch hier schon zur Routine?«
»So ist es«, nickte Ahmay. »Kerle wie der sind hier Massenware. Sie kommen und gehen. Das Personal kümmert sich nicht weiter um sie. Sie glauben immer noch, sie könnten einen von uns in einem unachtsamen Moment erwischen. Aber das ist noch nie geschehen. Die Besucher allerdings fürchten sich vor ihnen.«
Jonathan runzelte die Stirn. Er versuchte das alles zu verstehen. Sie haben dir gesagt, du sollst dich entspannen, Taylor. Aber du kannst es einfach nicht lassen, was? Die ganze Zeit, die du hier drin bist, hast du dich ohne ersichtlichen Grund zu Tode geängstigt. Es ist der dämliche Hilfskellner. Um ehrlich zu sein, dachte Jonathan, gab diese neue Enthüllung den Ereignissen eine etwas banale Wendung.
159
»Ein bißchen enttäuscht?« stimmte Ahmay ein.
»Nein, überhaupt nicht«, protestierte Jonathan. »Warum sollte ich enttäuscht sein?«
»Naja, wenn man süchtig nach Dramatik ist, muß man doch in eine Krise geraten«, sagte Ahmay mit einem Augenzwinkern.
»Ich bin nicht süchtig nach Dram...« Er dachte an Chicago und an Key West.
»Jonathan«, unterbrach ihn Ahmay, »in letzter Zeit machst du deine Sache schon sehr viel besser. Langsam aber sicher lernst du, daß du nicht erst einen Riesenaufstand inszenieren mußt, um dein Leben zu ändern. Allerdings war noch ein kleiner Adrenalinstoß nötig, um dich in die Himmelsbar zu kriegen.«
Da stand er nun. Den Tatsachen seines Lebens konnte er sich nicht entziehen. Allein der Gedanke daran machte ihn ein wenig verlegen.
»Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu solchen Burschen wie dem Hilfskellner. Wenn einer von diesen Kerlen sich in der physischen Welt selbständig macht, dann sieh dich vor. Sie können tatsächlich einigen Schaden anrichten, denn ihnen fehlt die Selbstbeherrschung. Ihr einziger Antrieb ist die Selbsterhaltung.
Und nun«, fügte Ahmay so beiläufig hinzu, als hätten sie sich soeben über das Wetter unterhalten, »da wir das aus der Welt geschafft haben, bist du bereit, deine Reise fortzusetzen?«
Mit einem Gefühl, als habe man ihm einen Vorschlaghammer zwischen die Augen gerammt, wandte Jonathan sich Ahmay zu und nickte wortlos.
»Gut. Nimm dein Glas mit. Ich möchte dich mit jemandem bekanntmachen. Ein netter Bursche – ein bißchen zurückhaltend, aber du wirst ihn mögen.«
160
Der hochgewachsene Schoschonenhäuptling stand auf und ging auf die Tischgruppen zu. Jonathan folgte ihm ein wenig erleichtert.
Der Hilfskellner stellte seine Putztätigkeit hinter der Theke ein und schielte zu Jonathans Tisch hinüber. Er summte eine irische Ballade.
Ahmay schlüpfte in eine Nische neben einen kleinen, ältlichen Mann mit lichtgewordenen Haaren, der eine Hornbrille, einen Mantel und eine Fliege trug. »Jonathan, ich möchte, daß du einen Kollegen von mir kennenlernst. Das ist Mark.«
Sie reichten sich die Hände.
»Wie geht's?« sagte Mark. Er hatte eine hohe, näselnde Stimme; seine Hände waren klein, stark und weich.
»Ganz gut«, erwiderte Jonathan. »Schön, Sie kennenzulernen, Mark. Ein Freund von Ahmay kann nicht ganz schlecht sein.«
Alle drei lächelten.
»Mark hat einige Informationen, die dir vermutlich helfen werden, Jonathan. Ich habe ihn gebeten, sich ein paar Minuten mit dir zu unterhalten, ehe du zurückkehrst. Ich gehe wieder an die Bar. Wenn du mich brauchst, ruf einfach.« Er glitt aus der Nische und stand auf. »Noch was unklar?«
»Muß ich zurückgehen, auch wenn ich nicht will?« schüttete Jonathan sein Herz aus. »Die Gegend ist hier viel schöner, als ich sie in Erinnerung hatte.«
Ahmay wußte, daß Jonathan damit meinte, er wolle Paula nicht verlassen. »Das ist deine Wahl«, sagte er in dem Versuch, sich ungezwungen zu geben. »Deine Entscheidung, uns zu besuchen, war genau so gedacht: als Besuch, nicht als ständiger Aufenthalt. Eigentlich sollte es dir zu einem neuen Anfang da drüben verhelfen.« Er zögerte und schaute Jonathan eindringlich an. »Du brauchst darüber jetzt nicht nachzudenken. 161Fürs erste hat Mark ein paar Tips, wie du mehr Balance in deinen Körper bringen kannst.« Ahmay entfernte sich.
Jonathan wandte sich Mark zu. »Wie können Sie das tun?«
»Ich bin Arzt«, sagte der kleine Mann und rückte seine Brille zurecht.
»Und was für eine Art Arzt sind Sie?« fragte Jonathan, der eine spontane Abneigung gegen diesen Mann empfand. Schon seit seiner Kindheit hatte er gegenüber Ärzten immer mit einem reflexartigen Mißtrauen reagiert. Er hatte zugesehen, wie die Hausärzte der Familie die Krankheiten seiner Eltern falsch behandelt hatten. Dabei waren sie offensichtlich eher daran interessiert, Medikamente zu verschreiben, als daran, die eigentlichen Ursachen für die Krankheitssymptome seiner Eltern herauszufinden. Dasselbe Phänomen hatte er als Erwachsener sowohl in Chicago als auch in Florida beobachtet. Dieser Bursche ist wahrscheinlich nicht anders als all die anderen Dummköpfe, dachte er.
Mark rieb sich den Nacken. »Nun, die Tätigkeit eines Arztes hier in der Himmelsbar unterscheidet sich erheblich von der der meisten Ärzte, die du gekannt hast. Meine Rolle hier ist eher die eines Heilers oder Wissenschaftlers; wir behandeln hier den ganzen Menschen.«
Jonathan mußte sehr an sich halten, um Mark höflich zu begegnen. Er bemühte sich, eine gesellschaftlich annehmbare Form für seine unterdrückte Wut zu finden, die aus jener Zeit stammte, in der Ärzte so viele seiner Krankheiten fehldiagnostiziert hatten, was ein paarmal sogar mit überflüssigen Operationen geendet hatte.
»Den ganzen Menschen, ja? Und wie machen Sie das?«
»Du kannst mich nicht besonders gut leiden, nicht wahr, Jonathan? Genaugenommen ist Höflichkeit das Äußerste, was du aufbringst.«
162
Jonathan errötete. »Ja, Sir«, sagte er und schaute dem Arzt gerade in die Augen. »Das ist absolut richtig.«
»Ich mache dir daraus keinen Vorwurf, da man mich mit deiner eigenen Krankengeschichte und der deiner Familie bekanntgemacht hat. Der Beruf des Mediziners hat sich auf der Erde von seiner ursprünglichen Bestimmung entfernt -- ist, wenn du so willst, außer Balance geraten. Doch im Augenblick eröffnet sich eine Möglichkeit für weitreichende Veränderungen: seit kurzem stellt die alternative Medizin die Doktrinen der westlichen Medizin vor erhebliche Herausforderungen. Erst wenn westliche Ärzte dazu übergehen, die alternative Medizin als Ergänzung zu betrachten, werden sie Balance in ihre Heilmethode bringen. Ich hoffe sehr, daß du mir Gelegenheit gibst zu beweisen, daß meine Heilmethode Balance hat. Wenn es mir nicht gelingt, werde ich wenigstens wissen, daß du mich zu Ende angehört hast.«
»Das ist wohl nur fair«, stimmte Jonathan zu.
»Danke«, sagte Mark. »Das erste, was ich im Zusammenhang mit deinem Körper erwähnen möchte, ist etwas, was du schon gehört hast: Energie Muß Frei Fließen. Erinnerst du dich?«
»Genau«, sagte Jonathan. »Ahmay, Ramda und ich haben uns schon ein wenig darüber unterhalten. Das fällt unter eines der Universalprinzipien.«
Mark winkte einer Kellnerin. »Möchtest du noch ein Glas?«
»Ja. Das wirkt Wunder auf meine Lebensgeister.«
Die Kellnerin nahm ihre Bestellung auf und ging.
»Das Thema Gesundheit«, erläuterte Mark, »läßt sich als Energiepaket verstehen. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Arten von Energie. Das reicht von der einzelnen Zelle über die Organe bis hin zu komplexen Systemen wie dem Nervensystem oder dem Gefäßsystem. Damit der Körper 163bei ›guter Gesundheit‹ arbeitet, muß sich der gesamte Körper mit sich selbst in Harmonie oder ›in Balance‹ befinden. Ist das verständlich?«
Jonathan nickte.
»Ein weiteres Energiegesetz, das für ein besseres Verständnis der Gesundheit von Wichtigkeit ist, lautet: ›Alle Energie besitzt Vibrationsfrequenz‹. Sind Zellen oder Organe in Balance, liegen ihre Schwingungen innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches. Diesen Bereich betrachtet man als ›gesund‹. Gerät die Zelle außer Balance, so sinkt ihre VF – die Energie strömt langsamer und verdichtet sich, wie wenn Wasser zu Eis wird. Diese niedrigere VF zeigt im allgemeinen einen ›krankhaften Zustand‹ an. Da Energie in wechselseitiger Verbindung steht, sind die unterschiedlichen Zellen und Organe in ihrer Balance voneinander abhängig.«
Jonathan lächelte. »Es ist erstaunlich, was für eine starke Wechselbeziehung zwischen allen Aspekten des menschlichen Seins besteht. Vieles von dem, was Sie eben erwähnten, habe ich schon mit Ramda und Ahmay erörtert, nur in völlig anderem Zusammenhang.«
»Ich verstehe«, sagte Mark, »und du hast vollkommen recht. Das ist der Grund, warum ich vorher sagte, daß wir hier den ganzen Menschen behandeln.«
Die Kellnerin kam mit den Getränken zurück. »Danke«, sagte er. »Bitte sorgen Sie immer für Nachschub, okay?«
Sie lächelte. »Ja, Sir.«
Als sie gegangen war, zuckte Mark mit den Achseln. »Dies Bier kann uns nichts anhaben. Was man hier Bier nennt, ist nichts weiter als eine Auswahl an Fruchtsäften und Kräutern, die so gemischt werden, daß sie aussehen und schmecken wie Bier. Hier wird kein Alkohol serviert, Punkt.«
Jonathan lachte und schüttelte den Kopf. »Du lieber Gott, 164hier ist man ja vor keiner Überraschung sicher. Bier, das kein Bier ist. Und was noch alles?«
Mark griff in die Innentasche seines Anzugs und zog einen Notizblock und einen Stift hervor. »Ich will dir eine kleine Skizze machen. Ich glaube, sie wird dir helfen zu verstehen, wie dein Körper funktioniert.«
Er zeichnete etwas, das aussah wie ein Autoradio mit einer riesigen Antenne. »Du kennst das Prinzip, nach der Rundfunk auf der Erde funktioniert, nicht wahr?«
»Ja.«
»Und du kennst das Prinzip der Rundfunkwellen mit unterschiedlichen Wellenlängen?«
Jonathan nickte.
»Gut«, fuhr Mark fort. »Der menschliche Körper ähnelt in weiten Teilen einem Radio, das alle Wellenbereiche zu gleicher Zeit empfangen kann. In meiner Übertragung gibt es lediglich vier Rundfunkwellen. Eine der Funktionen des Bewußtseins besteht darin, wie ein Tuner zu entscheiden, welche der Wellen es empfangen will.«
Mark zeichnete vier verschiedene Wellenlinien ein, die die Antenne kreuzten. »Der Wellenbereich mit der dichtesten und höchsten Frequenz im menschlichen Körper: die Spiritualität. Die zweithöchste ist die emotionale, danach folgt die intellektuelle Frequenz. Der Bereich der niedrigsten und breitesten Wellen stellt die physischen Aspekte des menschlichen Körpers dar.« Mark drehte seine Zeichnung herum, so daß Jonathan sie betrachten konnte. »Soweit alles klar?«
»Verstanden.«
»Diese spirituelle Rundfunkwelle nun«, sagte Mark, während er die Skizze wieder zu sich herumdrehte und unter jeder Wellenlinie eine weitere Linie einzeichnete, »hat sozusagen ein außergewöhnliches Merkmal: sie gabelt sich. Die anderen nicht. Die eine Hälfte der spirituellen Rundfunkwelle 165durchdringt und verstärkt die anderen drei Rundfunkwellen. Somit wird die Empfangsqualität durch die Höhe des Widerstands im inneren Leitungssystem erhöht oder vermindert. Die zweite Hälfte der spirituellen Rundfunkwelle ist lediglich dazu da, in eigener Sache von der Quelle zu senden. Mit anderen Worten, der Geist oder die Seele, oder wie du sie auch bezeichnen magst, ist eine Kombination aus allen Aspekten der vier Energiesysteme – PEIS -, des physischen, emotionalen, intellektuellen und spirituellen. Wie ich sehe, hast du mit den anderen bereits ausführlich über PEIS gesprochen. Deshalb will ich deine Zeit nicht mit noch mehr Erklärungen vergeuden.«
»Jetzt verstehe ich«, sagte Jonathan. »Ich weiß noch, wie ich Ramdas Lichtfeld betrat und von verschiedenen Teilen meines Körpers Farben ausstrahlten; an anderen Stellen meines Körpers war überhaupt nichts zu sehen. Ramda sagte, die Farben repräsentieren das Fließen meiner Seele oder meines Geistes in meinem Körper. Dann muß es also dort, wo keine Farben zu sehen waren, ein Hindernis oder eine Blockade gegeben haben.«
»Genau«, sagte Mark. »Diese Bereiche deines Körpers sind außer Balance. Wenn wir unserem Beispiel vom Radio folgen, dann ist der Empfang gestört oder es hat einen Kurzschluß gegeben. Und sehr oft haben diese Blockaden oder Balancestörungen als ungelöste spirituelle Probleme begonnen und sind dann durch den intellektuellen und emotionalen in den physischen Bereich vorgedrungen. Schmerz und Unbehagen sind also blockierte Energie.«
»Soweit kann ich Ihnen folgen, Doc«, scherzte Jonathan.
Mark rückte seine Fliege zurecht und unterdrückte ein Lächeln. »Die Aufrechterhaltung dieser Blockaden erfordert sehr viel mehr – so etwa das Zehnfache – an Energie, als es kostet, einfach loszulassen. Auf diese Weise heilen wir uns selbst: 166wir lassen los, in der Seele, im Kopf, im Herzen und im Körper. Es kann mit einem Gedanken – einem Akt des Willens, wenn du so willst – seinen Anfang nehmen und wird dann zur ›self-fulfilling prophecy‹: Ich glaube an meine Heilung, also werde ich gesund. Du hast mit Ramda darüber schon gesprochen, wenn du dich erinnerst. Denken Erschafft Form.«
»Also muß ich nichts weiter tun, als heilenzudenken?«
»Nein, das ist noch nicht alles«, sagte Mark. »Ein gebrochenes Bein würde man niemals heilzudenken versuchen; man würde den Arzt rufen. Doch wenn man vor dem Unfall ›gesunde‹ Gedanken denkt, kann man den Schaden verringern. Und beschäftigt man sich nach dem Unglück mit ›heilenden‹ Gedanken, dann kann man den Heilungsprozeß beschleunigen. Alternative und westliche Medizin haben die Möglichkeit, sich zu ergänzen. Das ist ein integrativer Prozeß. Heilt man einen Bereich seiner selbst, so wird die Heilung auch in anderen Bereichen einsetzen. Das ist eine Fortführung des Prinzips der wechselseitigen Verbindung. Herrscht im Geist vollkommener Friede, so wird auch der Körper mit sich selbst in Frieden leben. Kennt das Herz die uneingeschränkte Liebe, dann gilt das auch für die Seele, den Geist und den Körper. Befindet sich der Körper im Gleichgewicht, erfreuen sich auch die andern der Balance. Der Mensch ist innerhalb der Schöpfung eines der treffendsten Beispiele für das Wirken des Synergismus.«
Jonathan kratzte sich am Kopf. »Wie kann ich denn nun meine Physis in Ordnung bringen?«
Mark rückte seine Brille zurecht. »Hör auf deinen Körper. Er weiß, was er braucht.«
»Ist das alles?«
»Nein«, sagte Mark. »Du kannst noch mehr tun, indem du deine VF erhöhst: gesund ißt und Sport treibst. Beides erhöht die Vibrationsfrequenzen.«
167
»Ich seh es schon vor mir«, sagte Jonathan. »Im Jahre 1998 Erdzeit wird sich die Werbung am Samstagmorgen ungefähr so anhören« – und er ahmte mit verstellter Stimme einen Ansager nach – »Denkt immer dran, liebe Jungen und Mädchen, Crunch, das Knuspermüsli hat 600% mehr VF als die Marke X. Sie die Nummer Eins, hol dir die höchste VF, nimm Crunch.«
Mark lächelte.
»Sie haben ja gelächelt. Ich wußte doch, daß Sie's können, Doc.«
»Das«, sagte Mark, nachdem er die Fassung wiedergewonnen hatte, »kommt der zukünftigen Entwicklung wahrscheinlich sogar recht nahe. Früher oder später wird die VF in das Bewußtsein der großen Masse dringen, und wenn das geschieht, wird diese Entdeckung die Gesundheitsvorsorge auf der Erde revolutionieren. Je höher die Vibrationsfrequenzen des Körpers sind, desto mehr Energie kann den Körper durchdringen, und desto stärker wird das Immunsystem. Ein gestärktes Immunsystem verringert Leiden oder Krankheiten.«
Jonathan holte tief Luft und trank einen Schluck Bier, ehe er seine nächste Frage stellte. »Sie wollen doch wohl nicht behaupten, Doc, daß wir Menschen, wenn wir Ihren Anregungen folgen, den Planeten Erde tatsächlich von Krankheit und Leiden befreien könnten?«
»Wir wollen uns vorerst nur mit dir beschäftigen. Ich sage, daß ein solches Szenario auf individueller Basis denkbar ist.«
»Was heißt das?«
»Gesundheit«, sagte Mark und trank einen Schluck Bier, »hat mit freier Wahl, mit Energie und Wechselbeziehung zu tun. Wenn du diese Vorstellungen in deine Wahrnehmung aufnimmst, dann wird sich als natürliche Konsequenz daraus die innere Balance entwickeln. Wenn du davon überzeugt 168bist, daß Krankheit etwas ist, was von irgendwo oder irgendwem anders auf dich zukommt, dann steht im Mittelpunkt deiner Wahrnehmung der Spaltungsgedanke, der die Universalprinzipien verleugnet und mißachtet. Das meine ich mit freier Wahl. Wenn du aber die Universalprinzipien nicht verstehst oder dir nicht zu eigen machen kannst, dann hast du die Wahl – die Wahl im kosmischen Sinne -, mehr über das Leben und die Universalprinzipien zu lernen, indem du die Krankheit in dein Leben einläßt. Nehmen wir den Schmerz. Der Schmerz ist ein Geschenk. Durch ihn gibt der Körper zu verstehen, daß er sich außer Balance befindet.«
Jonathan runzelte die Stirn. »Sie nehmen doch wohl nicht ernsthaft an, daß irgend jemand auf der Erde glaubt, der Schmerz sei ein Geschenk, oder?«
»Nein«, sagte Mark. »Die Bedeutung des Schmerzes kann man nicht verstehen, wenn man allein die physische Existenz in den Mittelpunkt seine Wahrnehmung stellt. Will man die Idee des Schmerzes voll und ganz erfassen, dann muß man sich selbst – zugleich mit der Wahrnehmung der physischen Existenz – im Licht einer spirituellen Betrachtungsweise sehen. Noch einmal: Auch wenn deine Entscheidung für eine Krankheit nicht auf der Ebene des Bewußtseins fallen mag, es bleibt die Tatsache, daß du auf einer spirituellen oder seelischen Ebene für das verantwortlich bist, was du tust. Du und niemand sonst. Du erinnerst dich, daß wir alle in dem uns angemessenen Tempo nach Balance streben. Wir haben noch eine Ewigkeit Zeit. Kein Grund zur Eile.«
Jonathan sah verwirrt aus. »Sie sagen also, daß Krankheit und Leiden nur dann Einlaß im Leben finden können, wenn wir es zulassen, daß in uns selbst – auf einer der Ebenen unseres PEIS – ein gestörtes Gleichgewicht herrscht? Also ist es die gestörte Balance, die einen Mangel an Gesundheit bewirkt. 169Nicht Krankheit und Leiden sind verantwortlich, sondern wir selber?«
»Ganz genau«, sagte Mark. »Damit sollen die tragischen Folgen von Krankheit und Leiden nicht balanciert werden. Im Gegenteil. Die Manifestation des Mangels an Balance im Menschen ist sogar etwas, das von allen Mitmenschen Verständnis, Liebe und Mitgefühl verlangt. Doch das solltest du mit Ahmay oder Ramda zusammen näher untersuchen. Meine Aufgabe ist es, dir bewußt zu machen, wie Körper, Geist, Herz und Seele des Menschen durch die Gesundheit aufeinander bezogen sind und sich beeinflussen. Welche Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen die Gesundheit zwischen dem Körper, dem Geist, dem Herzen und der Seele des Menschen schafft. Ich kann nur hoffen, daß meine Erklärungen zu all diesen Dingen dir auf deiner Reise wenigstens ein klein wenig behilflich sein werden.« Er schwieg und räusperte sich. »Meinst du, daß es mir gelingt?«
»Verdammt gut sogar, würde ich meinen«, sagte Jonathan. Als er sein Bier austrank, entdeckte er die Beule an seinem kleinen Finger. Es dauerte einen Augenblick, ehe sein Gedächtnis wieder funktionierte; dann erinnerte er sich an sein Vorspiel. »Noch eine letzte Frage, Doc. Sind Sie der Meinung, daß mein verletzter Finger das Ergebnis einer Energieblockade ist und daß es in meiner Macht steht, diese Blockade zu beseitigen und mich selbst in einen Zustand größerer Balance zu versetzen?«
»Genau das meine ich. Nicht mehr und nicht weniger. Du hast diese Fähigkeit, hier und jetzt. Ich will dir nicht versprechen, daß es dir gelingt, und es ist im Augenblick nicht meine Aufgabe, dir zu zeigen, wie du es machen mußt. Ich sage nur, daß du die Kraft dazu besitzt.«
Vielleicht ist das ja der Grund, dachte Jonathan. Vielleicht geschieht das Ganze überhaupt nur deshalb. Vielleicht kann 170ich diesen Finger heilen, ehe ich vorspielen muß. »Wer kann mir denn helfen?« fragte Jonathan. »Ich möchte jetzt gleich an diesem Problem arbeiten. Mein Vorspiel kann jederzeit beginnen.«
Mark betrachtete Jonathan eine Zeitlang. »Ich glaube, du solltest am besten mit Ahmay sprechen.«
171
»… du selbst trägst die Verantwortung …«
Jonathan rutschte von seinem Stuhl, stand auf und reichte Mark die Hand. »Danke«, sagte er. »Sie waren mir eine große Hilfe.«
»Ich danke dir«, sagte Mark und schob Brille und Fliege zurecht. »Denk nur immer daran, Jonathan, daß du mit der Kraft, die du in dir hast, viel erreichen kannst. Diese Kraft wahrzunehmen und den Umgang mit ihr zu erlernen, ist die Herausforderung, vor der du stehst.«
»Ich nehme es mir zu Herzen, Doc. Und ich habe den festen Vorsatz, danach zu handeln.« Er wollte schon gehen, hielt aber inne und wandte sich um. Er warf einen letzten Blick auf den kleinen Mann und sagte mit einem schüchternen Winken: »Nochmal vielen Dank. Sie haben mir wirklich die Augen geöffnet.« Dann machte er kehrt und eilte davon.
Er wußte, was er zu tun hatte. An der Theke angekommen, fragte er Zorinthalian: »Weißt du, wo Ahmay ist? ich muß ihn unbedingt gleich sprechen.«
Da entdeckte er den Hilfskellner, der im Hintergrund der Bar damit beschäftigt war, den Bierkühler aufzufüllen. Blitzartig durchfuhr ihn die Angst, aber er schüttelte den Kopf. Nein, Taylor, sagte er sich. Vergiß diesen Mist. Du hast jetzt über wichtigere Dinge nachzudenken.
172
Zorinthalians Miene nahm einen seltsamen Ausdruck an.
»Schon da, junger Bär«, hörte er Ahmay hinter sich sagen.
Jonathan wandte sich um. »Wo kommst du her?«
Ahmay lächelte gutmütig. »Du warst ganz in meiner Nähe.«
»Können wir … jetzt gleich … allein miteinander reden?«
Ahmay zuckte die Schultern. »Natürlich. Was hast du auf dem Herzen?«
»Laß uns nochmal in den Überleitungsraum gehen«, sagte Jonathan und nahm sich das Glas mit frischem ›Bier‹, das Zorinthalian auf die Theke gestellt hatte. Er dankte dem Barkeeper mit einem Nicken. Dann wandte er sich wieder Ahmay zu und fuhr fort: »Dort sind wir ungestört, und ich habe ein paar ernsthafte Fragen an dich und Ramda. Ich brauche Antworten, ehe meine Zeit hier um ist.«
»Dann laß uns gehen«, sagte Ahmay und ging auf den Flur zu. »Wenn du noch länger auf mich wartest, kommst du zu spät.«
Wenig später schloß Jonathan die Tür zum Überleitungsraum Nummer 6 und atmete tief durch. Ahmay saß schon mit gekreuzten Beinen in einem der Clubsessel und nahm einen Schluck aus einer Getränkedose. Aus einer kleinen Öffnung in der einen Wand schimmerte noch immer der Lichtstrahl hervor, der nahe der gegenüberliegenden Wand einen riesigen Kreis bildete. Die Videoanlage und die Geräte des Toncenters sahen völlig unverändert aus. Kleine grüne und rote Lämpchen blinkten neben den Schaltern.
Jonathan setzte sein Glas auf einem Tischchen ab und begann auf und ab zu gehen. »Bitte lach mich nicht aus, wenn ich blöde Fragen stelle«, sagte er zu Ahmay.
Ahmay unterdrückte ein Grinsen. »Großes Ahmay-Ehrenwort«, sagte er mit unbewegtem Gesicht. »Über blöde Fragen wird nicht gelacht.«
173
Jonathan verdrehte die Augen und sah den Schoschonenhäuptling böse an.
»Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht«, sagte Ahmay. Dabei zog er in gespielter Zerknirschung eine Schulter in die Höhe und legte dazu den Kopf schief. »Auch keine blöden Kommentare mehr.«
»Also, ich habe zwei Fragen. Erstens: Habe ich wirklich die Kraft, meinen Finger hier und jetzt zu heilen?«
Ahmay dachte einen Augenblick nach. »Ehe ich dir darauf antworte, brauchst du noch mehr Informationen, damit du das, was ich sage, auch verstehst.« Er wies auf die Couch. »Setz dich hin und entspann dich. Wenn du herumläufst, werd ich nervös.«
Jonathan setzte sich.
»Wir wollen noch einmal auf das zurückkommen, was du mit Ramda besprochen hast, ehe wir die Pause eingelegt haben: das Denken. Ramda sagte dir, daß der Gedanke Form erschafft, und nannte dir Beispiele für die formbildende Kraft der Gedanken, sowohl in dir als auch in der Außenwelt.«
»Richtig«, sagte Jonathan. »Aber dazu habe ich auch noch eine Frage. Meint er ›erschaffen‹ wirklich in dem Sinn, daß dort, wo nichts war, etwas entsteht, oder meint er eigentlich etwas ganz anderes?«
Ahmay überlegte einen Augenblick. »Du stellst wirklich gute Fragen, junger Bär. Ich bin beeindruckt. Hier hat eure Sprache zweifellos ihre Grenzen. In der Sprache der Schoschonen ist diese ganze Frage viel einfacher zu beantworten. Was Ramda mitzuteilen versuchte, hatte mit der Auswirkung des Gedankens auf Energie zu tun. Selbstverständlich ›erschafft‹ keiner von uns Energie. Das ist eines der Universalprinzipien: Das Wesen der Energie ist ihr Sein. Die Wirkung des Gedankens besteht darin, der Energie eine neue 174Vibrationsfrequenz zu geben, die dann eine leichte Wellenbewegung im Universum auslöst. Diese Wellenbewegungen könnte man als Neuschöpfungen bezeichnen, da sie in jenem Augenblick neu und einzigartig sind. Wenn du jedoch wirklich genau sein willst, dann erzeugt oder gestaltet der Gedanke Form, indem er wiederverwendet, was bereits da ist, nämlich Energie.« Ahmay hielt inne und schaute Jonathan an. »Hilft dir das weiter?«
Der Besucher nickte.
»Der Gedanke also«, fuhr Ahmay fort, »gestaltet Form, und das ist nur die Spitze des Eisbergs in Anbetracht der Kräfte, die im Menschen ruhen. Sie besitzen die Fähigkeit, nicht nur ihre Gedanken, Gefühle und Handlungen, sondern noch vieles andere zu beherrschen und zu lenken.«
»Was zum Beispiel?« warf Jonathan ein.
»Alles. Mit anderen Worten: Du selbst trägst die Verantwortung, ob es dir bewußt ist oder nicht. Es beginnt mit dem Wissen, daß du selbst alles gestaltet hast, und setzt sich fort in der Bereitschaft, allein für die Folgen einzustehen. Die Schuld deinen Eltern, deinen Nachbarn, deiner Schule, dem Schicksal oder sonstwem zuzuweisen, ist Ausdruck einer fortgesetzten Balancestörung.«
Jonathan stand auf und begann umherzugehen. »Damit ich es richtig verstehe: Willst du sagen, daß alles, was in meinem Leben geschehen ist, das Ergebnis meines Handelns, meiner Entschlüsse ist?«
Ahmay nickte. »Genau. Es ist dein Entwurf. Es ist dein Konzept. Die Metapher dafür kannst du dir aussuchen. Jedenfalls bist du der Boß. Du hast ein bißchen Theater gespielt, Jonathan, also wollen wir es mit einer Bühnenmetapher versuchen. Die Göttliche Wirklichkeit wirkt als Produzent, indem sie dir einen endlosen Strom von Energie zur Verfügung stellt. Alles andere jedoch ist dir selber überlassen. 175Du schreibst das Manuskript, wählst dir deine Rolle, suchst die Schauspieler aus, bestimmst die Beleuchtung, die Requisiten, das Bühnenbild und führst die Regie bei der Koordination all dieser Elemente zu einer theatralischen Reise, einem Bühnenabenteuer wie aus einem Guß.« Ahmay schwieg.
Jonathan lief weiter umher, den Blick starr auf den neuen Flauschteppich gerichtet, die Hände auf dem Rücken. »Weiter, weiter«, sagte er.
»Wenn wir die Bühnenmetapher noch erweitern«, sagte Ahmay, »so bedeutet Ewigkeit für dich, den metaphorischen Regisseur, die Verantwortlichkeit für eine ständige Truppe mit unendlichem Repertoire. Sobald eine Produktion abgespielt ist, muß mit der nächsten begonnen werden. Es hört niemals auf.«
»Augenblick mal, willst du damit sagen, daß das Leben auf der Erde für den Menschen mit einer unendlichen Folge von Inszenierungen vergleichbar ist, wobei jede Lebenszeit gleichbedeutend ist mit einer Inszenierung?«
»Genau, das will ich sagen«, stimmte Ahmay zu.
»Hmmm.« Jonathan setzte sich und starrte an die Decke. »Darüber muß ich erst nachdenken.« Er griff nach seinem ›Bier‹ und nahm einen tiefen Zug. »Du redest von Reinkarnation«, brach es aus ihm heraus.
Ahmay nickte.
»Was soll das alles?« überlegte Jonathan und betrachtete die Staubteilchen im Lichtstrahl. »Warum wollen wir all diese Leben leben?«
»Wollen ist genau das richtige Wort. Du willst lernen. Erinnere dich, daß der Sinn deiner Existenz in der Vervollkommnung der Balance besteht. In deinem Leben geht es um Erkenntnis und Lernen. Lernen und Erkenntnis fördern die Balance; alles Leben trachtet von Natur aus nach vollkommener 176Balance; vollkommene Balance ist die Göttliche Wirklichkeit und damit der Urgrund allen Lebens.«
Jonathan stand von der Couch auf und setzte sich im Lotussitz auf die Erde. Er versenkte sich in den Lichtstrahl. Taylor, du mußt dich konzentrieren, sagte er sich. Die Antwort auf dein Problem mit dem Finger und vielleicht auch mit der Überleitung deines Konzertes ist womöglich nur noch ein oder zwei Fragen entfernt. »Was ist mit Himmel und Hölle geschehen?« fragte er. »Und mit Gott und der Einmaligkeit jeden Lebens und jeder Seele?«
Ahmay schüttelte den Kopf. »Eins mag ich an dir, junger Bär: Wenn du eine Frage stellst, redest du nicht drumherum. Wir wollen ganz oben anfangen. Es gibt weder Himmel noch Hölle. Die Himmelsbar ist nicht der Himmel. Es ist ein Recycling- und Informationszentrum für Seelen. Himmel und Hölle sind als Örtlichkeiten Erfindungen jener, die an eine Spaltung glauben. Da Wirklichkeit durch Wahrnehmung erzeugt wird, ist das ihre Wirklichkeit. Die Universalprinzipien führen über den Spaltungsgedanken hinaus: Durch ihr Wesen, vor allem durch Energie und die Einheit unserer Seelen schaffen sie die Verbindung zwischen allen und allem. Daher kann es keine wirkliche Spaltung geben. Dies«, schloß Ahmay, »läßt nun deine Frage nach Gott und der Einzigartigkeit jeden Lebens und jeder Seele unbeantwortet.«
Vom Lichtstrahl her ertönte plötzlich ein seltsames Geräusch. Es klang wie ein Hüsteln. »Entschuldigt«, dröhnte Ramdas tiefe Stimme, »aber an dieser Stelle eurer Unterhaltung würde ich mich gerne einschalten, wenn ich darf.«
»Aber bitte«, sagte Ahmay. »Jonathan stellt dauernd diese komplizierten Fragen. Ein alter Schoschone wie ich ist es nicht gewohnt, diese Fragen in einer Fremdsprache zu beantworten.«
177
»Das Problem jeder Diskussion über das Wort ›Gott‹«, sagte Ramda, »liegt in der Definition oder auch Sprache begründet. Etwas zu definieren bedeutet, wenigstens in deiner Sprache, es einzugrenzen. Die nächste Schwierigkeit besteht in der Beschränktheit deines Bewußtseinsstandes. Den meisten Seelen in physischer Gestalt fällt es schwer, sich selbst als das anzusehen, was sie wirklich sind. Dennoch bemühen sie sich um eine Definition Gottes in Ihrer oder Seiner Herrlichkeit. Doch im Sinne unserer Diskussion wäre es am einfachsten zu sagen, daß hier in der Himmelsbar deine irdische Vorstellung von Gott eine recht ähnliche Bedeutung hat wie unsere Göttliche Wirklichkeit. Der größte Unterschied besteht vielleicht in der Frage der göttlichen Absicht. Auf der Erde geht man allgemein davon aus, Gott oder Allah – oder welchen Namen man sonst wählen mag – bestimme in seiner Allwissenheit aktiv oder passiv über alles Geschehen. Hier bei uns hat die Göttliche Wirklichkeit keinen Willen; ihr Wesen ist ihr Sein. Sie ist der Ausdruck der Vollkommenheit oder der vollendeten Balance in allen Dingen, bekannten und unbekannten. Sie ist es, wonach alles strebt, was lebt. Ergo: Göttliche Wirklichkeit.«
Alle schwiegen.
Ein wenig später fügte Ramda hinzu: »Das eine sollst du wissen, daß, was immer Gott für dich bedeuten mag, Er, Sie, Es unendlich viel größer ist – größer an Liebe, größer an Weisheit, größer an Nachsicht, größer an Stärke, größer an Mitleid, größer … größer.«
»Danke für deine Hilfe, Ramda«, sagte Ahmay. »Ich hoffe, das macht die Dinge für unseren jungen Gast etwas klarer.«
Jonathan saß da, den Blick unverwandt auf den Lichtstrahl gerichtet. »Aber was ist mit der Einmaligkeit des Lebens und der Seele?« fragte er. »Wird das Leben ohne sie nicht trivial und bedeutungslos?«
178
»Jonathan«, dröhnte Ramdas Stimme, »subjektive Schlußfolgerungen gehören nicht zu unserer Arbeit hier in der Himmelsbar. Leben ist Energie, der von jeder einzelnen Seele zum Zwecke des Lernens eine einzigartige Form gegeben wird. Daher hörst du hier bei uns den Ausdruck oder die Bezeichnung ›Erdenschule‹. Bewertungen des jeweiligen Lebens sind in den Universalprinzipien, nach denen wir arbeiten, nicht vorgesehen. Alles Leben strebt entweder nach Balance oder entfernt sich von ihr. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Doch ähnlich wie beim menschlichen Fingerabdruck oder Stimmenprofil ist jeder Lebensentwurf einzigartig und besonders. Und dennoch ist das einzelne Leben – das Lebensabenteuer, die Lebensreise oder wie du es auch nennen magst – in sich nicht abgeschlossen. Das Ende dieses Lebens, oder auch der Tod, wie ihr es auf der Erde nennt, ist weder ein unglückliches, noch ein freudiges Ereignis. Es ist lediglich das Ende der einen Erfahrung und der Beginn einer neuen.«
Wieder erfüllte Schweigen den Überleitungsraum. Jonathan saß noch immer da und starrte in den Lichtstrahl.
»Jonathan«, sagte Ramda, »ist dir damit geholfen?«
Fast unmerklich nickte der Besucher.
Ahmay beobachtete ihn minutenlang schweigend. »Und das führt uns zum Thema Seele«, sagte er dann beinahe flüsternd. »Ich würde dieses Thema gern kurz ansprechen, junger Bär.«
Jonathan schien sich kaum noch zu regen.
Ahmay hielt inne, um seine Gedanken in eine Linie zu bringen. »Auch der Begriff ›Seele‹ muß zuerst einmal definiert werden, ehe man sinnvoll darüber diskutieren kann. Für uns in der Himmelsbar ist die Seele jenes Lichtteilchen, das tief in sich das ewige Bewußtsein seiner Verbundenheit mit der Einheit trägt. Es ist der Speicher all jener Erfahrungen, die wir auf unserer immerwährenden suche nach vollkommener 179Balance während einer Vielzahl von Lebensentwürfen auf dem Weg zu einer Wiedervereinigung mit dem Einen – der Göttlichen Wirklichkeit – gesammelt haben. Diese ewige Suche nennen wir ›Die Bewegung‹. Ich möchte einen Vergleich heranziehen: ›Die Bewegung‹ ist wie ein Strom, der in den Ozean fließt. Solange die Gesetzmäßigkeiten der Natur auf Erden unangetastet bleiben, kann nichts den Strom daran hindern, den Ozean am Ende zu erreichen. Selbst Dämme, gebaut, seinen Lauf zu hemmen, werden zu gegebener Zeit brechen, und der Strom wird seine Reise fortsetzen. Ja selbst Verschiebungen ganzer Landmassen werden in der Unendlichkeit der Zeit diesen Fluß nicht besiegen. Früher oder später wird er den Ozean erreichen. Von solcher Kraft und Zielstrebigkeit ist die Seele, so wie wir dies Wort verstehen. Doch«, fuhr Ahmay fort, »haben wir – Ramda und ich und der Rest der Belegschaft – bemerkt, daß du vermutlich etwas anderes meintest, als du deine Frage über die Seele stelltest. Wenn du dabei den Seelenbegriff der Erdenbewohner im Sinn hattest – jenes populäre Mißverständnis, demzufolge die Seele ein abgespaltener Teil Gottes oder Allahs ist, der das Erdenleben begleitet -, so betrachten wir diese Auffassung als ein wesentliches Element der Spaltung. Wie bereits gesagt, halten wir den Spaltungsgedanken für einen verhängnisvollen Irrweg, weil er Disharmonie begünstigt und eine Balance verhindert.«
Ahmay hielt inne. »Verstehst du, Jonathan?«
Jonathan verharrte minutenlang in finsterem Schweigen, ehe er sich aus seiner kauernden Haltung löste und aufstand. Er schaute sich im Raum um und betrachtete dann seinen kleinen Finger. »Ahmay, willst du mir wirklich erzählen«, sagte er und hielt sich die Hand vors Gesicht, um seinen gekrümmten Finger zu untersuchen, »daß meine Seele sich dies hier als Erfahrungsmodell gewählt hat?«
180
Ahmay grinste und zuckte die Schultern. »Ich verstehe ja, daß dir das vielleicht komisch vorkommt, Jonathan, aber genau das will ich sagen. Und weißt du, was? Ich glaube, es ist Zeit, mal was anders zu versuchen, damit du das Konzept, das wir vermitteln möchten, in seiner Gesamtheit verstehen kannst. Der Typ, der beim Vorspiel in Los Angeles vor dir dran ist, hat schon sein halbes Programm geschafft. Was meinst du, Ramda, ist es Zeit, daß wir ihn in die virtuelle Realität nach Art der Himmelsbar schicken können?«
»Klasse, Alter. Total cool«, sagte Ramda.
Ahmay lachte, beherrschte sich dann aber und sagte: »Entschuldige, Jonathan. Ich lache nicht über dich. Aber wenn man dich so todernst dreinschauen sieht und dazu dann Ramdas ausgeflippten Kommentar hört – es ist ganz einfach komisch.«
»Macht nichts.«
»Nimm das alles nicht so ernst, Jonathan. Ja?« Ahmay klopfte ihm auf den Rücken.
»Ich werd's versuchen. Also, was hat es mit dieser virtuellen Realität auf sich? Auf der Erde ist das so 'ne Art Spielzeug in Freizeitparks oder im Film.«
»Unsere virtuelle Realität wird dir helfen, innerhalb kürzester Zeit eine große Menge an Information in dich aufzunehmen«, erklärte Ahmay. »Wenn du raus willst, brauchst du bloß zu sagen, oder auch nur zu denken: ›Die virtuelle Realität soll aufhören.‹«
»Hab ich denn noch genug Zeit? Wir haben das Problem mit meiner Musik und das Ding mit meinem kleinen Finger noch nicht gelöst, und ich will mit euch über Paula reden. Ich muß sie wiedersehen, ehe ich gehe, und ich muß euch noch was über sie fragen.«
»Ich verstehe das alles«, beruhigte ihn Ahmay. »Ich verspreche dir, daß sämtliche Themen, die du eben genannt 181hast, ehe du gehst noch in aller Ausführlichkeit behandelt werden. Und du wirst noch reichlich Zeit für Paula haben. Vergiß nicht, junger Bär, Zeit ist in der Himmelsbar etwas ganz anderes als auf der Erde. Alles, was du erlebst, solange du hier noch zu Gast bist, dauert nicht mehr als ein paar Augenblicke Erdzeit.«
Jonathan trank mit lautem Glucksen sein Bier aus und atmete dann tief durch. »Ich kann das alles nicht glauben«, murmelte er vor sich hin. Laut sagte er: »Alles klar, Ahmay. Ich glaube, ich bin soweit. Wem soll ich trauen, wenn nicht einem Schoschonenhäuptling?«
»Dem Computer, deinem Freund und Helfer«, sagte Ramda.
»Hör nicht auf ihn.« Ahmay lächelte und ging zur Wand mit dem elektronischen Gerät hinüber. »Er macht dich doch bloß verrückt. Los, stell dich in seinen Lichtstrahl, dann richten wir alles für dich ein. Es dauert nur einen Augenblick.«
Jonathan trat ins Licht. Zuerst sah er wie zu Anfang die Farben durch seinen Körper hindurchfließen. Diesmal waren es mehr. Vor allem das Pink, das seiner Brust entströmte, hatte zugenommen.
»Beunruhige dich nicht und krieg keinen Schreck, wenn du dich in jemand anderen verwandelst, während du dich in der virtuellen Realität befindest«, sagte Ahmay, während er an Schaltern und Knöpfen drehte. »Dieser Apparat kann zusätzlich zu seinen vielen anderen Funktionen auch die einer Zeitmaschine ausüben. Du mußt nur immer daran denken, daß dies eine Lernerfahrung ist. Lernen läßt sich auf verschiedene Art und Weise: durch eigenes Nachdenken; durch Mitteilung anderer; indem man etwas gezeigt bekommt; durch Erfahrungen. Wir werden nicht zulassen, daß du Schaden dabei nimmst. Aber du wirst möglicherweise Schmerz und Sorge, Glück oder Freude, Erstaunen, Verzückung oder 182sogar Liebe empfinden. Nichts davon ist wirklich. In dem Augenblick, in dem du sagst oder denkst ›Die virtuelle Realität soll aufhören‹, werden alle Bilder, Geräusche, Gerüche, aller Geschmack, alle Gefühle, die du erfährst, verschwinden, und du wirst wieder hier stehen bei Ramda und mir.« Ahmay wandte sich um und schaute Jonathan an. »Bist du soweit?«
Jonathan lachte leise. »Wer könnte nach dieser entzückenden Vorwarnung einer solch verlockenden Aussicht widerstehen? Ich kann's kaum noch erwarten.«
Ahmay lachte. »Na, jedenfalls hast du deinen Humor noch nicht verloren.« Er drückte noch auf einige weitere Knöpfe. »Los geht's.«
Es wurde dunkel. Jonathan war, als erwache er aus dem Schlaf. Es roch nach Rauch. Er lag im Bett.
In der Nähe brennt etwas, denkt er. Vielleicht in der Bar. Oder womöglich funktioniert die Maschine doch nicht ganz so gut, wie Ahmay gesagt hat. Ihn ergreift panische Angst. Irgendwo da draußen brennt es tatsächlich. Er kann es prasseln und bersten hören. An den Wänden seines Schlafzimmers zuckt und tanzt das Licht im Widerschein der Flammen. Er will nach Ramda und Ahmay rufen, doch statt dessen hört er die Schreie eines kleinen Mädchens, die aus seinem Munde kommen. Es ist Spanisch: »Miguel! Padre!« ruft sie mit hoher, schriller Stimme.
Sie springt aus dem Bett und sieht ihr Spiegelbild im Fenster. Sie ist ein kleines Mädchen; zehn oder elf Jahre alt. Draußen bricht ein klarer Frühlingsmorgen an. Man kann kaum unterscheiden zwischen den schmalen roten Wolkenbändern und den züngelnden Flammen, die aus dem zweiten Stock des zum Haus gehörenden Pferdestalls Rauchschwaden hervorquellen lassen.
»Apollo«, flüstert sie. Sie denkt an ihren schwarzweißen 183Schecken. Sie und das prächtige Tier sind unzertrennliche Freunde vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang. Das Mädchen hält ihr Pferd für den einzigen Freund, den sie auf der Welt hat. Niemand in der Familie hat Zeit für sie. Sie haben zu viel zu tun. Fast täglich reiten sie und Apollo stundenlang durch die nahen Schluchten, die Berge und Flüsse. Dann teilen sie ihre größten Geheimnisse.
Blitzschnell zieht das Mädchen seine Arbeitshosen und Stiefel an, hastet die Holztreppe hinunter und hinaus in die kühle Morgenluft. Sie stürzt zur Stalltür. Sie wird sie öffnen.
»Juanita«, schreit Miguel, ihr fünfzehnjähriger Bruder. Er rennt hinter ihr her, zwei Eimer Wasser in der Hand. »Bleib weg von dem Stall! Das ist zu gefährlich!«
Juanita sieht, wie ihr Vater im Stall hin und her läuft, Wasser aufgießt und die Flammen austritt. Die Luft ist angefüllt mit Rauch, dem Prasseln der Flammen und den Schreien der vor Angst rasenden Pferde. Sie sieht, daß die Verbindungstür vom Stall zum Pferch geschlossen ist.
Sie öffnet das äußere Gatter zum Pferch und läuft hindurch, um die Stalltür von außen aufzusperren. Als sie die Tür öffnet, galoppieren ihr sonst so ruhiger Apollo und einige andere Pferde durch eine Wolke tiefschwarzen Rauches.
»Apollo!« schreit sie und versucht, den Schecken abzulenken. Ehe er das offene Tor erreicht, springt sie ihrem Freund nach. »Apollo!« brüllt sie, so laut sie kann. Die anderen Pferde, die in wilder Flucht auf sie zudonnern, sieht sie nicht.
Das erste versucht, ihr auszuweichen, erfaßt sie jedoch mit der Brust und schleudert sie hoch in die Luft. Als sie am Boden aufschlägt, versucht ein weiteres verängstigtes Pferd, eine andere Richtung einzuschlagen, überrennt sie jedoch, wobei ein Huf ihr zartes Gesicht streift. Während sie noch über den Boden rollt, trampelt ein anderes über sie hinweg und zerschmettert ihre Hüfte. Dann noch eines: Seine Vorderhufe 184treten direkt auf ihr Rückgrat und brechen ihr die Wirbelsäule; die Hinterhufe zertrümmern einen Oberschenkelknochen. Der Aufprall schleudert sie auf den Rücken. Alles, was sie sieht, ehe sie das Bewußtsein verliert, ist der weiße Bauch des letzten Pferdes, das, ihren zerschundenen Körper hinter sich lassend, davonspringt.
»Juanita!« schreit ihr Vater und kommt aus dem brennenden Stall gerannt. Miguel ist dicht hinter ihm.
Jetzt hält der kräftige Schecke inne, schaut den übrigen Pferden nach, die in die Freiheit entfliehen, trottet dann zurück, um bei seiner gestürzten Freundin zu sein, wiehert leise und leckt ihr das blutüberströmte Gesicht.
Nun ist es dunkel.
Juanita erwacht in einem Bett. Sie öffnet die Augen. Es ist das Ende eines anderen, weit entfernten Tages, Miguel entzündet Kerzen in ihrem Schlafzimmer. Es sind die einzigen Lichtquellen. Es ist glühend heiß. Sie liegt in ihrem eigenen Schlafzimmer, in ihrem eigenen Holzbett. Ihr Vater und ihr Bruder sehen besorgt aus. Ein merkwürdiger Geruch liegt in der Luft. Dicke Verbände aus Gaze kommen unter ihrem feuchten Nachthemd hervor und hüllen ihre furchtbar geschwollenen Beine in ganzer Länge ein. Das einzige Stückchen Fleisch, das sie sieht, sind ihre angeschwollenen Zehen, die aus den Verbänden um ihre Füße herausschauen. Die Haut ist dunkelgrün.
Der Kopf schmerzt sie so sehr, daß die Tränen ihr die Wangen herunterlaufen. In ihrem ganzen Körper pocht es. Sie hebt eine Hand, um sich die Tränen fortzuwischen, und spürt um ihren Kopf und an der Wange einen riesigen Verband. Sie ist schweißbedeckt, und ihr Atem geht schwer. Jeder Atemzug wird von einem tiefen Rasseln in Brust und Kehle begleitet.
Miguel gießt Wasser aus einem Tonkrug in einen kleinen 185hölzernen Becher und bringt es ihr. »Trink das«, sagt er und stützt Juanita den Kopf. Dann hält er ihr den Becher an die trockenen Lippen.
Das Mädchen versucht zu trinken, doch der Schmerz in Kopf und Körper ist so stechend, daß sie kaum die Kraft dazu findet. Sie bringt es nur zu einigen wenigen Schlucken.
Juanita sieht das Mitgefühl und die Liebe in den Augen ihres Bruders. Sie spürt die Qualen, die er in den vergangenen Wochen ausgestanden hat – in seinem Wunsch, zu helfen und ihr die Schmerzen zu nehmen.
Ihr Vater nimmt eine kleine Flasche von ihrer Frisierkommode und gießt etwas daraus in einen zweiten Becher. Es riecht wie Alkohol. Er bringt es ihr und stützt ihr den Kopf. »Das hilft gegen die Schmerzen«, flüstert er. »Mehr können wir nicht tun, mein kleines Mädchen. Es tut mir leid.«
Sie kann nur ein Schlückchen trinken. Es schmeckt gräßlich. Ihr Vater bettet sie wieder auf das Kissen, und der Bruder reicht ihm ein feuchtes Handtuch. Sanft wischt ihr der Vater das schweißnasse Gesicht und die Arme. Für einen Moment oder zwei fühlt sie sich ein klein wenig besser. Miguel kommt mit einem neuen feuchten Tuch und legt es ihr auf die Stirn. Nun geht es ihr noch besser.
Sie schließt die Augen und fühlt, wie schwach sie ist. Selbst diese wenigen Bewegungen haben sie völlig außer Atem gebracht, und ihr Keuchen ist stärker als zuvor. Erneut rollen Tränen über ihre Wangen. Sie wünschte, sie könnte so lange schlafen, bis sie wieder gesund ist.
»Wann kommt der Priester?« hört sie ihren Vater fragen.
»Gleich nach der Vesper«, flüstert ihr Bruder.
Im Zimmer wird es still, als ihr Bruder und ihr Vater hinausgehen. Juanita hat das Gefühl, gleich wieder einschlafen zu können, als irgend etwas sie veranlaßt, die Augen aufzuschlagen. Am Fuße ihres Bettes erblickt sie die Gestalt eines 186Fremden. Es ist eine Frau. In diesem Augenblick beginnt das Mädchen von Kopf bis Fuß zu zittern. Die große, blonde Frau kommt näher und berührt die Hand des Mädchens.
Jonathan erkennt die Besucherin. Es ist Paula.
Das Mädchen und Paula beginnen zu schweben. Gleich darauf gehen sie einen langen, lichterfüllten Tunnel hinunter. Dann ertönt ein Zischen.
»Ich lasse jetzt vorlaufen«, sagte Ahmay. »Dieser Abschnitt gehört nicht zu deiner heutigen Lektion.«
Plötzlich stand Juanita an Paulas Seite in einem wunderschönen Park. Das kleine Mädchen hatte lange, schwarze Haare und dunkle Haut. Jonathan erschien sie etwas klein für ihr Alter. Sie hatte ein niedliches Gesicht, grüne Augen und ein Schmollmündchen. In Spielshorts und Kittel gekleidet, blickte sie nun auf ihre geheilten Beine hinunter. »Es geht mir schon viel besser.«
Paula lächelte und beugte sich herüber, um Juanita in die Augen zu schauen. »Solange wir hier sind, wirst du keine Schmerzen verspüren. Und dir wird nichts geschehen, was du nicht selber wünschst. Verstanden?«
Juanita nickte und lief davon, um mit einigen anderen Kindern ihres Alters zu spielen, die auf einem Klettergerüst herumturnten.
Paula setzte sich auf eine Bank und schaute zu.
Wenig später kam Juanita zu Paula zurückgelaufen und sprang auf ihren Schoß. »Weißt du, was? Ich hab dich lieb, Paula.«
Paulas Augen wurden feucht. »Das weiß ich doch«, sagte sie. »Und ich hab dich auch lieb. Mehr als du glaubst.«
Sie hielten einander lange Zeit umschlungen, ehe Juanita aufsprang und wieder fortlief, um mit ihren neuen Freunden zu spielen. Jonathan lächelte, während er zuschaute, wie das junge Mädchen scheinbar stundenlang lief und lief.
187
Dann hörte er wieder das Zischen.
Paula und Juanita gingen Hand in Hand auf die Himmelsbar zu.
»Arbeitest du hier?« fragte das kleine Mädchen.
»Im Augenblick schon«, erwiderte Paula lächelnd.
Drinnen wurde Juanita dann von vielen Gästen wie eine lang verschollene Nichte begrüßt. Sie kamen herbei und umarmten und küßten sie. Zorinthalian lief auf sie zu, hob sie hoch, küßte sie und wirbelte sie durch die Luft. Er führte sie und Paula in eine Nische neben der Bar und brachte ihnen warmes Essen und Getränke. Ehe er wieder hinter die Theke ging, um seinen Pflichten nachzukommen, gab er Juanita noch einen Kuß auf die Wange.
Wenig später kehrte er mit einem Himmelsbar-Spezialeisshake und zwei Strohhalmen zurück. Begierig schlürften die beiden Frauen unter Gelächter und Scherzen ihre Getränke; dann standen sie auf und steuerten Hand in Hand durch den Korridor auf die Überleitungsräume zu.
Wieder vernahm Jonathan das Zischen. Er sah sie beide auf dem Rückweg von dem Trakt, in dem die Überleitungsräume lagen. Juanita hatte sich irgendwie verändert. Sie schien nicht mehr das kleine Mädchen zu sein, das im Park umhergetollt war. Sie hatte etwas Wissendes an sich.
Wieder das Zischen. »Viele Erdjahre sind jetzt vergangen«, sagte Ahmay im Hintergrund.
Juanita war wieder in der Bar und machte einen enttäuschten Eindruck. »Es tut mir leid«, sagte eine ihrer Freundinnen. »Es wäre schön gewesen, wieder mit dir zusammenzusein. Aber diesmal ist unser Pensum nicht so gut zu vereinbaren.«
»Ich weiß«, sagte Juanite, während sie die Frau umarmte. »Aber ich bin noch immer enttäuscht. Vielleicht das nächste Mal.«
188
Juanita entfernte sich, um mit ein paar anderen Freunden an der Bar zu reden. Sie begann ein Gespräch mit zwei Männern.
Während Jonathan die Gruppe beobachtete, fühlte er, wie ihn eine Flut von Gefühlen durchlief. Einer der Männer, der den Namen Tamrin trug, war ziemlich groß, hatte breite Schultern, eine tiefe Stimme und eine Ausstrahlung, die Respekt gebot. Der zweite, mit Namen Sashiko, hatte ein sanftes Auftreten und eine leise Stimme. Jonathan wollte diesem Mann etwas sagen – etwas sehr Wichtiges -, wußte jedoch nicht, was es war. Er saß da und schaute zu, wie sich die Szene entwickelte.
Die beiden Männer erklärten Juanita, daß sie kurz vor ihrer Inkarnation stünden. Sie hätten Verschiedenes voneinander zu lernen; Probleme zu bewältigen, von denen viele nach vorausgegangenen Leben ungelöst geblieben seien. Das Hauptproblem, an dem sie arbeiten wollten, war die Macht: Tamrin würde den Versuch machen, sich von seinem Bedürfnis nach der Ausübung von Macht zu lösen. Sashiko sollte lernen, Macht zu erringen und seine Angst vor ihr zu verlieren. Gemeinsam würden sie voneinander lernen.
Tamrin und Sashiko hatten bereits ihre Eltern bestimmt, die schon in die Erdenschule zurückgekehrt waren. Beide würden Familien in Chicago angehören. Dort würden sie sich kennenlernen und ein Kind bekommen, einen Jungen. Sie fragten Juanita, ob sie sich ihnen anschließen und ihr Kind sein wolle.
Juanita dachte einen Augenblick nach. Sie hatte erkannt, daß die Einsamkeit eines der noch ungelösten Probleme ihres letzten Besuches auf der Erdenschule war. Damals hatten ihre Eltern kaum Zeit für sie gehabt. Ihre Pferdezucht und der tägliche Broterwerb hatten sie zu sehr in Anspruch genommen, als daß sie sich über die Bedürfnisse einer Elfjährigen 189hätten Gedanken machen können. Das Verlassenheitsgefühl war eines der Probleme, an dem Juanita glaubte, noch arbeiten zu müssen. Dies und eine Verlagerung der Wahrnehmung auf Dinge jenseits des Physischen, das waren die beiden Lektionen, auf die sie sich bei ihrem nächsten Besuch auf der Erdenschule konzentrieren wollte.
»Du meinst Spiritualität?« fragte Tamrin.
»Ja«, sagte Juanita. »Ich glaube, ich muß lernen, die Dinge in all ihrer Vielschichtigkeit zu sehen. Ich muß zu der Erkenntnis gelangen, daß der Kitt, der alles zusammenhält, unsere Spiritualität ist. Ohne sie wird unsere Wahrnehmung durch andere Vibrationsfrequenzen verstellt.«
»Ich stimme dir zu«, sagte Sashiko. »Offen gesagt möchte ich daran ebenfalls arbeiten.«
»Das entscheidet die Sache«, sagte Tamrin.
Die drei reichten sich die Hände.
»Dann sind wir uns einig«, sagte Tamrin. »Ich werde die Mutter sein, Sashiko der Vater und du unser Sohn. Wie würdest du gerne heißen?«
Juanita überlegt kurz. »Ich glaube, Jonathan würde mir gefallen«, sagte sie. »Jonathan klingt so hübsch.«
Plötzlich wurde es stockfinster.
»Das ist erst einmal alles«, sagte Ahmay.
Jonathan stand in Ramdas Lichtstrahl, den Blick suchend auf den hochgewachsenen Indianer draußen gerichtet. Er ging fort von Ramda, hinaus aus dem Licht, und ließ sich kopfschüttelnd auf einer Couch nieder. Es herrschte Stille im Raum, während er an die Decke starrte. »Puh«, sagte er schließlich. »Das ist alles, was mir dazu einfällt – puh. Unglaublich.«
190
»Unglück ist die Chance einer neuen Erfahrung;
mehr noch – ein Geschenk …«
Die Zeit schien stillzustehen im Überleitungsraum Nummer 6. Niemand sprach. Ramdas schweigender Strahl, den die weiße Tünche gleißend reflektierte, ließ die Luft erglühen. Das leise Summen des technischen Gerätes an der Wand war das einzige Geräusch im Raum.
Ahmay stand aus seinem Clubsessel auf, ging zum Kühlschrank und nahm sich ein »Bier«. Er brachte auch für Jonathan eines mit. Der Besucher aus San Diego lag gedankenverloren mit geschlossenen Augen auf einer Couch.
»Das hilft bestimmt«, meinte Ahmay zu Jonathan und stellte die Dose neben ihn. »Wenn du dann soweit bist.« Ahmay setzte sich wieder, trank aus seiner Dose und schloß die Augen.
»Weißt du«, sagte Jonathan mit schwacher Stimme, die Augen noch immer geschlossen, »ich begreife wohl, daß ihr mich mit einer ganz neuen Sichtweise auf Zeit und Raum und meine eigene Unsterblichkeit konfrontiert habt. Doch bin ich noch immer nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, warum ich mir diese Verletzung am kleinen Finger ausgedacht habe.«
Ahmay verschluckte sich an seinem Bier. »Willst du damit sagen«, brachte er halb lachend, halb hustend hervor, »daß 191du soeben die Vieldimensionalität deiner Seele erfahren hast, daß du die Dynamik der freien Wahl und das Gesetz kennengelernt hast, demzufolge ›Alle Energie Eine Kreisförmige Bewegung Vollzieht‹ – bei euch Reinkarnation genannt -, und dir kein anderer Gesprächsstoff einfällt als dein Finger?«
Jonathan lächelte betreten. »Anders kann ich damit nicht fertig werden. Mit meinem Finger kann ich was anfangen. Außerdem sehe ich keinen Sinn in meinem gebrochenen kleinen Finger. Dem Abkommen mit meinen Eltern zufolge müßte es irgendwas mit Spiritualität oder der Abhängigkeit von physischen Dingen zu tun haben. Sicher hat es nicht mit Verlassenheitsangst zu tun. Das ist mal sicher.«
»Ist das eine Frage oder eine Feststellung?« erkundigte sich Ahmay.
»Je nachdem«, sagte Jonathan. »Hab ich recht oder nicht?«
Ahmay schüttelte den Kopf. »Da kommst du schon wieder mit dieser Spaltungsgeschichte. Denk immer dran: MIt Spaltung haben wir hier in der Himmelsbar nichts zu tun. Wir haben's mit Liebe zu tun, mit Balance und mit Energie. Bei uns kann man lernen, sich Eltern besorgen und Ratgeber aussuchen. Hier finden sich die Seelen zusammen. Aber Spaltung findet hier nicht statt. Spaltung hat mit gestörter Balance zu tun und gehört daher einem Verhaltensmuster an, das ein Ratgeber nicht wählt.
In bezug auf deine konkrete Frage«, fuhr Ahmay fort, »möchte ich dir sagen, daß ich dein Ratgeber bin – du würdest vielleicht Schutzengel dazu sagen -, nicht aber dein persönlicher Fragenbeantworter oder dein wandelndes Universallexikon. Ratgeber beraten, sie wahrsagen nicht, noch sind sie Therapeuten und erst recht keine Richter. Eine der größten Schwierigkeiten für einen Ratgeber besteht im Loslassen. 192Wir müssen lernen, unsere Schüler auch solche Entscheidungen fällen zu lassen, die oftmals Disharmonie oder Balancestörungen zur Folge haben. Das ist ein grundlegender Bestandteil ihres Lernprozesses.«
Ahmay trank von seinem Bier. »Also warum erzählst du mir nicht einfach, warum du dich entschieden hast, dir den kleinen Finger zu brechen, Jonathan. Und warum du ihn dann nicht richtig hast heilen lassen. Ich würde gern deine Antwort hören.«
Jonathan schnitt eine Grimasse, indem er beide Mundwinkel herabzog. Dann zuckte er die Schultern. »Die Wahrheit ist, daß ich keine Ahnung habe«, sagte er. »Darum habe ich dich ja gefragt. Ich dachte, wenn ich wüßte, warum ich es tat, würde mir vielleicht eher etwas einfallen, um diese Blockade zu beseitigen, die meinen Finger nicht heilen läßt.«
Ahmay lächelte. »Du solltest dabei ein paar Dinge bedenken: Ganz gleich, wo du dich gegenwärtig befindest – der Grund dafür ist deine Vergangenheit. Weiter, dein Körper bringt die intakte oder gestörte Balance der emotionalen, intellektuellen und spirituellen Aspekte deiner selbst zum Ausdruck. Alles, was ich dir verraten kann, ist, daß du auf dem richtigen Weg bist. Arbeite weiter daran; du bist schon fast am Ziel.«
Auch Jonathan mußte grinsen. »In Ordnung, Herr Schoschonenhäuptling mit dem langen schwarzen Haar. Wie wär's mit einer Frage, die du mir wirklich beantworten kannst? Wie kamst du dazu, mein Ratgeber zu werden?«
»Das ist ganz leicht«, sagte Ahmay. »Wie alles übrige, hast du auch mich ausgewählt. Genau genommen haben wir einander ausgewählt. Gleich nachdem ihr, du und deine zukünftigen Eltern, euch für euren nächsten Lebensentwurf entschieden hattet, hast du hier eine Anzeige nach einem Spirituellen Ratgeber aufgegeben. Etwa zwei Dutzend von 193uns haben darauf geantwortet, und du hast mich ausgewählt.«
»Ich verstehe«, sagte Jonathan. »Ich würde gern mehr über dich und Ramda wissen. Wer wart ihr, ehe ihr Berater wurdet?«
Ramda räusperte sich. In seinem Lichtkegel erschien das Bild eines Mannes in wallenden Gewändern. Er war groß, schön und würdevoll. Seine Haut war ledern, voller Falten und sonnengebräunt. »Das war mein letztes Kostüm auf Erden. Ich habe die meiste Zeit im Mittleren Osten – genauer gesagt in Ägypten – verbracht. Das ist über zweitausend Erdjahre her, und zu jener Zeit nannte man mich Seher.« Das Bild verschwand. »Doch gerade das war eines der vielen Leben, das mir gefiel. Jetzt gehöre ich zum oberen Lehrkörper. Meine Aufgabe ist es, dazu beizutragen, die Vibrationsfrequenz des kollektiven Bewußtseins anzuheben.«
»Meine Rolle ist die deines persönlichen Beraters. Ich bin hier, um dein individuelles Bewußtsein zu verändern«, sagte Ahmay. »Wie du weißt, habe ich noch vor kurzem als Schoschonenhäuptling die Ebenen im Nordwesten durchstreift. Und genau wie Ramda habe ich davor schon viele Leben gelebt.«
»Und warum erscheinst du mir als Indianer, und warum verkörpert Ramda einen Lichtstrahl?«
»Aus zwei Gründen«, sagte Ahmay. »Erstens, weil wir alle derselben Seelengruppe angehören. Zweitens, weil wir unsere Beratung so effektiv wie möglich auf deine Bedürfnisse in diesem besonderen Augenblick ausrichten wollen. Das erstere erleichtert die Entscheidung des letzteren erheblich. Mit anderen Worten: Wir sind überzeugt, daß die von uns gewählte Form hinsichtlich deiner augenblicklichen Bedürfnisse die ist, die dir am meisten nutzt.«
»Was ist eine Seelengruppe?« fragte Jonathan.
194
»Das ist eine Gemeinschaft oder Kooperative von Seelen«, sagte Ramda, »die sich nach eigenem Wollen oder aufgrund von Sympathieschwingungen oder ähnlichen Lebenserfahrungen oder warum auch immer entschließen, so etwas wie jene Theatergruppe zu bilden, über die wir uns unterhielten. Sie alle wechseln immer wieder ihre Rollen in der Hoffnung, daß sie, eben weil sie sich so gut kennen, einander helfen können, mehr zu lernen. Jeder bringt all seine Eigenschaften in die physischen oder spirituellen Welten ein, ganz gleich, wie viele Leben er hat oder wo er sein nächstes Leben lebt. Außerdem weiß jeder einzelne, warum der andere ein bestimmtes Lebensmuster oder Stück entworfen hat. Jedes Mitglied einer Seelengruppe ist bereit, im Stück der anderen mitzuspielen. Wir alle sind hier, um einander zu helfen.«
»Und was habt ihr selbst von alledem?«
»Vergiß nicht, daß auch du mir hilfst«, sagte Ahmay. »Indem ich eine bestimmte Lektion erteile, wächst die Balance in mir, und ich kann zudem noch lernen, ein besserer Lehrer zu werden.«
Ahmay trank aus und trug die Dose zum Abfalleimer. »Ramda, Paula, Mark und ich gehören alle zur selben Seelengruppe. Ebenso deine Eltern, viele deiner Freunde und die meisten deiner Partnerinnen. Hast du bemerkt, daß Juanitas Vater Judy ist und Miguel, ihr Bruder, Mary? Einer der Gründe dafür, daß du in Key West hängengeblieben bist und ein Restaurant mit Judy aufgebaut hast, war, daß ihr noch eine alte Rechnung begleichen mußtet, die ihr in euren vergangenen Leben aufgemacht hattet.«
»Aber warum habe ich in den zwei Jahren, ehe das Restaurant sank, so sehr gelitten?«
»Du hattest deine Lektion gelernt und warst bereit, den nächsten Schritt zu tun – tatest ihn aber nicht«, erwiderte Ahmay.
195
»Naja, Judy wollte das Boot nicht verkaufen, also sieht es doch eher so aus, als hätte sie ihre Lektion nicht gelernt«, meinte Jonathan sich verteidigen zu müssen.
»Ja, das stimmt schon. Aber mußtest du deshalb diese Beziehung fortsetzen? Reg dich nicht auf, Jonathan, das kommt im Verlauf der Lernerfahrungen sehr häufig vor. Der eine hat, ohne es zu bemerken, seine Lektion eher gelernt als der andere, weshalb beide weiter im selben Zustand verharren. Erst wenn der Schmerz zu groß wird, trennen sich ihre Wege. Sie ist übrigens in anderen Lektionen, in denen du noch ein Anfänger bist, schon weit fortgeschritten.«
Jonathan wechselte das Thema. »Und was ist mit …«
»Mary«, unterbrach ihn Ahmay. »Das möchte ich lieber nicht verraten. Es warten auf der Erde noch ein paar Überraschungen auf dich, die ich dir nicht verderben möchte.«
Jonathan kam ein Ausschnitt der virtuellen Realität in den Sinn, wo Juanita – also eigentlich er selbst – sich ihre Eltern ausgesucht hatte. »Ich kann einfach nicht glauben, daß meine Mutter zu meiner Seelengruppe gehört. Das war wirklich eine Überraschung.«
»Du warst in dem Moment da, in dem du dich für die Mitwirkung in euren jeweiligen Inszenierungen entschieden hast.«
»Ich weiß.« Jonathan schüttelte den Kopf. »Ich hab da noch eine ganze Menge nachzuholen. Wenn ich wieder zurück bin, muß ich rausfinden, warum ich mir meine Mutter ausgesucht habe.«
Taylor, überlegte er, ist dir klar, daß die gesamte Grundlage der Psychotherapie aus den Fugen geriete, wenn die Leute wüßten, daß sie sich ihre Familien selbst aussuchen? Es ist gar nicht zu fassen.
»Jetzt kommst du dahinter, Junger Bär«, lachte Ahmay. »So will ich dich von jetzt an nennen.«
196
Jonathan nickte höflich. »Vielen Dank. Und was hast du für mich vorgesehen?« fragte er. »Willst du mich erziehen, mich leiten, mich schockieren oder inspirieren, mich aufrütteln, aufpassen, daß ich nicht in den Porzellanladen stolpere, oder mich bloß zum Denken bringen?«
Ahmay zuckte die Schultern und überlegte einen Augenblick. »Alles zugleich.«
»Da ich mein Leben selbst entworfen habe, muß auch mein Besuch in der Himmelsbar Teil dieses Entwurfes sein«, stellte Jonathan fest.
Ahmay nickte.
»Also bin ich hier, um etwas zu lernen«, fügte er hinzu. »Die Hunderttausend-Dollar-Frage aber ist: Was?« Er schwieg gedankenverloren. »Als du gesagt hast ›alles zugleich‹, was hast du da genau gemeint? Im Endeffekt bemühst du dich doch eigentlich darum, mir zu mehr Balance zu verhelfen. Ist es nicht so? Hilfst du mir auf dem Weg über meine Vibrationsfrequenzen?«
Ahmay grinste. »Heiß, ganz heiß, Junger Bär. Genau das ist mein Job: dazu beizutragen, daß deine individuelle VF ansteigt. So kann ich dir am besten dienen.«
Den Bruchteil einer Sekunde lang erinnerte Jonathan sich an eine Unterhaltung mit Zorinthalian zum Thema Diener. Dann konzentrierte er sich wieder auf den Augenblick. »Aber zuerst kommt das Erinnern. Dann muß ich es wollen. Stimmt's?«
»Das ist die eine Hälfte. Die andere betrifft das Verhalten: Du selbst mußt deine VF erhöhen, indem du dich in einen Zustand größerer Balance versetzt, indem du Blockaden löst. Dadurch, daß du in der Mitte deines Lebensentwurfs hierhergekommen bist, hast du bewiesen, daß es dir ernst ist. Der letzte Schritt besteht darin, danach zu handeln. Doch schon jetzt hast du große Fortschritte gemacht, Junger Bär.«
197
»Was kann ich sonst noch tun?« fragte Jonathan.
»Wir wollen noch einmal auf deinen Abstecher in die virtuelle Realität zurückkommen«, sagte Ahmay. »Was hältst du von alledem?«
Jonathan schüttelte den Kopf und spürte, wie seine Augen feucht wurden. Er schluckte und mußte sich räuspern. »Sehr stark.« Die Stimme versagte ihm. »Es … hat mich … völlig umgehauen.«
»Was war daran so stark?« fragte Ahmay.
»Also … zuerst mal … Paula. Ich weiß jetzt, daß sie in meinem letzten Leben meine Ratgeberin war. Aber das ändert nichts an meinen Gefühlen für sie. Mir ist auch klar, daß das eine meiner entscheidenden Blockaden ist; das hat sie mir am Klavier so gut wie verraten. Und das ist eine sehr starke und sehr schmerzvolle Botschaft. Ich weiß, daß ich das lösen muß, ehe ich zurückgehe. Und deshalb möchte ich eine Gelegenheit bekommen, sie allein zu sprechen.«
Ahmay nickte. »Und ich habe es dir schon versprochen.«
»Ja, das hast du, und dafür danke ich dir.« Jonathan stand auf und begann, auf und ab zu gehen. »Außerdem haben sich, glaube ich, ein paar von den kleineren Rätseln meines Lebens gelöst. Nachdem ich gesehen habe, was mir als Juanita zugestoßen ist, verstehe ich meine Vorliebe fürs Laufen und auch meine Angst vor dem entgegenkommenden Verkehr.«
»Auch das gehört zu den bleibenden Wirkungen früherer Leben, vor allem der gerade vergangenen«, pflichtete Ahmay bei.
»Doch ein Aspekt dieser virtuellen Realität hat mich wirklich beunruhigt.«
»Was war das?«
»Das kleine Mädchen – also schön: ich selbst – starb und hinterließ eine trauernde Familie. Aber alles, worum es sich 198in diesem Videoclip gedreht hat, das war Juanita und ihr Schmerz und ihr Leiden und wie sich für sie die Dinge in der Himmelsbar verändert haben. Was ist mit ihrem Bruder und ihrem Vater – oh, ich meine mit Mary und Judy? Sie waren ihr im Augenblick, als der Unfall geschah, am nächsten. Stell dir ihren Schmerz vor! Ihre Verzweiflung! Wahrscheinlich haben sich beide für den Rest ihres Lebens Vorwürfe gemacht.«
»So wie du gegenüber deinem Vater?« fragte Ahmay.
Jonathan verstummte. Er war wie vom Schlag getroffen. »So ungefähr«, stotterte er. Mit diesem Thema wollte er sich nicht beschäftigen – jedenfalls noch nicht jetzt. »Nicht nur das, sondern sie mußten den größten Schmerz erleiden, obwohl sie keine Schuld trugen. Juanita hatte es gut. Sie war tot. Ihr physischer und seelischer Schmerz war überstanden, doch der ihrer Familie begann erst. Was haben eure Universalprinzipien dazu zu sagen?«
»Ramda«, rief Ahmay aus, »Ramda, ich brauche deine Hilfe.«
»Komme schon, Mama«, brummte die tiefe Stimme des Computers.
Ahmay verdrehte über Ramdas aufgesetzten Humor die Augen. »Unser Freund aus San Diego benötigt deine Sachkenntnis in puncto Unglück und warum es dem Betrachter manchmal widerfährt.«
»Natürlich«, sagte Ramda. »Jonathan, erinnerst du dich an unser früheres Gespräch darüber, daß subjektive Schlußfolgerungen nicht Teil unserer Aufgabe hier in der Himmelsbar seien?«
Jonathan nickte.
»Wir hatten uns dabei über den Tod unterhalten«, fuhr Ramda fort, »hatten festgestellt, daß ein bestimmtes Leben oder ein Lebensplan nicht in sich selbst vollendet sei, daß der 199Tod weder ein unglückliches noch ein glückliches Ereignis, sondern lediglich das Ende des Lebens und die Fortführung des Seelenlebens sei – eine Erkenntnismöglichkeit, wenn du es so willst. Im Grunde genommen verdeutlicht dieses Beispiel sehr schön die Rolle des Unglücks im gesamten Lebensentwurf: Unglück ist die Chance einer neuen Erfahrung; mehr noch – ein Geschenk.«
»Ein Geschenk?« platzte Jonathan heraus. »Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein! Erzähl das mal Juanitas Bruder oder ihrem Vater. Erzähl das den Eltern in den kalifornischen Städten, die starr vor Entsetzen mitansehn müssen, wie ihre Kinder vor ihren Augen von Autokillern erschossen werden. Erzähl das mal den Eltern in Afrika oder Indien oder Südamerika, die zuseh'n, wie ihre Kinder verhungern. Erzähl das den Familien in Bosnien, die hilflos dabeistanden, als die Menschen, die sie liebten, von den Soldaten kaltblütig auf die Straßen getrieben und ermordet wurden. Wenn das ein Geschenk sein soll, kannst du es für dich behalten!«
Ramda räusperte sich. »Jonathan«, sagte er in freundlichem, doch zwingendem Ton, »bitte, gib acht auf meine Worte. Meine Worte sind Worte der Liebe. Du wirst dich mit Paula noch eingehender über die Liebe unterhalten. In bezug auf die Liebe gehört sie zu den besten Ratgebern des Universums. Alles, was wir hier in der Himmelsbar tun, hat mit Liebe zu tun. Alles. Meine Vorstellungen von Liebe und Fürsorge und Pflege und Balance und Harmonie; auch Ahmay und sein Fachgebiet, die Spiritualität; ebenso Mark und seine überwältigende Kenntnis deines Körpers. Der Kitt oder der gemeinsame Nenner für alles, was wir hier tun, ist die Liebe. Das mußt du, und sei es a uch nur auf intellektueller Ebene, zur Kenntnis nehmen.«
»Ich glaube es ja«, sagte Jonathan. »Bis in die Tiefen meines Seins glaube ich es.«
200
»Na gut«, seufzte Ramda, »dann haben wir jetzt einen Ausgangspunkt. Also, in der Liebe geht es um Balance und Harmonie. Balance hat mit Lernen zu tun; und das ist der Grund, aus dem das Individuum sein Leben entwirft: um Balance zu lernen. Ein Teil dieses Lernprozesses besteht im Lernen aus dem Unglück, weil das Unglück integraler Bestandteil der Lebenserfahrung ist. Dabei geht es nicht darum, den Schmerz und das Leiden, den das Unglück bewirkt, in ihrer Bedeutung herabzusetzen oder zu banalisieren. Ein Unglück ist zutiefst traumatisierend und erschreckend. Ich spreche aus ureigenster Erfahrung, doch das gehört nicht zur Sache. Es geht darum, daß das Unglück Schmerz und Verzweiflung auslöst. Du bist geneigt, den Schwerpunkt deiner Betrachtung des Unglücks allein auf die physische Wirklichkeit zu legen, während das Unglück in Wahrheit gar nicht wirklich ist. Es ist eine Reflexion der Wirklichkeit. In Wahrheit ist das Unglück ein treffendes Beispiel für die formgebende Kraft des Gedankens. Aus all diesen Überlegungen zum Thema Unglück folgt der Satz: ›Energie Ist Grenzenlos Und Mächtig‹. Gesteht man dem Unglück größere Macht zu als dem Leben selbst, dann wird es tatsächlich dazu werden. Wird hingegen«, sagte Ramda und räusperte sich, »das Unglück als eine weitere Chance begriffen, am Leben zu wachsen und zu lernen, dann läßt es sich leichter handhaben, läßt neue Kräfte entstehen und kann die Balance fördern helfen. Wenn das Denken oder die ›Haltung‹ durch die Überzeugung bestimmt ist, daß sich das Unglück durch den Gebrauch der grenzenlosen und mächtigen Energie als weitere Lebenserfahrung nutzen läßt, so bedeutet dies einen Riesenschritt in Richtung Harmonie und Balance.«
Jonathan hörte auf, hin und her zu laufen, setzte sich und stürzte sein Bier hinunter. Dann zerdrückte er die leere Dose mit einer Hand und warf sie in einen Mülleimer neben seinem 201Sessel. »Darüber kann man ohne weiteres einen intellektuellen Disput führen, Ramda«, sagte er, »aber das ist nicht gerade eine große Hilfe, wenn man eben erst dabei ist, sich zurechtzufinden.«
»Haltung ist alles«, sagte Ramda. »Hast du je den Film ›Lawrence von Arabien‹ gesehen?«
Jonathan brummte nur.
»Es gibt da eine Szene – ganz am Anfang des Films -, in der Lawrence, als er noch als Offizier und Gentleman in Kairo lebt, erfährt, daß er in einer diplomatischen Mission in die arabische Wüste geschickt werden soll, weil er die Sprache spricht. Er ist dort nie vorher gewesen, noch hat er je die Strapazen der Wüste kennengelernt. Ein Kamerad fragt ihn, wie er mit dem Wassermangel und der Hitze fertig werden will. Lawrence antwortet ihm, indem er ein Streichholz anzündet, es herunterbrennen läßt, bis es ihm die Finger verbrennt, und er es dann mit den bloßen Fingern der anderen Hand auslöscht. Sein Kamerad fragt: ›Wie machst du das? Tut dir das nicht weh?‹ Lawrence erwidert: ›Natürlich tut es weh. Das Geheimnis besteht darin, sich nichts daraus zu machen, daß es wehtut‹.«
Jonathan schüttelte den Kopf. »Ich muß erst noch ein bißchen über diese Unglücksgeschichte nachdenken. Ich hab zuviel Zeit und Gewohnheit in das Schauspielchen investiert. Es ist außerordentlich anstrengend, hier mal so reinzuschauen und mir von dir und Ahmay erzählen zu lassen, daß ich ein Haltungsproblem hätte, wenn's um Schmerz und Leiden geht, und dann einfach aufzuhören, das zu tun, was ich seit siebenunddreißig Jahren tue. Dazu braucht es ein paar konzentrierte Hochleistungsübungen mit den Universalprinzipien.«
»Das respektiere ich«, sagte Ramda. »Noch ein letzter Gedanke: Manchmal kann das Unglück unseren illusionären 202Glauben an den Wirklichkeitscharakter der Form ins Wanken bringen. Die Form kommt in allen möglichen Verkleidungen daher – in Hautfarbe, Rasse, Religion, politischen Bekenntnissen, Nationalität, einem Haus, Reichtum, einer jugendlichen Erscheinung, Erziehung, kulturellem Erbe oder dem eigenen Milieu. Noch einmal: Aus der Perspektive des Physischen allein ist der Sinn des Unglücks niemals zu erschließen. Unglück kann auf seine Art den Prozeß der Durchdringung scheinbarer Wirklichkeiten unterstützen, der zur Göttlichen Wirklichkeit führt. Es schenkt die Verbindung von Seele zu Seele, wenn die Menschen sich von der Überbewertung des Denkprozesses freimachen und nur noch im Einklang miteinander handeln – so, wie die Menschen beim letzten Erdbeben von Los Angeles einander helfen, und davor bei der Überschwemmung im Mittelwesten sich ganz einfach lösen und handeln, dann hat ihre Seele die Chance auf Vereinigung und Balance.«
Ramda hielt inne. »Vergiß nicht, Jonathan, diese Gedanken in deinen Überlegungen einzubeziehen, wenn du dich dann noch kenntnisreicher weiter diesem Thema widmest.«
»Ich habe an dieser Stelle auch noch etwas zu bemerken«, sagte Ahmay. »Eine wichtige Lektion läßt sich kaum je in einem einzigen Leben lernen. Dann kommt das Lernen häufig erst nach der Erfahrung, nachdem man Zeit hatte, das Erlebte einzuordnen und die Lehre zu verstehen. Wenn man die Lehre einmal verstanden hat, kann man sich eine Erlebnissituation wie ein weiteres Erdenleben schaffen und der Lehre entsprechend handeln. Handelt man dieser Erkenntnis gemäß in PEIS-scher – physikalischer, emotionaler, intellektueller und spiritueller – Hinsicht, so hat man seine Lektion wirklich gelernt. Dann bewegt sich das Leben in sanfteren, freieren Bahnen, hin auf Harmonie und Balance.«
Jonathan stand auf. »Ich glaube, bei mir ist gleich ›System 203overload‹, und außerdem hab ich fast keine Zeit mehr. Ich muß mich mit Paula treffen.« Schon zur Tür gewandt, fügte er noch inzu: »Danke, Ramda.«
Jonathan eilte mit Ahmay den Flur hinauf in Richtung Bar und Restaurant. »Wann ist Paulas Schicht zu Ende?«
»Jeden Augenblick«, sagte Ahmay, während er mit dem jüngeren Mann Schritt hielt. »Soll ich sie für dich suchen gehen?«
»Ja, danke. Ich bin dann an der Bar. Ich möchte Zorinthalian etwas fragen.«
»Du sagst mir aber noch auf Wiedersehen, ehe du gehst, ja?« bat Ahmay.
»Keine Angst«, versicherte ihm Jonathan.
Als er in die Bar kam, bediente Zorinthalian gerade einige andere Gäste. Zwei von ihnen starrten Jonathan an und winkten, als er sich setzte. Sie kamen ihm irgendwie bekannt vor, deshalb winkte er halbherzig zurück.
»Erkennst du sie nicht?« fragte Zorinthalian und stellte eine Schüssel mit Salzgebäck vor Jonathan hin.
Der Besucher schüttelte verneinend den Kopf.
Der Barkeeper lächelte. »Das ist erstaunlich«, sagte er. »So oft, wie du schon hier gewesen bist, hätte ich nicht gedacht, daß du dich an diese zwei nicht erinnern würdest.« Er schwieg und holte tief Luft. »Alles zu seiner Zeit … Was wolltest du mich fragen?«
Jonathan unterdrückte ein Lächeln. Es war ihm noch immer nicht ganz wohl dabei, daß hier fast jeder seine Gedanken las. »Gehörst du zu meinen Ratgebern?«
Zorinthalian hob die Augenbrauen. »Deine Offenheit beeindruckt mich«, sagte er und blickte dem Besucher in die Augen. »Nein, ich gehöre nicht zu deinen Ratgebern, noch nicht. Aber ich möchte dir etwas zeigen.«
Er kam hinter der Bar hervor und ging zu einem der 204Schilde an der Wand. Es war jener, der Jonathan bei seiner Ankunft besonders aufgefallen war. Auf dem Schild waren Dreiecke abgebildet, durchkreuzt von Linien, die Jonathan an gezähmte Blitze erinnerten.
Zorinthalian winkte Jonathan zu sich herüber. »Dieser Schild stammt von einem ganz besonderen Ort im Universum«, sagte er und schaute Jonathan aufmerksam an. »Was hältst du davon?«
Der Besucher nahm den prüfenden Blick des Barkeepers nicht zur Kenntnis. Er starrte nur auf den Schild und untersuchte eingehend dessen Emblem aus verschlungenen Kreisen auf der rechten Ecke. Ruhig, Taylor, ermahnte er sich. Reg dich nicht über die Angst auf, die dich jetzt wieder beschleichen will. Der Bursche ist okay. Irgend etwas Unheimliches geht hier vor, aber du mußt dich entspannen.
»Es hat etwas quälend Vertrautes an sich«, sagte Jonathan. »Dieser Schild hat meinen Blick gleich vom ersten Augenblick an auf sich gezogen.«
Zorinthalian deutete auf den Schild. »Er ist aus meiner Heimat«, sagte er.
Zum ersten Mal bemerkte Jonathan, daß Zorinthalians Hand sich von seiner unterschied: Sie hatte einen Daumen und fünf Finger. Ein gespanntes Prickeln durchlief Jonathan, und er konnte Zorinthalians Gedanken lesen – oder doch einige von ihnen. Der Barkeeper war sich nicht sicher, wie weit er Jonathan einweihen sollte.
»Wer bist du in Wirklichkeit?« brach es aus Jonathan hervor.
»Dazu kommen wir später«, sagte Zorinthalian. »Sag mir, hat Ahmay die Analogie von der Erde als Schule gebraucht?«
Jonathan nickte.
»Nun, du sollst wissen, daß es überall im Universum noch eine Unmenge weiterer Schulen gibt«, sagte er. »Genau betrachtet 205Millionen von Schulen, je nachdem, welche Lektionen man lernen möchte. Du hast dich zuletzt für die Erdenschule entschieden.«
Jetzt reiß dich bloß zusammen, Taylor. Nimm dir einen Augenblick Zeit, die Sache durchzudenken, ehe du den Boden unter den Füßen verlierst. Er unterdrückte seine Zweifel. »In welche Schule bin ich vorher gegangen?«
Zorinthalian lächelte. »Wenn die Zeit reif ist, wirst du die Antwort auf diese Frage kennen. Alles, was ich dir jetzt schon sagen kann, ist, daß meine Heimat die Sieben Schwestern sind – die Plejaden.« Er hielt inne und blickte Jonathan gedankenverloren an.
Jonathan musterte den großen, klobigen Mann. »Und könntest du beschreiben, wer du eigentlich bist?«
»Jeder kommt von irgendwo anders her«, sagte Zorinthalian ganz sachlich. »So, wie in der Genealogie der Vereinigten Staaten alle Nationalitäten, Religionen und ethnischen Gruppen zusammenfließen, so ist es auch in der Milchstraße – nur daß dort das Bezugssystem das Universum ist. Wir alle streben danach, zur Einheit zurückzukehren«, fuhr Zorinthalian fort. »Das ist der Grund, warum die Erde und vor allem die Vereinigten Staaten als Schule der Erfahrungen so beliebt sind. Amerikas Wahlspruch lautet E Pluribus Unum, was, wie du weißt, ›Aus der Vielfalt die Einheit‹ bedeutet. Genau das geschieht im gesamten Universum: Jeder sucht nach seinem Weg zur Balance, was bedeutet, daß wir uns am Ende des Weges alle in der Einheit zusammenfinden werden. Um also deine Frage zu beantworten: Wer bin ich – Ich bin ein Reisender von einem anderen Ort, aus einer anderen Zeit.«
Jonathan stand neben dem großen, muskulösen Mann, den er Zorinthalian nannte, und starrte sprachlos auf den Schild. Du kannst ihm nicht vorwerfen, daß er lügt, Taylor, dachte er. Es gibt zu viele Beweise dafür, daß er kein Lügner 206ist. Aber das, was er sagt, für bare Münze zu nehmen, ist viel verlangt. Wie kann das alles angehen?
»Wenn du soweit bist«, sagte Zorinthalian, »werde ich mit dir arbeiten, um dir den Weg zurück zur vollen Entfaltung all deiner Talente zu zeigen. Nun, da du die Universalprinzipien kennst, sollte das nicht mehr schwerfallen. Doch zuerst mußt du deine eigene Balance finden.«
»Wie soll ich das machen?« fragte Jonathan laut.
»Lebe nach den Universalprinzipien«, sagte der Mann mit den außergewöhnlichen Händen. »Dazu wirst du mehr Mut, Geduld und Ausdauer brauchen, als du je aufbringen mußtest. Ehe ich an dir arbeiten kann, wirst du imstande sein müssen, mit einer noch höheren Vibrationsfrequenz als der Ramdas umzugehen.«
»Woran wirst du mit mir arbeiten?«
»Noch fehlt dir dazu eine Vielzahl an Erkenntnissen: deine entferntere Vergangenheit, ein Großteil deiner künftigen Lektionen und deine verborgenen Fähigkeiten und Talente. Daher würde es dir jetzt noch nichts nützen«, sagte Zorinthalian. »Es mag genügen, wenn ich sage, daß ich dir Informationen über dein Erbe, über das Heilen und darüber zukommen lassen werde, wie du deinem Ziel näherkommen kannst. Du mußt zuerst wissen, daß du und auch andere euch auf diese Entwicklungsperiode der Erde lange vorbereitet habt. Dasselbe Drama, welches sich dort abgespielt hat, hat sich bereits auf kosmischer Ebene abgespielt. Die Bühne ist bereit für vieldimensionale Darsteller und Geschehnisse. Jetzt ist die Zeit gekommen, da deine harte Arbeit Früchte tragen soll.«
Jonathan studierte die Insignien auf dem Schild. Plötzlich begriff er. Die vier miteinander verbundenen Kreise auf dem Schild stellten vermutlich eben die Grundsätze dar, die Ahmay und Jonathans übrige Ratgeber ihm eingehämmert 207hatten: PEIS. Genau darum geht es, sagte er sich. Und es geht darum, daß er die emotionalen und spirituellen Aspekte seines eigenen Seins vernachlässigt hatte.
Zorinthalian strahlte. »Du hast es erfaßt, Junger Bär«, sagte er. »Hast du was dagegen, wenn ich mir Ahmays Spitznamen für dich ausborge?«
Jonathan schüttelte den Kopf.
»Gut«, sagte der Barkeeper. Er wandte sich um, umarmte Jonathan schnell und gab ihn dann frei. Die wilde Kraft und Energie aus den Händen und Armen dieses Mannes durchfuhr Jonathan wie eine führerlose Lokomotive. Er bekam Gänsehaut am ganzen Körper. Er sah sich einer stillen Herrlichkeit gegenüber; einem gütigen und dennoch starken Diener.
»Ich bin sehr stolz auf dich, mein Freund«, sagte Zorinthalian, trat zurück und musterte den Besucher. »Deine Analyse über den Grund deines Kommens beweist tiefes Verständnis. Du hast noch nicht alle Lektionen deines Besuches erhalten, doch ist deine Bereitschaft zum Zuhören und zur Wiederverarbeitung alter und neuer Informationen höchst bemerkenswert. Ich wünschte, alle unsere Besucher wären so offen.«
Er schwieg und dachte nach. Dann zeigte er wieder auf den Schild. »Dieses Symbol wird dir auf der Erde zur rechten Zeit und am rechten Ort begegnen. Wenn es dir erscheint, dann wird es der Schlüssel sein, mit dem sich dir das hier Geschehene erschließt. Bis dahin.« Zorinthalian nickte kurz, wandte sich ab und kehrte an die Bar zurück.
Jonathan blickte dem Barkeeper in tiefster Ehrfurcht nach. Wer mag er wirklich sein? Hoffentlich finde ich es eines Tages heraus. Meine Zeit hier muß schon fast um sein. Was wohl mit Ahmay geschehen ist? Er hat gesagt, er wolle für mich nach Paula suchen. Es wäre so schön, mit ihr ein wenig zusammenzusein. Ich hab ihr so viel zu erzählen.
208
»Warum erzählst du es mir nicht gleich?« ertönte eine melodiöse Frauenstimme direkt hinter ihm.
Er fuhr herum, um zu schauen, wer dort war.
Es war Paula.
209
»Liebe … existiert nicht irgendwo da draußen … Liebe
ist eine Entscheidung, und Liebe ist überall.«
Paula hatte ihr langes, blondes Haar aus dem Knoten gelöst. Jetzt schimmerte es in der unwirklichen Beleuchtung der Bar. Sie hatte Uniform und Kittel gegen ein hübsches Sommerkleid getauscht. »Was meinst du«, sagte sie und nahm Jonathan bei der Hand, »sollen wir einen Spaziergang machen?«
Jonathan fühlte, wie sein Herz sprang, und er schluckte, weil seine Kehle auf einmal zu trocken war zum Sprechen. »Gern«, brachte er mühsam hervor.
Sie führte ihn in die stille Nacht hinaus.
Er blickte auf den dunklen Himmel, der von hellen Sternen erleuchtet wurde. Es waren die hellsten, die er je gesehen hatte. Der Mond war nicht da, doch er sah ihre beiden Schatten im weichen Gras, als sie nun durch den üppigen Park schlenderten.
Paula blieb stehen und küßte ihn sanft auf die Wange. »Es tut gut, dich wiederzusehen, Jonathan.«
Er starrte sie an, sprachlos und verwirrt. Sein Herz raste, und er sehnte sich danach, sie in seine Arme zu schließen, sie an sich zu drücken und zu küssen, wie in alter Zeit. Er konnte sich nicht entscheiden, ob er vor Freude in die Luft springen oder sich auf Trauer und Enttäuschung gefaßt machen 210sollte. Es lag etwas Unheilvolles in ihrem Verhalten: Sie war zu sehr darum bemüht, ihn zu beruhigen.
»Ich bin mir wirklich nicht darüber im klaren, was wir einander bedeuten«, sagte er und holte tief Luft, ehe er ihren Blick erwiderte. »Ich weiß, daß wir beide derselben Seelengruppe angehören; und ich weiß, daß du so etwas wie mein Schutzengel warst, als ich noch Juanita war. Aber weiter weiß ich überhaupt nicht, was los ist.«
»Selbst nach deiner Unterhaltung mit Ramda und Ahmay nicht?« Paula lenkte ihn auf einen Fußweg durch den Park. Der Abend war warm und mild. Eine leichte Brise ließ die Bäume rauschen und wehte Paula das Haar in das schöne Gesicht.
»So ist es«, sagte er und fühlte sich ein wenig unbehaglich, weil er nicht begriff. »Selbst nach meinem Gespräch mit den beiden nicht.«
Sie schaute zum Himmel und deutete nach oben.
Mit den Augen machte er eine Aufnahme von ihrem großartigen Profil, das sich im Sternenlicht abzeichnete: kräftige Nase, volle Lippen und ein makelloser Mund, große, wunderliche Augen, und ein energisches, doch weiches Kinn. Tief in ihm fühlte er Liebe aufsteigen – ein Gefühl, das er lange, lange nicht mehr gekannt hatte.
»Du gibst nicht acht«, sagte sie sanft.
»Tut mir leid«, entschuldigte er sich, den Blick in den Himmel gerichtet.
»Ich schaue mir einfach gern die Sterne an.« Sie wandte sich ihm zu und sah ihn eine Weile an. »Eigentlich ist das sogar eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.«
Jonathan erwiderte ihren Blick. Dann schaute er wieder zu den Sternen auf. Schlagartig war da die Erinnerung an die vielen langen Abende, an denen er von dem Wellenbrecher aus die Sterne betrachtet hatte. »Ich auch«, sagte er leise.
211
»Natürlich«, sagte sie. »Wir sind Zwillingsflammen, Jonathan. Hast du das nicht gewußt?« Er schüttelte den Kopf. Ein plätschernder Bach floß ganz in der Nähe; und er bat Paula, dort eine Weile zu bleiben. Sie fanden einen großen Felsblock. Seine dem Wasser zugewandte Seite war abgeflacht, und sie setzten sich, mit dem Rücken gegen den Stein gelehnt, auf den Boden.
»Was sind Zwillingsflammen?« fragte er.
»Zwillingsflammen«, sagte sie und nahm wieder seine Hand, »sind zwei geistig-seelische Energien mit fast identischer Vibrationsfrequenz. Viele andere Energien – oder in deinem Falle Menschen – haben Vibrationsfrequenzen, die der deinen sehr ähnlich sind, doch Zwillingsflammen sind sich am nächsten. Wir«, sie unterbrach sich, um ihn wieder auf die Wange zu küssen, »sind Zwillingsflammen. Schon seit vielen tausend Jahren.«
Jonathan stützte sein Gesicht in beide Hände und schüttelte den Kopf. »Das ist so unfaßbar«, sagte er. »Ich finde einfach keine Worte, um zu sagen, was ich fühle. Erst bin ich Energie in beständiger Reinkarnation, dann bin ich Teil einer Seelengruppe, deren Mitglieder beständig in alle Ewigkeit gemeinsam lernen, oh, und dann habe ich so ganz nebenbei jetzt auch noch eine Zwillingsflamme: jemanden, der mit mir in alle Ewigkeit durch Zeit und Raum reist und mir näher ist als irgend jemand sonst in der gesamten Schöpfung.« Er nahm ihre Hand und blickte kopfschüttelnd in den klaren Himmel hinauf. »Klingt ein bißchen weinerlich, oder?« Wieder schwieg er. »Heißt das, wir haben dieselbe Energie?«
Sie lächelte. »Ja und nein«, sagte sie und strich sich das Haar aus den Augen. »Alle Energie kommt aus einer Quelle – der Einheit. Jeder von uns ist im Bewußtsein des anderen auf ewig gegenwärtig. In diesem Sinne sind auch wir verbunden 212oder haben dieselbe Energie. In anderer Hinsicht aber sind unsere Energien komplementär: Unsere beiden Energien zusammengenommen ergeben ein Ganzes – du auf der Rechten, ich auf der Linken, oder umgekehrt; du als die Frau, ich als der Mann oder umgekehrt. Dabei geht es nicht so sehr um das Geschlecht, sondern vielmehr um komplementäre Merkmale, wie sie durch männliche und weibliche Vertreter der Gattung Mensch verkörpert werden.«
Er wandte sich ihr zu und schaute sie an. Voller Leidenschaft flüsterte er: »Ich mußte immer nur an dich denken, seit ich dich in der Bar zum ersten Mal sah. Ich fühle mich dir so nah. Näher als irgend jemandem sonst. Ich möchte dich einfach nur festhalten und dich küssen und dich lieben.«
»Ich weiß, daß du das willst«, sagte sie, zu ihm gewandt. Ihre Nasen berührten sich beinahe.
»Ich fühle, daß wir uns geliebt haben. Ich habe ja all diese Erinnerungen gespürt und vor mir gesehen.«
»Du hast völlig recht«, sagte sie. »Und wir waren großartig. Aber was wirklich zählt, sind nicht so sehr die körperlichen Aspekte unserer vergangenen und zukünftigen Liebe, sondern der Ausdruck, den sie findet. Erinnere dich: Das Leben auf der Erde ist zum Lernen da; es ist kein Ferienaufenthalt. Es hat mit Herausforderungen und Entscheidungsmöglichkeiten zu tun. Du willst dich entwickeln, also mußt du den Preis dafür in Form von individueller Disziplin und Opferbereitschaft zahlen. Das heißt nicht, daß du ein Leben in Trübsal führen mußt. Es heißt, daß du lernen mußt, die Liebe in allen Dingen zu spüren, auch dann, wenn es dich Überwindung kostet. Die schönste Liebesgabe, die du mir und dir selbst machen könntest«, fuhr Paula fort, und ihre Lippen berührten fast seinen Mund, »wäre, wenn du dich bei deiner Rückkehr emotional und intellektuell von mir lösen könntest. Du machst es uns beiden doppelt schwer, und 213du blockierst dich selbst. Unbewußt hast du die Frauen, mit denen du zusammen warst, mit mir verglichen. Das macht dir jede gesunde Beziehung zu einer Frau unmöglich. Niemand kann mit einem Geist konkurrieren. Und das sollten sie auch nicht nötig haben. Es ist den Frauen gegenüber nicht fair. Es ist mir gegenüber nicht fair. Doch vor allen Dingen ist es dir selbst gegenüber nicht fair.«
Jonathan fühlte sein Herz rasen. Er bekam Gänsehaut am ganzen Körper, und seine Lippen zitterten. Er konnte nicht widerstehen. Er legte den Arm um sie, schloß die Augen und küßte sie auf den Mund. Paula erwiderte den Kuß. Sie umarmten und küßten sich wieder und wieder. Ihre Küsse wurden länger und intimer. Jede Zelle in seinem Körper tanzte vor Freude und Entzücken. Er öffnete die Augen. Ein pinkfarbenes Leuchten hüllte sie beide ein.
Erschrocken sprang er auf und wollte davonlaufen. Die pinkfarbene Energie blieb bei Paula, schrumpfte jedoch auf die Größe eines Fußballs zusammen und schwebte vor ihrer Brust. Sie umschloß das Lichtfeld mit beiden Händen und vollführte an seiner Außenseite kreisförmige Bewegungen. Es sah aus, als streichle sie ein kleines Pelztierchen.
»Was ist das?« fragte er.
»Das ist Liebe«, erwiderte sie und hielt es vorsichtig in der Hand. »Tatsächlich ist es ein Ausdruck der Liebe in Form eines Lichtfelds. Noch genauer gesagt, ein Ausdruck unserer Liebe.« Sie streckte die Hand nach ihm aus. »Komm und berühr es einmal. Es tut dir nichts.«
Er kniete nieder und reichte ihr die Hand. Sie führte seine und ihre Hand an den Rand des Lichtes. Als er es sanft berührte, spürte er etwas, verstand aber nicht, was es war. Irgendwie erinnerte es ihn an einen Luftvorhang. Er hielt die Hand in das Innere des pinkfarbenen Lichts. Ein warmes, entspannendes Prickeln durchlief ihn, erfaßte sein ganzes 214Sein und erfüllte ihn mit einem überwältigenden Gefühl noch tieferer Liebe zu dieser Frau – dieser »Zwillingsflamme«. Der pinkfarbene Energieball nahm an Größe und Leuchtkraft zu.
»Es lebt«, sagte er und setzte sich wieder.
Sie lächelte. »Du hast recht. Was du hier siehst, ist in jedem Augenblick und in allen Teilen des Universums, in allen Universen gegenwärtig. Liebe ist das Wesen aller Dinge. Sie ist der Treibstoff, der in unserem Innern und im Innern aller anderen denkenden Lebewesen für Bewegung sorgt. Sie ist das Herzblut all dessen, was ist. Es ist so, wie dir Ramda bereits gesagt hat: ›Die Liebe hat mit Harmonie und Balance zu tun.‹«
Er blickte wieder in den Himmel. »Wenn die Liebe so wunderbar ist«, sagte er, »warum ist sie dann auf der Erde so schwer zu finden?«
»Das hat viele Gründe«, sagte sie. »Erstens ist da das Wort selbst. Wenn man versucht, das Wort ›Liebe‹ anders als mit Hilfe der Universalprinzipien zu definieren, dann bereitet das Probleme. So wird zum Beispiel der sexuelle Akt oft mit Liebe verwechselt. Sex ist nicht Liebe. Es ist als Handlung potentieller Ausdruck der Liebe. Es gibt für zwei Menschen keine bessere physische Möglichkeit, ihre innige, tiefe Liebe füreinander auszudrücken. Deshalb werden Sex und Liebe oft fälschlicherweise für identisch gehalten. Das ist eines der Hauptprobleme auf der Erde.«
»Sehr wahr«, sagte er. »Doch das ist nicht das einzige Problem bei der Suche nach Liebe auf der Erde. Das ganze ist viel komplexer.«
Paula strahlte. »Ich bin so glücklich über unser Gespräch«, sagte sie und wandte sich ihm zu. Er schaute ihr in die Augen. »Du hast absolut recht. Auf der Erde kann Liebe etwas sehr Kompliziertes sein. Zuerst einmal gibt es verschiedene 215Arten von Liebe: Freundschaft, Familienbande, Liebe zur Menschheit und zur Natur. Innerhalb dieser Kategorien gibt es wieder genügend Schattierungen und Nuancen für mehrere Ewigkeiten, doch es gibt einen gemeinsamen Nenner: Diese Formen der Liebe finden ihren besten Ausdruck in den unterschiedlichen Aspekten des Selbst.«
Jonathan fügte hinzu: »Du meinst PEIS, im Physischen, Emotionalen, Intellektuellen und Spirituellen.«
»Genau das meine ich.« Paula strich sanft über seine Wange. »Die physische Seite der Liebe kann auf vielerlei Weise Ausdruck finden: in einer Liebkosung, einem Blick, einem Lächeln, einem Kuß. Wenn der Mensch eine emotionale Verbindung mit einem anderen Menschen oder einem Teil der Natur eingeht, erfährt er Zuwendung, Fürsorge, Glück, Verzückung, Erregung und Wärme, um nur einige zu nennen.« Sie blickte auf ihren Schoß hinunter. »Der emotionale Ausdruck dieser Liebe wächst und wächst wie dieser Ball aus Energie so lange, wie er durch Anteilnahme, Fürsorge und Hingabe umhegt und genährt wird. Das ist der emotionale Grund für die Komplexität der Liebe auf Erden.
Und dann«, sagte Paula, tat einen tiefen Atemzug und rieb den Ball aus pinkfarbenem Licht, »dann ist da der intellektuelle Aspekt, der die vollkommene Annahme oder die bedingungslose Liebe voraussetzt – ein Akt des Willens, könnte man sagen. Das ist ein Entwurf, der sich nur schwer in die Tat umsetzen läßt.
Und schließlich ist da noch der spirituelle Aspekt des Versuches, die Liebe auf Erden zu entdecken. Er fordert von den Menschen die Überzeugung ihrer Verbundenheit mit der Einheit oder der Göttlichen Wirklichkeit, die letztendlich gleichbedeutend ist mit der Vollendeten Liebe. Aus dieser Überzeugung entstehen ein innerer Friede und eine Glückseligkeit, die es ermöglichen, allen anderen Aspekten des Liebesgedankens 216ihren natürlichen Lauf zu lassen. Ohne sie ist es schier unmöglich, auf Erden Liebe empfinden zu wollen.
Eins noch«, sagte sie. »Der Begriff ›Liebe finden‹ ist völlig unzutreffend. Liebe ist nicht irgendwo auf der Erde draußen verborgen oder verlorengegangen. Liebe ist eine Entscheidung, und Liebe ist überall. Liebe will erkannt, genährt, umsorgt und geteilt werden. Erst das Teilen läßt die Liebe heller brennen.«
Sie blickte auf den Lichtball hinunter. Er war gewachsen.
Jonathan schwieg. Beide schlossen die Augen und lauschten eine Weile dem Rauschen des Baches. Diesen Augenblick wollte er für immer in seiner Erinnerung bewahren. Jede Sekunde mit Paula war so voller Zauber.
»Das Problem hat auch damit zu tun«, sagte er, »daß so vieles auf der Erde auf Angst beruht.«
Der pinkfarbene Ball begann zu schrumpfen.
Paula nickte. »Das stimmt. Aber davor mußt du dich bewahren. All deine Energie muß sich auf die Entscheidung für die Liebe und den Abbau von Blockaden konzentrieren. Wenn das geschieht, wird dein Weg durch die Dunkelheit von Unentschlossenheit, Unsicherheit und Unwissenheit durch das Licht der Liebe und Balance erhellt werden.
Laß uns einige Symptome der Furcht im PEIS betrachten: Furcht wird im physischen Bereich als Unwohlsein und Schmerz empfunden; im emotionalen als Einsamkeit und Haß; im intellektuellen als Vorurteil und Befangenheit; im spirituellen als Leere und Verzweiflung. Welche Form von Angst wir uns auch ansehen: Flugangst, Angst vor dem Wasser, Angst vor offenen oder geschlossenen Räumen, vor schwarzen Katzen, vor öffentlicher Rede, vor Insekten, dem Tod oder wovor auch immer – sie alle entspringen einem Gefühl der Bindungslosigkeit. Das Gegenmittel ist Wissen und 217Erfahrung. Mit anderen Worten: Licht. Das Licht der Liebe zum anderen und im anderen Mensch.«
Jonathan bemerkte, wie der Lichtball wieder größer wurde. Er lachte. »Mir scheint, das ist seine Art, mit dem Schwanz zu wedeln. Der Kleine reagiert aber ganz empfindlich auf Worte.«
Paula lächelte. »Worte sind wichtig, weil sie Gedanken in Umlauf bringen. Denn das macht die Situation auf der Erde zusätzlich problematisch: All die Technologie des Einundzwanzigsten Jahrhunderts macht die Leute nachlässig im Umgang mit ihren kommunikativen Fähigkeiten. Der Mangel an Kommunikation führt zu mangelndem Verständnis und einem Verlust an Balanace, die ihrerseits weiterreichende Folgen haben.
Du kennst den Begriff der ›Reflexion‹. Auch die Reflexion ist eine Gesetzmäßigkeit der Energie und ein treffender Ausdruck zur Beschreibung eines Maßstabes, den du anwenden kannst, um herauszufinden, wie sich die Dinge auf der Erde, besonders aber bei dir selbst entwickeln.«
»Ich hoffe, ich kann das alles behalten«, sagte er.
»Kein Problem«, sagte Paula. »Wenn du sehen willst, wie du vorankommst, dann vergleiche deine Vergangenheit mit deiner Gegenwart. Da du alles selbst geschaffen hast, ist es ein ausgezeichneter Lehrspiegel. Wenn dich das, was du eigentlich lernen solltest, durcheinander bringt, dann schau nach, wie du den, der dir gerade gegenübersitzt, begreifst. Wenn du nicht weißt, ob du ein liebender Mensch bist, dann schau in dein Herz und frag dich, ob du deine Liebe mit denen teilst, die um dich sind. Wenn du bei anderen Furcht verspürst, dann schau drinnen nach, wo sich die Angst verbirgt. Wenn dich der Zorn eines anderen stört, dann überprüfe, was es ist, das deinen eigenen Zorn hervorruft.«
»Dann läuft die ›Reflexionsmethode‹ im Grunde darauf 218hinaus, daß man, um die Welt zu ändern, erstmal sich selber ändern muß?«
»Bin-go«, verkündete Paula ganz im Tonfall eines Ansagers. »Der beste Weg, alles zu bekommen, was du willst – vor allem Liebe -, ist, den Dingen ihren Lauf zu lassen und das Leben auszuleben, so weit es geht. Hör auf, mit aller Gewalt an der Liebe festzuhalten.« Sie stand auf und ging zum Bach hinunter. Das Sternenlicht spiegelte sich funkelnd im seichten, schnell dahinfließenden Wasser. Sie hielt den pinkfarbenen Ball in der einen Hand und bedeutete Jonathan, zu ihr an den Bach zu kommen. »Ich möchte dir etwas zeigen.«
Er trat an ihre Seite, und sie reichte ihm den Lichtball. Als sich ihre Hände berührten, schwoll der Ball an und schrumpfte dann wieder, als Jonathan ihn allein hielt.
»Siehst du die große Luftblase, die da den Bach runter auf uns zutreibt?« fragte sie und deutete etwa fünf Meter bachaufwärts.
Er nickte.
»Nun schau, was geschieht«, sagte sie.
Als die Luftblase bei ihnen ankam, schöpfte sie sie mit den hohlen Händen aus dem fließenden Wasser und behielt sie in der einen Hand. »Nehmen wir einmal an, diese Blase steht für eine besondere Liebe, die mich mit jemandem verbindet. Ich will das Besondere dieser Liebe unbedingt erhalten und isoliere sie deshalb vom übrigen Strom des Lebens, dann -«. Die Blase zerplatzte. »Jetzt ist das Besondere daran also verschwunden, doch vielleicht kann ich wenigstens an der Liebe selbst festhalten …« Das Wasser begann, ihr durch die Finger zu sickern und tropfte auf den Boden. Wie sehr sie ihre Finger auch zusammenpreßte, das Wasser lief schließlich hindurch. Sie hielt die freie Hand darunter, um den Verlust aufzuhalten. »Na, ein bißchen Liebe wird doch wohl am Schluß noch übrigbleiben«, sagte sie und schloß ihre Hand zur 219Faust. »Die Furcht, noch mehr zu verlieren, läßt mich noch fester zudrücken.« Nach ein paar Sekunden öffnete sie ihre Hände und zeigte sie Jonathan. Sie waren fast vollständig trocken. »Siehst du? Es ist keine Liebe mehr da.«
Jonathan blies die Luft aus den Backen und warf einen Blick auf den pinkfarbenen Ball. Er wurde wieder größer. »Du sprichst von mir, stimmt's?« Er schaute in ihre großen, braunen Augen. »Du willst damit sagen, daß ich dich zu meinem eigenen Besten gehen lassen muß?«
Sie neigte den Kopf und erwiderte seinen Blick. »Ich spreche über jeden beliebigen Menschen in jedem beliebigen Augenblick. Das ganze Leben besteht aus Erfahrung. Du und ich, wir müssen wieder in den Strom des Lebens eintauchen, fröhlich sein, spielen und schwimmen und tauchen und von seinem wunderbaren Wasser trinken. Nur so können wir beide zu unserer Balance finden. Sammle die Erfahrungen, die du für dein Leben – deine Lernerfahrung – brauchst, und tu das mit Liebe. Wenn wir uns daran halten, werden wir einander näherkommen. Die Zeit ist nicht mehr fern, da wir wieder vereint sein werden.«
»Ich weiß«, sagte er. »Und mein Verstand begreift es. Nur mein Herz versteht es nicht. Es tut weh.«
»Dein Herz ist einverstanden«, sagte sie und deutete auf den pinkfarbenen Ball. »Der einzige Grund, warum es wehtut, ist die Angst – die Angst vor dem Verlust einer Bindung. Vergiß nicht, meine wunderbare Zwillingsflamme, unsere Herzen sind für immer vereint. Für immer. Mag das der Furcht vor dem Verlust, die doch nur eine Illusion ist, ein wenig von ihrem Stachel nehmen. Es ist kein wirklicher Verlust: Wir sind vereint – für immer.«
Jonathan nickte, als sei ihm soeben eine Erkenntnis gekommen. »In meinem ganzen Erdenleben hat man mich gelehrt, das zu fürchten, was außer mir ist. Daß ich mich nun 220mit einem Mal selbst als Quelle aller Disharmonie betrachten soll, ist ein ziemlich harter Brocken.«
»Aber«, fügte Paula hinzu, »das Wissen darüber, daß du so viel Angst erschaffen kannst, sollte mehr als wettgemacht werden durch die Erkenntnis, daß du zehnmal mehr Liebe schaffen kannst, indem du einfach losläßt!«
»Du hast recht.« Er kam sich albern vor. »Ich wollte dich eigentlich bitten, von jetzt an meine Sonderberaterin auf Erden zu sein. Doch nachdem ich darüber nachgedacht habe, sehe ich ein, daß daraus nur noch mehr Ängste, keine Liebe erwachsen wären.« Er schwieg, um über das eben Gesagte nachzudenken. »Loslassen … das ist schon hart, vor allem für einen alten ›Fearaholic‹ wie mich. Ich habe dich nämlich ziemlich gern, meine Paula …«
Er schwieg, weil er spürte, wie sich seine Kehle verengte und trocken wurde vor Leidenschaft. Er konnte sich nicht entsinnen, je eingewilligt zu haben, jemanden, den er so sehr liebte, nicht mehr zu sehen, nur weil man ihn darum gebeten hatte.
»Alte Gewohnheiten legt man nicht so leicht ab, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund ist es tatsächlich ein gutes Gefühl, loszulassen«, sagte er laut. »Ich fühle mich schon freier.«
»Ja!« rief sie. Sie sprang auf und küßte ihn mitten auf den Mund. »Du bist so wunderbar, und ich bin so stolz darauf, deine Zwillingsflamme zu sein.« Wieder küßte sie ihn. Mittlerweile hatte das pinkfarbene Energiefeld sie beide eingehüllt. »Ich habe Ahmay und Ramda und Zorinthalian gesagt, daß ich es schaffen würde. Du bist großartig!« Sie küßte ihn wieder und wieder. »Ist dir klar, was das bedeutet?«
»Nein. Was denn?« fragte er völlig verdutzt.
»Du hast den ersten Schritt getan auf dem Weg dahin, 221selbst Lehrer zu werden«, schrie sie und sprang ihm vor Freude in die Arme. »Du bist einer unter Millionen, und du bist meine Zwillingsflamme.« Sie küßte ihn auf Wangen, Nase und Stirn. »Ja! Ja! Ja!«
»Wirklich?« fragte er und versuchte zu verstehen. »Was soll ich lehren, und wen soll ich es lehren?«
»Fürs erste, dir selbst«, sagte sie. »Dein bester Lehrer bist immer du selbst. Von jetzt an wird es deine Aufgabe sein, die Universalprinzipien zuerst einmal anzunehmen und zu leben und sie schließlich mit der Menschheit zu teilen. Bedenke, die beste Art zu lehren, ist das Beispiel.«
Plötzlich flackerte der pinkfarbene Lichtball auf, und ihre Augen weiteten sich. »Oh, ich glaube, es ist Zeit für dich, zu gehen.«
»Was geht hier vor?« fragte er.
»Nur noch ein paar Minuten, ehe man dich zum Vorspiel erwartet.«
»Oh, mein Gott! Ich muß nach L. A. zurück!« Panik ergriff ihn. »Wie soll ich all das behalten, was ich gelernt habe? Und ich habe dir noch nicht einmal den Schluß von meinem Stück vorgespielt.«
»Was die Erinnerung angeht, mach dir keine Sorgen«, sagte sie. »Es ist alles in deinem Unterbewußtsein. Du wirst dich übrigens beim Aufwachen nicht an deinen Besuch hier erinnern, jedenfalls eine Zeitlang nicht. Es wird dir vorkommen, als seist du eingeschlafen und hättest einen Traum gehabt, an den du dich nicht erinnern kannst.«
»Was meinst du damit, ich werde mich nicht erinnern? Wozu soll all dies denn gut sein, wenn ich mich nicht erinnern kann?« Er riß die Augen auf. »Ich muß gehen.« Er küßte sie schnell auf den Mund, wandte sich ab und rannte auf die Himmelsbar zu.
»Wo willst du denn hin?« fragte sie und hielt ihn zurück. Das 222pinkfarbene Licht an ihrer Brust schrumpfte auf die Größe eines Fußballs zusammen.
»Ich muß zu Ramda.«
»Warum?«
»Damit er mir hilft, all den Stoff zu behalten, den ich gelernt habe. Ich will sicher sein, daß ich alles verstanden habe, auch wenn's bloß in meinem Unterbewußtsein ist.«
»Langsam, meine Zwillingsflamme«, sagte sie, »und immer der Reihe nach.«
»Was meinst du damit? Eben hast du mir noch gesagt, ich hätte nur noch ein paar Minuten. Ich muß mich von Ahmay und den anderen verabschieden.«
»Immer mit der Ruhe, meine Zwillingsflamme«, sagte sie lächelnd. »Alles zu seiner Zeit.«
Er verdrehte die Augen.
»Schau, Jonathan, du wirst mich nicht verlassen, ehe wir dieses pinkfarbene Licht zur letzten Ruhe gebettet haben. Tritt zu mir und halte mit mir diesen Ball.«
Er gehorchte. Beide hielten sie das Licht, das jetzt gut einen Meter Durchmesser hatte.
»Ausgezeichnet«, sagte sie. »Jetzt leg eine Hand auf dein Herz und stelle dir einen geeigneten Ort auf Erden vor, an dem du gerne an mich, deine Zwillingsflamme, denken würdest.«
Jonathan fiel der Ort ein, an dem er am liebsten mitten in der Nacht allein war und die Sterne betrachtete: draußen, an der äußersten Spitze des Wellenbrechers am Rande der Mission Beach in San Diego. Dort fühlte er sich allen Mächten des Universums am nächsten. Als er sich diesen Ort vorstellte, entschwand der Energieball in ihre beiden Herzen und war nicht mehr zu sehen.
»So«, sagte sie seufzend. »Nun brauchst du nicht mehr zu Ramda zu gehen, um mit ihm zu repetieren. Das kannst du 223gleich an Ort und Stelle tun und dir eine Unmenge Zeit sparen.«
»Wie das?«
»Gebrauche einfach deine Intuition, Jonathan«, sagte sie. »Konzentriere dich nur auf den Lichtstrahl, dann kannst du das tun, was er in diesem Fall täte.«
»Was? Wovon redest du?«
»Du wirst doch selbst Lehrer. Du hast dieselben Fähigkeiten wie Ramda. Gebrauche sie einfach.«
»Ich habe das noch nie gemacht … Ich weiß nicht, wie ich es anfangen soll.«
Sie schloß die Augen, öffnete sie wieder und sagte: »Beim nächsten Ton sind es noch vier Minuten und dreißig Sekunden.«
»Schon gut, schon gut.«
Er bediente sich der Technik des »Hintersehens«, so, wie er es getan hatte, als er die Farben seiner Energieleitzentren betrachtet hatte. Langsam verschwammen die Bilder von der Peripherie seines Gesichtsfeldes zur Mitte hin. Dann konzentrierte er sich auf seine Atmung und stellte sich den Überleitungsraum vor. Allmählich erschien das Bild des Lichtstrahls.
»Willkommen«, erdröhnte Ramdas tiefe Stimme.
»Ausgezeichnete Arbeit, Junger Bär«, sagte Ahmay. »Du lernst vorzüglich. Wir sind alle ganz stolz. Hervorragende Arbeit, Paula.«
»Ich muß mir all unsere Lektionen noch einmal in Erinnerung rufen«, sagte Jonathan. »Ich habe nur noch ein paar Minuten.«
Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen, als auch schon ein riesiger Computerbildschirm sichtbar wurde. Am oberen Rand des Bildschirms standen die Worte:
224
Darunter der folgende Text:
Liebe ist das Wesen aller Energie:
Suche sie in allem, was du tust.
(Vibrationsfrequenzen)
Die Menschheit hat die Aufgabe, die ihren zu erhöhen.
Gebrauche sie mit Verstand.
– wie Wasser von den Bergen:
laß ihr freien Lauf.
Alles, was du zum Glück brauchst,
liegt unmittelbar vor dir.
Das Universum ist eine Ganzheit aus Energien,
die aufeinander einwirken,
aneinander teilhaben und Neues erschaffen.
Willst du die Welt ändern,
dann ändere dich selbst.
Sei dir über alles, was du denkst,
fühlst und tust im klaren -
es wird hundertfach auf dich zurückfallen.
225
Mach dich frei von allem Urteil und allen Erwartungen:
du bist in diesem Augenblick vollkommen.
Laß dich von dieser Bewegung mitreißen.
Wisse, daß dein spirituelles Sein sich im
Physischen, Emotionalen und Intellektuellen
(PEIS) widerspiegelt.
Deine Aufgabe ist es, ein Gleichgewicht in dir
selbst, zwischen dir und den anderen, dir und deinem
Planeten, dir und der Einheit zu schaffen.
Unter den Kreisen stand folgender Text:
Vertraue
Meditiere
Geh ins Innere
Gebrauche deine Intuition
Suche in allem die LIEBE.
Bedenke: Du kennst bereits die
Universalprinzipien und das Wie.
Menschen und Ereignisse werden die Erinnerung wecken.
Sei zuerst dein eigener Lehrmeister, dann erst der
anderer – durch dein Beispiel und dann durch das Wort.
226
»Was ist los, Junger Bär?« fragte Ahmay. »Glaubst du, du wärest der Aufgabe nicht gewachsen?«
»Ich wollte bloß nichts vergessen«, platzte Jonathan heraus.
»Das kannst du gar nicht«, warf Ramda ein. »Aber ich verstehe deine Bedenken.«
»Vielen Dank für all eure Hilfe«, sagte Jonathan. »Tut mir leid, daß ich so in Eile bin. Ich hoffe, daß ich euch beide recht bald wiedersehe.«
»Gern geschehen«, riefen Ramda und Ahmay im Chor.
»Vergiß nicht: Dieser Computer ist immer für dich da«, fügte Ramda hinzu. »Hüte dich vor diesen billigen irdischen Imitationen!«
Ein Kreis umschloß jedes der vier Universalprinzipien. Jonathan konnte sie lachen hören, als die Kreise zu Ellipsen wurden und sich dann miteinander verbanden:

»Achte immer auf dieses Zeichen«, sagte Ahmay. »Dann weißt du, wann wir in deiner Nähe sind.«
Der Lichtstrahl verschwand aus Jonathans Bewußtsein. Blinzelnd schlug er beide Augen auf.
Paula stand noch immer neben ihm. »Beim nächsten Ton sind es noch vier Minuten und zwei Sekunden«, deklamierte sie monoton und öffnete die Augen.
»Mann, das ging aber schnell«, sagte er. »Dann habe ich ja noch Zeit, dir ein Stückchen von meinem Konzert vorzuspielen. Willst du's hören?«
227
Sie rannte auf die Bar zu. »Ich dachte schon, du würdest mich überhaupt nicht mehr fragen«, schrie sie ihm über die Schulter zu. »Den letzten beißen die Hunde!«
Die beiden starteten wie zwei Supersprinter. An der Eingangstür hatte sie ihn fast eingeholt, dann fegten sie in die Bar und trabten den Gang hinunter, zwischen den Tischen hindurch, auf den Flügel zu. Als sie bemerkte, daß er außer Atem war, hänselte sie ihn: »Was ist los, Taylor? Wirst langsam alt, was?«
Er lächelte und ging weiter. Am Flügel angekommen, setzte er sich auf den Hocker und wischte sich mit dem Ärmel seines T-Shirts die schweißnasse Stirn. Dann saß er sekundenlang reglos da, um sich zu sammeln.
Paula schob sich neben ihn auf den Hocker und küßte ihn sanft auf die Wange. »Ich liebe dich, meine Zwillingsflamme«, flüsterte sie. »Vergiß nie, daß du geliebt wirst.«
Er schaute sie an und erwiderte ihren Kuß auf die Wange. »Ich dich auch«, sagte er und sah ihr tief in die Augen. »Dies widme ich dir, mit all meiner Liebe.«
Er begann, die Überleitung vom ersten zum zweiten Satz zu spielen. Er fühlte seine Seele emporsteigen, genau wie auf dem Adlerflug, zu dem ihn Ahmay mitgenommen hatte, als sie beide am Tisch in der Bar saßen. Er schloß die Augen und fühlte sich wie ein Adler. Wieder sah er sich hoch in die Lüfte erheben. Es war noch jemand bei ihm. Er schaute hinüber. Es war Paula. Ihre Schwingen berührten einander beinahe. Tränen stiegen ihm in die Augen, doch das kümmerte ihn nicht. Hier gehörten sie hin – emporgetragen, im Gleitflug auf allen vier Winden.
Jonathan fühlte, wie die Musik seiner Seele entströmte. Diesmal klang sie ganz anders. So hatte er noch nie gespielt. Genauso mußte es klingen. Aber er war noch nicht am entscheidenden Punkt angelangt. Macht nichts, sagte er sich. 228Laß dich einfach tragen. Laß die Winde wehen. Gleite dahin und laß die Energie fließen. Die Stelle, an der sich sein Finger immer verkrampfte, kam immer näher. Mach einfach weiter, Taylor. Laß alle Energie ohne jede Blockade durch dich hindurchfließen. Du bist schon fast da – nur noch ein paar Takte.
Er fühlte, wie seine rechte Hand und vor allem sein kleiner Finger sich erwärmten, und er öffnete die Augen. Paula streckte ihre Hand aus und senkte sie dicht über die seine. Er schloß wieder die Augen. Seine Hand fühlte sich angenehm an. Er würde es tun. Er würde dahingleiten und das ganze Stück spielen, wie er noch nie in seinem Leben gespielt hatte. Noch ein Takt …
Ein lautes Klopfen explodierte in Diggers Kopf. Noch einmal. »Mr. Taylor«, sagte laut eine barsche Stimme. »Mr. Taylor, wenn Sie mich hören, sagen Sie einfach irgendwas.«
Digger schüttelte den Kopf und blinzelte. »Okay, okay«, murmelte er wie betäubt. »Ich höre Sie.«
»Noch fünfzehn Minuten bis zu Ihrem Vorspiel, Sir«, sagte eine von fern vertraute Stimme. »Geht es Ihnen gut?«
Digger spürte eine eigenartige Wärme in seiner rechten Hand. Er ließ die Finger spielen und versuchte unablässig, die Spinnweben von seiner Erinnerung zu reißen. »Ja, es geht mir gut«, krächzte er. »Ich muß fest eingeschlafen sein. Bin gleich wieder auf dem Damm. Danke fürs Wecken.«
»Ich komme in zehn Minuten wieder und schau nach, ob Sie in Ordnung sind«, sagte dieselbe Stimme. Sie klang wie die des Wachmanns, der ihn hereingeleitet hatte.
Digger fühlte sich seltsam müde, so als stünde er unter Drogen. Eine solche Meditation hatte er noch nie erlebt. Er rieb sich die Augen. Sie fühlten sich an, als habe er geweint. Komisch. Ich kann mich an keinen Traum erinnern. Warum 229sollte ich beim Meditieren weinen? Ich fühle mich ausgesprochen gut. Warum sollte ich weinen?
Du solltest dich lieber mal am Riemen reißen, Taylor. Du hast fast keine Zeit mehr. Gleich ist sie da, deine große Chance.
Was wohl mit meiner Hand passiert ist? Vielleicht hab ich drauf geschlafen oder so was. Vielleicht ist mein Finger im Schlaf geheilt.
Das ist mal wieder typisch – immer wünschst du dir das Unmögliche.
Er erhob sich von der Couch und ging zum Übungsflügel hinüber. Er holte tief Atem und setzte sich.
230
»… die Wahrheit fühlen.«
Digger saß auf dem Hocker vor dem blitzenden Miniaturflügel und sah sich in der Garderobe um. Nichts schien sich verändert zu haben, seit er geschlafen hatte. Es war die größte und eleganteste Garderobe, die Digger je gesehen hatte. Noch immer staunte er über die Eschenholztäfelung, die teuren Möbel, die Blumen und vor allem über die wohlgefüllte Bar.
Er schaute auf seine Uhr. Neunzehn Minuten nach sieben. Alles lief genau nach Plan. Er würde sich noch ein paar Minuten einspielen, ehe er den Smoking anlegte. Sean Greens letzte Worte fielen ihm ein: »Im Sonntagsstaat«. Ob er wohl auch da draußen ist? Wäre schon merkwürdig, wenn er mich mit dem Wagen abholen ließe und mir dann nicht mal 'n Briefchen oder ein ›Hallo, wie geht's‹ schicken würde. Na, ein seltsamer Typ ist er ja.
Diggers Miene verfinsterte sich. Aus dem Nichts überkam ihn dieselbe böse Vorahnung, die ihn schon den ganzen Tag lang immer wieder überfallen hatte. Du mußt mit diesen negativen Gedanken Schluß machen, sagte er sich. Es spielt keine Rolle, wo diese blöden negativen Schwingungen herkommen. Du mußt sie dir aus dem Kopf schlagen. Du kannst absolut nichts damit anfangen, also konzentriere dich einfach 231auf die Aufgabe, die dir bevorsteht. In ein paar Minuten mußt du ein Konzert vorspielen.
Er betrachtete noch einmal seine rechte Hand. Die Wärme war nicht mehr zu spüren, nur ein angenehmes Gefühl war noch da. Er schüttelte die Hände aus, um sie zu lockern. Dann begann er zu spielen. Da seine Zeit knapp war, hielt er es für das Beste, kurz vor der Überleitung vom ersten zum zweiten Satz mit dem Spielen zu beginnen.
Während er spielte, versuchte er, sich ein wenig aufzuheitern, indem er über die glücklicheren Momente in seinem Leben nachdachte. Das erste, was ihm in den Sinn kam, war ein Angelausflug mit seinem Dad. Er war damals zehn Jahre alt, und sie beide waren allein unterwegs. Keine Mutter, die Streit hätte beginnen, kein Telefon, das Papa zur Arbeit hätte rufen können. Keine Liste der Pflichten, die erfüllt werden mußten, weil sie ›ja doch einmal getan werden mußten‹, wie er Digger immer sagte. Nur sie beide, ganz allein an einem einsamen See beim Forellenangeln.
Es war mitten im Sommer, doch seltsamerweise war es ein grauer, kühler Tag. Eigentlich war es genau so ein Tag, wie Digger ihn mochte. Er haßte die schwülen, drückenden Sommer in Chicago. Sie gaben ihm das Gefühl, in der Hölle zu sein, ohne vorher all den Spaß gehabt zu haben, der einen dort hinbrachte. Der Lake Shawano lag drei Autostunden vom Heim der Taylors entfernt, doch man hätte sich auf einem anderen Planeten glauben können: Ohne Verkehr, ohne die am Himmel dröhnenden Flugzeuge und ohne die brutalen oder hysterischen Ausbrüche der Erwachsenen, die zu Diggers Alltag in der Stadt gehörten.
Papa hatte für jeden von ihnen ein doppeltes Lunchpaket und einen kleinen Imbiß eingepackt, und da saßen sie Stunde um Stunde im Boot, sagten kein Wort, warfen die Angeln aus, holten sie ruckartig, immer nur stückchenweise, wieder 232ein und aßen, soviel sie eben wollten, wann immer sie Lust hatten. Es war, als wäre man aus dem Gefängnis entlassen, und er war bei seinem Dad, behütet und in Sicherheit. Nichts konnte schiefgehen. Es war einer der schönsten Tage seines Lebens.
Digger näherte sich der heiklen Stelle seiner Komposition. Sein Finger fühlte sich gut an; nicht irgendwie besonders. Bestimmt hatte er lange geschlafen. Was es wohl mit den vielen Tränen auf sich hatte? Sieht dir überhaupt nicht ähnlich, zu weinen, schon gar nicht im Schlaf. Möchte bloß wissen, warum ich mich nicht erinnern kann, wo ich beim Meditieren war? Scheint, als wär ich in einem Traum gewesen. Träume sind schon was Merkwürdiges – mal kann man sich an sie erinnern, mal wieder nicht. Ich hatte das Gefühl, als wär was Wichtiges geschehen, aber was war das nur?
Fast war musikalisch der Augenblick der Wahrheit gekommen. Er fühlte sich an die Übertragung des olympischen Eiskunstlaufens erinnert: Würde sie den dreifachen Lutz springen oder nicht? Würde er über den Moment des Zauderns hinwegspielen können? Würde sein Finger mitspielen? Würde er imstande sein, die musikalische Freiheit zu erlangen und sich zu neuen Höhen aufzuschwingen? Im nächsten Augenblick würde er es wissen.
Ein lautes Klopfen an der Tür unterbrach ihn. »Mr. Taylor? Mr. Taylor, können Sie mich hören?« Digger hörte auf zu spielen.
»Ja«, sagte er. Langsam stand er auf, ging zur Tür und öffnete.
Noch immer in der grauen Uniform mit den Goldtressen, stand der Sicherheitsbeamte draußen vor der Tür und schaute auf seine Uhr. »Sie haben noch ungefähr fünf Minuten, Sir.«
»Danke«, sagte Digger und wollte die Tür schließen.
233
Der Wachmann sah, daß Digger nur mit Shorts und Polohemd bekleidet war. »Entschuldigen Sie, Sir«, sagte er. »Sie wollen doch nicht so rausgehen, oder?«
»Ich muß mich noch umziehen.«
»Oh«, sagte der Wachmann. »Na dann … Hals- und Beinbruch und so.«
Erneut wollte Digger die Tür wieder schließen.
»Ich habe Sie spielen hören«, sagte der Wächter. »Ich finde, das hört sich richtig gut an. Gar nicht mal so übel für'n Musiker, der noch nie 'ne eigene Garderobe gehabt hat.«
Digger mußte lachen und sagte grinsend: »Danke. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Ich muß jetzt gehen, okay?«
»Richtig, bis später.«
Digger schloß die Tür und schaute wieder nach der Uhr: neunzehn Uhr sechsundzwanzig. Vier Minuten, um den Smoking anzuziehen und dich zusammenzureißen. Mein lieber Himmel – und du hast deinem Stück noch nicht mal einen Namen gegeben! Los Taylor, jetzt bist du am Ball.
Um Punkt neunzehn Uhr dreißig verließ Jonathan Taylor – von seinen Freunden und Bekannten Digger genannt – in einem tadellos sitzenden, geliehenen Smoking seine Garderobe. Mit schnellen Schritten ging er den Gang hinunter auf die ihm von Mr. White gewiesene Eingangstür zu. Er holte tief Luft und öffnete die Bühnentür. Gehen wir's an, sagte er sich selbst, Mutter soll stolz sein. Einen Augenblick hielt er inne und schaltete in seinem Kopf einen neuen Gang ein. Ich will stolz auf mich sein.
Als er die Tür öffnete, erblickte er auf der Bühne und unmittelbar davor zahlreiche Kameraleute und überall installierte Mikrofone. Die Bühnenscheinwerfer strahlten den roten Vorhang und die beiden schwarzen Tasteninstrumente an, die auf ihn warteten. Er überquerte die Bühne, stellte sich 234neben den Steinway und verbeugte sich vor dem Publikum. Wer da draußen saß, war wegen des Gegenlichts nicht zu erkennen.
»Guten Abend, meine Damen und Herren«, sagte er mit frischer, klarer Stimme. »Mein Name ist Jonathan Taylor. Ich möchte Ihnen heute abend ein besonderes Stück vorspielen. Es ist ein Klavierkonzert in zwei Sätzen mit dem Titel« – er zögerte – »Klavierkonzert in D-Dur.«
Freundlicher Applaus begrüßte seine Ankündigung, während er auf den Klavierhocker glitt und sich bequem zurechtsetzte. Offenbar waren dort draußen mehr Zuhörer, als er erwartet hatte – der Beifall klang nach ungefähr fünfzig Leuten.
Jetzt ist es soweit, Taylor. Darauf hast du seit wer weiß wie lange Zeit gehofft. Seit Urzeiten, so kommt es mir vor. Drei Jahren können einem zu gleicher Zeit wie ein Augenblick und wie eine Ewigkeit erscheinen.
Digger rieb die Hände aneinander.
Dies war der magische Moment. Doch er kämpfte gegen seine Angst an – Angst vor den kritischen Stellen seiner Überleitung und Angst vor seinem Finger. In der Hoffnung, ihn ablenken zu können, lauerte seine Furcht in den finsteren Winkeln seines Bewußtseins. Zudem wehrte er sich gegen die natürliche Angst vor dem Versagen, davor, die Sache in den Sand zu setzen und sich jede Chance auf eine neue Karriere zu verbauen. Und dann war da noch dieses Gefühl drohenden Unheils. Er mußte sich davon freimachen. Später, nach dem Vorspiel, würde er sich damit befassen. Jetzt konnte er ja doch nichts damit anfangen.
All dies schoß ihm innerhalb des Bruchteils einer Sekunde durch den Sinn.
Taylor, diese ganze negative Zeug hilft dir jetzt überhaupt nicht weiter, sagte er sich. Du mußt es mit was anderem versuchen. 235Die große Frage ist nur, womit? Was kannst du in diesem Augenblick versuchen, das anders ist und dir doch die Chance gibt, besser zu sein denn je? Es wird dir schon einfallen. Fang einfach an zu spielen, mit Gefühl.
Digger begann zu spielen.
Immer leicht bleiben, Junge. Schön leicht und ruhig. Traurig, aber ruhig, nicht sentimental.
Seine Gedanken kehrten zu seinem Vater zurück.
Da lagst du nun, Papa, in der Friedhofskapelle, und warst ganz richtig tot. Ganz bleich und still, wie ein Bild an der Wand. Ich konnte es unmöglich glauben, daß du nie mehr für mich da sein würdest, mich, deinen Sohn mit Collegeabschluß. Wir hätten so gute Freunde werden können, du und ich. Wenn du mich nur reingelassen hättest. Du wärst mich nach meiner Heirat besuchen gekommen. Später, wenn ich ein bißchen älter gewesen wäre, hätte ich dich zum Großvater gemacht. Du hättest einen tollen Großvater abgegeben. Aber dazu sollte es nun nicht mehr kommen. Du warst tot. Wirklich tot.
Digger berührte die Tasten nur ganz leicht. Anmutig und stark wie die Beine eines Ballettänzers sprangen seine Finger von Taste zu Taste.
Seine Gedanken wanderten zurück zu ihren gemeinsamen Ferien in Key West. Als Digger seinen Vater gewarnt hatte, er werde sich zu Tode trinken, und sein Vater geantwortet hatte: »Ich weiß genau, was ich tue.«
Er fühlte, wie er den widerstreitenden Gefühlen nachgab, die der Tod seines Vaters heraufbeschwor – Gefühlen, die er nur selten zuließ. Er fühlte sich schuldig am Tod seines Vaters. An jenem Tag in Key West hatte er ihm sagen wollen, daß er ihn liebe, daß er ihn schrecklich vermissen würde, wenn er nicht mehr da wäre. Er hatte es nicht gesagt. Nichts hatte er getan oder gesagt. Er hatte nur dagestanden – und 236seine Gedanken und Gefühle zurückgehalten. Hätte er nur gesprochen, vielleicht hätte sein Vater dann aufgehört zu trinken.
An jenem Tag hatte Digger tatsächlich begonnen, neue Mauern um sein Herz zu errichten – Mauern, welche die Musik schon einmal eingerissen hatte. Er baute sie noch fester und noch höher, damit diesmal nicht ein Tröpfchen Musik hindurchsickern konnte. Am meisten Angst hatte er davor, zu ertrinken; zu ertrinken in einer Flutwelle von Gefühlen, wenn der Damm je brechen sollte. Digger fürchtete sich vor seinem Zorn; dem nie eingestandenen Zorn auf seinen Vater und die Rücksichtslosigkeit, mit der er beschlossen hatte, zu sterben.
Du bist einfach abgehauen und hast mich mit Mama alleingelassen, dachte Digger jetzt, während seine Finger über die Tasten flogen. Das war nicht fair. Und sie war auch böse auf dich und hat das an mir ausgelassen. Warum mußtest du das tun? Warum mußtest du mich mit ihr und ihrer Wut alleinlassen? Ich wußte doch nicht zwischen Wut und Eltern und Sterben zu unterscheiden. Ich wußte überhaupt nichts. Ich wußte nur, daß sie die meiste Zeit damit verbrachte, mich grundlos anzuschreien, und daß ich nichts dagegen machen konnte. Meine Eltern, das war nur sie. Ich konnte sie nicht rausschmeißen. Ich mußte den Mund halten, aber das paßte mir nicht, kein bißchen. Aber warum lege ich all das dir zur Last, Papa? Du warst doch tot.
Du meine Güte, Taylor. Warum haust du auf deinen toten Vater ein? Wahrscheinlich die Nerven. All diese Kindheitsempfindungen noch einmal zu durchleben, die du immer so ängstlich unter Verschluß gehalten hast. Aber warum gerade jetzt? Du hattest zwanzig Jahre Zeit dazu. Warum mußt du gerade jetzt, mitten in diesem entscheidenden Augenblick, alte Wunden wieder aufreißen? Naja, einen Erfolg kannst du 237immerhin verbuchen: Das ist auf alle Fälle eine ganz neue Art, ein Vorspielen anzugehen. Allerdings nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte.
Digger kam eben zum Ende des ersten Satzes. Noch immer waren seine Finger voller Zuversicht und Energie. Er fühlte sich so gut wie seit Jahren nicht, jetzt, wo er all jene Gefühle zuließ, vor denen er sich so sehr gefürchtet hatte. Er war deswegen noch kein schlechter Mensch; das erkannte er jetzt. Er war nur endlich aufrichtig gegen sich selbst.
Das eigentliche Problem war nicht sein Dad, sondern er selber: sein Unvermögen, diese Gefühle mitzuteilen, ganz gleich ob es sich dabei um Wut oder Glück, Trauer oder Erregung, Liebe oder Haß handelte; sein Unvermögen, sich mit der Passivität seines Vaters und der Aggressivität seiner Mutter auseinanderzusetzen; seine Furcht, Marys Liebe in sein Leben einzulassen, weil sich dadurch das Reservoir an Gefühlen hätte öffnen können, das in seinem Innern angestaut war.
Das war der Schlüssel. Darum fühlte er sich so viel besser. Es war die Freiheit, die Wahrheit sagen zu können. Die Freiheit, die Wahrheit fühlen zu können. Das war es: die Wahrheit fühlen.
Für den Bruchteil einer Sekunde öffnete Digger die Augen, um sich zu überzeugen, daß er nicht träume. Er sah den roten Vorhang und die blendenden Scheinwerfer. In einer Ecke der Bühne streifte sein Blick flüchtig die amerikanische und die kalifornische Flagge, Seite an Seite hängend. Oben auf den hölzernen Fahnenstangen war ein Adler zu sehen. Er schloß die Augen wieder. Das war es: Wie ein Adler würde er durch die Lüfte segeln – so, wie er es manchmal in seinen Träumen tat.
Sein Herz sprang vor Freude. Das war es. Genau das würde er tun. Sein Konzert würde fliegen. Er würde sich einfach 238gehenlassen, würde die Wahrheit fühlen, die Wahrheit über seinen Vater und seine Mutter und sich selbst und sein Leben und über alles andere. Er mußte nicht mehr lügen oder sich verstellen. Es war alles drin, in seinem Innern. Er konnte fliegen und dahinsegeln wie ein Adler.
Er kam jetzt an die Stelle, die er immer verpfuscht hatte. Es war ihm gleich; es war nicht wichtig; es war kein Problem. Er würde hindurchsegeln wie ein Adler durch einen Abwind.
Plötzlich begann seine rechte Hand wieder warm zu werden; und er spürte in seinem Innern Kräfte erwachen, von denen er nie zu träumen gewagt hatte. Während des Spiels schrieb er sein Konzert von Grund auf neu. Die Musik, die er spielte, war besser als alles, was er je komponiert hatte. Er hatte zur Leidenschaftlichkeit gefunden. Es war die Wahrheit – die Wahrheit über seine wirklichen Gefühle. Er war frei!
Seine Finger rasten über die Tasten, erfanden neue Themen, fanden zu neuen Harmonien und neuer Kontrapunktik, führten ganz neue Tonfolgen ein. Wer war dieser Bursche, der da Klavier spielte? War er das wirklich? Diese Musik war jahrelang in ihm gewesen und hatte herausgewollt. All die Monate und Jahre über hatte er dieses Konzert in seinem Kopf gehört und es nicht herauslassen können. Nun, da es im Fluß war, wollte er es nicht aufhalten.
Über die Stelle in seiner Überleitung, die ihn seit Monaten, seit seinem Sturz beim Softball, gequält hatte, flog er einfach hinweg. Es war, als hätte es nie ein Problem damit gegeben. Seine Hand war noch immer warm und fühlte sich kräftig an.
Was du auch tust, Taylor, denk nicht darüber nach. Laß Musik und Leidenschaft einfach fließen. Liebende Gedanken sollst du zulassen; keine negativen Gedanken mehr. Nicht mehr das Spielchen mit der Schuld. Papa hat dir nichts getan. Du selbst hast dir das angetan, und Mama war nicht 239mit Absicht böse zu dir. Es ist einfach passiert. Sie beide haben dich geliebt, so gut sie eben konnten. Sie waren einfach Menschen, die aus ihren Lebenserfahrungen gelernt haben. Genauso wie du aus ihnen gelernt hast. Sie haben Fehler gemacht, genauso wie du Fehler gemacht hast. Niemand war schuld an dem, was in Florida geschehen ist – es ist einfach passiert. Das da drüben waren Lektionen, aus denen du lernen solltest, ein besserer Mensch zu sein, Taylor. Ach, laß es fließen, Jonathan Patrick Taylor. Vorwärts, flieg wie ein Adler! Sieh dich hoch über der Erde. Schau nach unten. Die Probleme dieser Welt sind so klein und unbedeutend, wenn du hier oben bist und auf dem Wind dahinsegelst. Was wirklich zählt, ist die Liebe, die du gibst.
Gern hätte er zur Seite geschaut, um zu sehen, ob er allein war. Er hatte das seltsame Gefühl, daß noch andere hier oben bei ihm waren, doch dann fürchtete er, er würde dann vergessen, wie man fliegt, und abstürzen. Den zweiten Satz hatte er beinahe zu Ende gespielt. Er hatte ihn so gut gespielt wie nie zuvor, das wußte er. Doch er wollte darüber nicht nachdenken. Statt dessen genoß er noch immer die Befreiung seiner Gefühle, die wie durch Zauberei ihren Weg über seine Finger in die Saiten des Instrumentes fanden. Und zum Dank dafür kehrten die Noten nicht nur in Form des Klanges an sein Ohr zurück, sondern waren als ein Widerhall in jeder Zelle seines Körpers spürbar. Es war die freudige Vereinigung der Musik, die er schon immer in seinem Kopfe gehört hatte, mit dem hörbaren Ausdruck dieser Erinnerung.
Es war eine Komposition von vollkommener Balance. Digger hatte das Gefühl, sich einem Zustand äußerster Glückseligkeit anzunähern, bei dem sein Körper als Mittler zwischen Geist und Körper diente. Tief in seinem Innern begann sich etwas zu regen. Etwas, das die tiefen Meeresströme endlich freigelegt hatte und das nun langsam an die 240Oberfläche strebte. Noch war es zu tief, um erkannt zu werden – doch es kam herauf.
Und plötzlich war er fertig. Er schlug den letzten Akkord an, ließ der Wirkung wegen eine kurze Zeit verstreichen und stand dann auf, um den, wie er glaubte, bescheidenen oder höchstens höflichen Beifall von denen entgegenzunehmen, die es geschafft hatten, während des ganzen Konzertes über wach zu bleiben.
Du hättest nicht herkommen sollen, dachte er. Du bist kein Filmkomponist. Naja, die Sache hat auch ihr Gutes. Wenigstens weißt du jetzt, was du tun mußt, um das Beste aus dem bißchen Talent zu machen, das Gott dir mitgegeben hat.
Als er sich vor dem Publikum verbeugte, ließ ein donnernder Applaus das Theater erzittern. Ihm war, als würde er von einer Flutwelle aus »Bravo«- und »Zugabe«-Rufen überrannt.
Eine laute Männerstimme war besonders deutlich zu hören. »Los, Taylor«, brüllte sie in sarkastischem Ton, »spiel uns noch was vor. Spiel uns noch ein Klavierkonzert, bloß einen Satz noch – mehr verlangen wir gar nicht.«
Ein Angstschauer durchfuhr Digger. Was, wenn sie immer weiterklatschten und ihm zujubelten? Er war nicht darauf vorbereitet, etwas anderes zu spielen. Er hätte sich darauf einstellen können, doch der Gedanke war ihm nie in den Sinn gekommen. Sean Green hatte nichts von einem zweiten Stück gesagt.
Plötzlich stand Mr. White neben ihm. »Los, schnell raus hier.«
Sie gingen durch die Bühnentür hinaus, die Treppe hinunter, in Diggers Garderobe.
»Gut gemacht«, meinte der Wachmann begeistert, schlug die Tür zu und schloß ab.
241
»Danke«, sagte Digger atemlos und mit finsterer Miene. »Warum haben Sie die Tür abgeschlossen? Ich will, daß die Leute zu mir kommen können, wenn sie wollen. Ich erwarte einen Besucher.«
Der Wachmann lächelte und nahm seine Mütze ab. »Zuerst möchte ich mich einmal vorstellen. Mein wirklicher Name ist Philip Michaelson.« Er streckte Digger seine Hand entgegen.
Digger starrte die Hand des Mannes an, schließlich nahm er sie und sagte mit einem Lächeln über seine eigene Naivität: »Ich bin glücklich, Ihre Hand schütteln zu dürfen, aber Sie werden eine gewaltig ausführliche und eine gewaltig stichhaltige Erklärung abgeben müssen, um mich davon zu überzeugen, daß Sie wirklich Mr. Michaelson, der Filmregisseur, sind.«
Wieder mußte der Mann lächeln. »Das gefällt mir. Sie haben sich gut geschlagen.« Er griff in seine Hosentasche und förderte seine Brieftasche und seine Kreditkarten zutage. Dann überreichte er sie Digger. »Schauen Sie sich ganz ungeniert an, was Sie mögen«, sagte er und warf einen prüfenden Blick auf sein Ebenbild im Spiegel über dem Garderobentisch. »Wenn Sie noch immer im Zweifel sind, wer ich bin, können wir ein paar Telefonate führen. Dann glauben Sie mir, ich bin wirklich der, der ich zu sein behaupte.«
Digger untersuchte die Brieftasche und deren Inhalt. Er fand einen Führerschein auf den Namen Philip Michaelson mit einem Photo darauf. Alles paßte zum Äußeren dieses Mannes. »Es sieht so aus, als wären Sie wirklich Philip Michaelson«, murmelte er schließlich und schüttelte den Kopf. »Warum haben Sie sich für jemand anderen ausgegeben?«
Als er Michaelson die Brieftasche zurückgab, schoß ein vom Theater ausgehendes Gefühl drohender Gefahr durch Diggers Bewußtsein.
242
»Ich lerne die Leute gern kennen, ohne daß sie selbst wissen, wer ich bin«, sagte Michaelson und machte es sich auf einer Couch bequem. »Meist werden die Leute nervös und aufgeregt, wenn sie wissen, wer ich bin.«
Er bat Digger, sich zu setzen. Der Regisseur strich sich mit der Hand durch das Silberhaar und musterte seinen Besucher. »Das war ein anregendes Stück Musik, das Sie sich da draußen für uns ausgedacht haben, Mr. Taylor. Wie Sie sich selbst überzeugen konnten, hat es auch meinem Stab und der Crew ganz gut gefallen.« Er zögerte und rieb sich das Kinn. »Ich habe mir übrigens sagen lassen, daß Sie es lieber haben, wenn man Sie Digger nennt. Stimmt's?«
Der Jüngere nickte. »Das stammt noch aus meiner Baseballzeit.«
»Nun also, Digger«, sagte er lächelnd, wobei der den Spitznamen mit einer freundschaftlichen Betonung versah, »was meinen Sie? Wollen Sie mit diesem närrischen, schrulligen alten Brummbär einen Film machen?«
In Diggers Kopf herrschte Verwirrung. Bot ihm Philip Michaelson tatsächlich einen Job an? Während Michaelson schon dabei war, ihm den Film zu beschreiben, überlegte Digger, ob er seinen Job wohl wieder verlieren würde, wenn er darum bäte, die Unterhaltung auf morgen zu verschieben. Im Augenblick schien sein Hirn nur aus amorphem Gewebe zu bestehen. Er brauchte dringend Schlaf.
Als hätte er Diggers Gedanken gehört, erhob sich Michaelson von der Couch. »Ich sehe, ich habe Ihnen schon genug Stoff zum Nachdenken gegeben. Bitte verzeihen Sie einem leidenschaftlichen alten Mann, Digger. Ich habe Ihnen nicht einmal Gelegenheit gegeben, Ihren Smoking auszuziehen. Das muß ja alles ein bißchen viel für Sie sein.«
Digger erhob sich ebenfalls. »So ist es, Mr. Michaelson. Ich möchte gerne mehr hören. Aber ich brauche ein wenig 243frische Luft und einen gesunden Nachtschlaf. Können wir morgen weiterreden?«
»Da machen Sie sich nur keine Sorgen«, sagte Michaelson, schon auf dem Weg zur Tür. »Ich weiß, daß Sie Ihr Leben ein wenig umorganisieren müssen, ehe ich erwarten kann, Sie jeden Tag bei mir zu sehen. Doch Sie standen schon in dem Augenblick auf der Gehaltsliste, als Sie heut abend auf die Bühne kamen. Ich bin froh, daß wir Ihren Vortrag auf Band haben. Sie waren brillant. Verstehe gar nicht, wie Sie sich da unten in San Diego verkriechen konnten.« Er zögerte. »Auf alle Fälle reden wir morgen weiter.«
Digger strahlte. »Danke, Mr. Michaelson. Ich … ich weiß nicht, was ich noch sagen soll.«
»Wenn man nicht weiß, was man sagen soll«, grinste der Regisseur, »dann ist es im allgemeinen das Beste, man tut das, was meine Mutter meiner Schwester vor ihrem ersten Ball geraten hat: ›Mach alles dicht, nur Augen und Ohren nicht‹«. Er lachte schallend über seinen eigenen Witz und öffnete die Tür. »Wenn Sie gehen möchten, wartet unten ein Fahrer auf Sie. Er wird Sie zum Beverly Hilton bringen, wo Sie mein Gast sind. Bei Spago feiern wir eine Überraschungsparty für einen Produzenten des Films. Wenn Sie kommen möchten, sagen Sie dem Fahrer, er soll Sie später abholen. Ich werde auf der Party sein und Sie allen vorstellen. Und wie ist es mit dem Frühstück? Ich schicke Ihnen meinen Fahrer, sagen wir um sechs. Ist das zu früh?«
Digger lächelte. »Was ist, wenn ich ja sage?«
Michaelson zuckte die Achseln. »Nichts. Dann schicke ich ihn einfach später. Bestimmen Sie eine Zeit.«
»Sechs ist prima.« Digger errötete. Er hatte Michaelson auf die Probe stellen wollen – zu Unrecht, wie er erkannte. »Ich stehe gerne früh auf, vor allem, wenn's ums Komponieren geht und ich dafür bezahlt werde.«
244
»Gut.« Michaelson reichte ihm die Hand, die Digger ergriff. »Dann ist alles geklärt. Gute Nacht und willkommen an Bord! Wir werden einen großartigen Film zusammen machen. Sie werden sehen.« Und er verschwand im Flur.
Digger kehrte in die Garderobe zurück, ließ aber die Tür einen Spaltbreit offen. »Ja!« rieff er in lautem Flüsterton und boxte in die Luft. »Ja, ja!« Wieder und wieder boxte er in die Luft. »Gütiger Gott«, murmelte er. »Ist das zu fassen?« Er ließ sich auf die Couch fallen, legte sich auf den Rücken und strampelte mit den Beinen. »Gestern noch Kellner, morgen Filmkomponist! Ist das zu fassen, Taylor?« Er wollte die Neuigkeit mit jemandem teilen, sie irgend jemandem erzählen – aber wem? Seiner Mutter? Mary?
Mit einem Mal spürte er die Wirkungen des anstrengenden Tages. So viele Aufregungen in den letzten sechsunddreißig Stunden und dabei fast kein Schlaf. Er stieß einen langen Seufzer aus und schloß die Augen.
Ein kalter Schauer durchlief ihn. Noch einmal. Den ganzen Raum nahm es ein – das Gefühl, daß irgend etwas Entsetzliches geschehen würde. Und es war stärker denn je.
Was geschieht mit dir, Taylor? Geht es dir schon wieder verloren? Sieht fast so aus, als wärst du fest entschlossen, deine eigene Lust am Leben zu zerstören. Jetzt hast du den Ball eben erst aus dem Spiel geschlagen, und schon fängst du wieder an mit dieser Leier von Hoffnungslosigkeit und Verhängnis.
Es klopfte an der Tür.
»Wer ist da?« rief Digger.
»Patrick, mein Junge«, antwortete eine vertraute Stimme, »du wirst doch 'n bißchen Zeit für'n alten Freund haben, was?«
Das »Entsetzliche« wurde immer greifbarer. Furcht schlug ihre Klauen in Diggers Magen. Warum? Er erwog, Green 245fortzuschicken, doch das war verrückt. Wie konnte er Green fortschicken? Er war doch derjenige, der all dies erst ermöglicht hatte.
Green rauschte mit einem engelhaften Lächeln herein, als sei er der Herr im Hause. Seine Kleidung war tadellos. Nicht ein Haar lag in Unordnung. Er mochte etwa fünfundvierzig sein, sah gut aus und hatte einen ausgesprochen energischen Gesichtsausdruck. »Sieh einer an«, sagte er und machte einen schnellen Rundgang durch den Raum. Dann streckte er Digger die Hand hin. »Wurde auch Zeit, daß du mal unter deinen Klippen in San Diego rausgekrochen kamst, was? Freu mich, dich zu sehen, Bursche.«
Digger nahm Greens Hand, und seine Furcht wurde größer. Irgend etwas stimmte hier ganz und gar nicht. Er mußte hier raus, und das schnell.
»Freue mich, Sie zu sehen, Mr. Green.« Schieb alles Geschäftliche lieber auf morgen, Taylor. Mit diesem Burschen ist irgendwas faul. »Aber ich bin in Eile und muß mich noch umziehen. Ich werde erwartet.«
»Na klar doch, Junge.« Green steuerte auf die Bar los. »Du machst 'n bißchen zu und ziehst dich um; ich besorg uns 'n Drink, damit wir anstoßen können. Du weißt, daß du sie heut abend alle in die Tasche gesteckt hast, oder?«
»Für mich keinen Drink, danke«, sagte Digger. »Das würde mich auf der Stelle umhauen.«
Wie konnte er diesen Mann abwimmeln, ohne unhöflich zu werden? Ich muß diese albernen Klamotten loswerden und dann nichts wie raus hier. Irgendwas stimmt nicht mit dem Kerl. Er hat was, das erinnert mich an jemanden, den ich schon mal irgendwo gesehen habe.
Von seinem Platz am Garderobentisch aus konnte er Green, der sich im Hintergrund aufhielt, im Spiegel sehen. Ein weiterer Spiegel hinter der kleinen Bar zeigte Digger, was 246Green tat, während er zwischen den Flaschen unter der Theke herumstöberte.
»Ach, zier dich nich, Junge. Du mußt doch 'n bißchen feiern. Man legt nich alle Tage 'n Philip Michaelson aufs Kreuz, weißte. Der hält dich für 'n zweiten Messias.«
Diggers Miene verfinsterte sich. »Aufs Kreuz legen? Wovon reden Sie?«
»Naja, mein Junge, wir wissen doch beide Bescheid über deinen Schlamassel mit der Überleitung und mit dem schlimmen Finger, oder etwa nicht? War so 'ne Art Wunder, was du da auf der Bühne aus dem Ärmel gezaubert hast – hast ihnen Sand in die Augen gestreut mit guter Beinarbeit und so.«
Digger wußte nicht, was er sagen sollte. Das klang merkwürdig aus dem Munde eines Mannes, der sein Agent und Fürsprecher sein wollte. Digger starrte angestrengt auf Greens Spiegelbild. Da begann es zu verschwimmen. Einen Augenblick lang glaubte er, Greens Gesicht von einem anderen überlagert zu sehen.
Digger erinnerte sich an einen Trick, den er bei Leuten beobachtet hatte, die versteckte dreidimensionale Bilder betrachteten. Er hatte diese Technik kürzlich selber angewendet, konnte sich aber nicht erinnern, wo. Er konzentrierte den Blick auf den äußeren Rand des Greenschen Spiegelbildes und erstarrte. Er wollte den Kopf nicht bewegen und blieb daher in der Haltung. Wer war das Bild in dem Spiegel?
Das Spiegelbild wurde deutlicher und kam ihm irgendwie bekannt vor. Es war ein Mann in Diggers Alter, schwarz gekleidet mit einem Tablett voller Gläser in der Hand. Dann veränderte es sich: Jetzt sah er, daß es der Mann war, der ihn schlug und durchs Fenster warf – der Angreifer, der immer in seinen Alpträumen erschien.
Überwältigt angesichts der Bilder, die er vor sich sah, hörte Digger, wie Green sang:
247
»Bist du's nicht müde, vor dem Teufel zu fliehen? Weißt du denn nicht, der gleicht dir und mir aufs Haar.«
Als Digger diese Ballade hörte, wurde seine Furcht stärker, und seine Konzentration war dahin. Das Spiegelbild nahm wieder Greens Züge an.
»Es war gar nicht so leicht, dich zu finden, Patrick. Aber irgendwann hast du mich's immer wissen lassen, wo du warst.«
»Wovon reden Sie überhaupt?«
Ohne auf Diggers Frage einzugehen, lachte er. »Du hast immer geglaubt, ich wär derjenige, der für alles verantwortlich ist.«
Angst zitterte in Diggers Körper, wie schon so oft in seinem Leben: an jenem Wochenende in Chicago; in der Nacht, als das Restaurant sank; doch vor allem erst kürzlich – als er sich den Finger beim Softball Match brach; auf der Mole an der Mission Beach; in der Limousine; bei den Anrufen Greens.
»Du weißt doch, mich wirst du nie los. Ich bin dein wirklicher Freund und bin hier, dir zu helfen. Aber 's hat schon Spaß gemacht, dich zu quälen.«
Digger holte tief Luft und hörte im Geiste die Worte »laß los«. Er konzentrierte sich noch einmal auf die Technik.
»Du bist jetzt ganz anders. Früher hättest du dir nie erlaubt, mich zu sehen. Glaubst du, du wirst damit fertig, mein Junge?«
Greens Gesicht verschwamm – es war nun nicht mehr das Gesicht des Agenten. Das neue Bild wurde jetzt deutlicher, viel zu deutlich. Digger wollte es nicht glauben. Gänsehaut überlief seinen ganzen Körper.
Es war Diggers eigenes Gesicht.
Digger stand vom Garderobentisch auf, doch seine Knie schlotterten. Er schaffte es bis zur Couch. Dort brach er zusammen 248und schlug die Hände vors Gesicht. Zum Teufel, er wollte raus hier. Irgend etwas Phantastisches ging hier vor, und er hatte nicht die Zeit oder die Kraft, sich damit zu beschäftigen. Plötzlich spürte er, wie seine rechte Hand warm wurde, und er dachte an das Gefühl, das er am Klavier auf der Bühne gehabt hatte. Er erinnerte sich, wie schön es gewesen war, zu fliegen wie ein Adler.
Das war es: Die Wahrheit. Die Wahrheit hatte ihn befreit. Die Wahrheit seiner Gefühle hatte ihn befähigt, sich zu neuen Höhen aufzuschwingen. Er würde vor dieser Bedrohung nicht länger davonlaufen. Wer oder was Green auch immer sein mochte, Digger mußte es ein für allemal herausfinden. Er war es leid, vor seinen Ängsten davonzulaufen oder Mauern zum Schutz gegen sie zu errichten. Genug ist genug. Er mußte diesem Menschen endlich die Stirn bieten. Wer es auch sein mochte. Was es auch kosten mochte. Trotz seiner Angst war er bereit, sich zu stellen – wem auch immer. Er nahm die Hände vom Gesicht und öffnete die Augen.
In der Garderobe war niemand außer Digger. Die Tür war noch immer leicht angelehnt. Green hatte sich verflüchtigt. Digger erhob sich von der Couch und ging zur Bar. Zwei Gläser mußten kürzlich zum Mixen von Drinks benutzt worden sein. War das Michaelson gewesen oder Green, oder war ich es selbst und weiß es nicht mehr, weil ich zuwenig Schlaf hatte? Ist dieser Raum nur ein gewaltiger Traum? Ist diese ganze Reise überhaupt nur ein Traum?
An der offenen Tür klopfte es laut.
Digger antwortete nicht.
»Mr. Taylor«, brüllte eine laute Männerstimme.
Was in aller Welt geht hier vor, überlegte er. Ist das einer von Greens Tricks oder was? Vielleicht ist er ein Zauberer und mischt sich für irgend 'ne Nummer in meine Gedanken. Wenn das Green ist, ändert das nichts. Die Wahrheit wird 249mich von ihm befreien. Was er mir auch erzählen wird, ich werde damit fertig. »Herein.«
Ein Mann steckte seinen Kopf durch die Tür. »Ich bin Johnson vom Sicherheitsdienst. Ich habe eine Nachricht, die mir jemand auf den Tisch gelegt hat.«
Digger ging zur Tür und nahm den Brief. »Haben Sie den Mann gesehen, der das geschrieben hat?«
»Nee. Hab's erst vor 'ner Sekunde auf meinem Schreibtisch liegen sehen.« Der Wachmann wollte eben gehen, als er sich noch einmal umdrehte und sagte: »Ich will ja nicht drängeln, aber in ein paar Minuten sperr ich hier alles zu.«
»Danke. Ich bin gleich draußen.«
Digger schloß die Tür und betrachtete seinen Namen auf dem zusammengefalteten Stück Papier: Jonathan Patrick Taylor.
Er entfaltete den Brief.
Tut mir leid, daß ich nicht bleiben konnte. Sehe Sie zu anderer Zeit an anderem Ort.
S. Green.
Er war zu müde, um länger darüber nachzudenken. Er wollte nur raus hier. Schnell zog er sich um und packte zusammen. Dann eilte er die Treppen nach unten, wo ihn eine große, weiße Limousine mit männlichem Chauffeur erwartete. Er atmete tief durch und blickte in den Nachthimmel. Die Sterne schienen heller als sonst zu leuchten. Er lächelte und betrachtete für eine Weile das Firmament. Wieder wurde seine rechte Hand warm. Er zog sie aus der Hosentasche und betrachtete sie, als etwas auf die Stufe fiel. Er bückte sich, um es aufzuheben. Es war ein Umschlag, den ihm Mary an der Ocean Beach gegeben hatte. Ihm war, als sei seitdem ein Jahr vergangen, und doch war es erst heute früh gewesen.
250
Er stieg in den Fond des Wagens und wählte Marys neue Nummer.
»Hallo?« sagte sie verschlafen.
»Grüß dich. Ich hab dich doch nicht geweckt, oder?«
»Ach, hallo.« Ihre Stimme klang plötzlich lebhaft. »Du hörst dich so weit weg an. Wo bist du?«
»In L.A. … Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähl dir gleich alles. Aber zuerst hab ich eine Frage«, sagte er, fand den Hebel und ließ das Verdeck zurückrollen. Aus irgendeinem Grund wollte er die Sterne sehen, während sie miteinander sprachen. »Glaubst du, unsere Pflanze hat noch Kraft und Leben?«
251
Ich schwebe in der Balance
Nicht ahnend, daß ich selbst sie erschuf
Ich bin die Balance
Fürchte den Sturz ins Unbekannte
Ich bin das Unbekannte
Nicht ahnend, daß ich weiß
Ich bin das Schaffende
Das Fallende
Das Wissende
Also lasse ich mich fallen
damit ich wisse
und im Wissen Erschaffender sei
Da schwebe ich also in der Balance
VON NEUEM
252
Ich möchte mich bei Mike MacCarthy bedanken, der mir geholfen hat, meinen Worten die richtige Form zu geben. Dank auch an Lianne Stevens Downey für ihren Rat und ihre Hilfe bei der Feinabstimmung sowie an Dave Peters und Mark Bowers, die mir ihr Computerwissen zur Verfügung stellten. Karen Popowski, Bob, Debbi und Jake Gillespie, Diane Doyle, Pam Iverson, Gayle Watson, »Kat« Edwards und Dianne Sala danke ich für die hilfreiche und verständnisvolle Begleitung meiner Arbeit.
Mein Dank gilt Ahmay, Mark, Ramda, Zorinthalian und Paula. Ohne ihre Weisheit, ihre Geduld und Liebe wäre all dies nicht möglich gewesen.
Allen, die mir auf dieser Reise zur Seite gestanden haben, sage ich: Danke.
253
Fast mein ganzes Leben lang, in schwierigen, aber auch in glücklicheren Zeiten, hatte ich das Gefühl, daß es mir an irgend etwas fehlte. Ich wußte nicht, was es war, ich wußte nur, daß ich es nicht besaß. An einem Tag im Februar 1987 wurde ich beim Meditieren an einen Ort getragen … einen Ort, der jenseits der Mauern meines Erinnerns verborgen liegt. In den darauffolgenden sieben Jahren erschloß sich mir durch Menschen, Orte, Bücher, Filme, geometrische Figuren und Musik eine Erkenntnis, die außerhalb der erkennbaren Erfahrungen meines Lebens lag. Nachdem ich alles aufgezeichnet hatte, woran ich mich erinnern konnte, schrieb ich diesen Roman im Bemühen einer Rekonstruktion meiner Reise – meines Besuches in …?
Viele der Charaktere, der Orte und Ereignisse in der Himmelsbar sind mir tatsächlich im Leben begegnet; doch habe ich den einen oder anderen Namen geändert, um die Privatsphäre nicht zu verletzen. Dieses Buch erzählt eine Geschichte, in die die zahlreichen Wirklichkeiten meines Bewußtseins einfließen – Wirklichkeiten, die, wie ich weiß, tatsächlich vorhanden sind. Um diese neuen Wirklichkeiten wahrzunehmen, bedurfte es in meinem Falle lediglich einer veränderten Wahrnehmung. Ich sah mich nun im spirituellen Sinne auf der Heimreise, und diese Erkenntnis ermöglichte es mir, liebend meinen Weg zu gehen und diese Welt mit all ihren Freuden und Leiden, in all ihrer Vielschichtigkeit tiefer zu verstehen. Von da an nahmen Frieden und Balance immer 254nachhaltiger von meinem Innern Besitz. Doch alles begann mit meiner Spiritualität, mit der tragenden Rolle, die ich ihr zuerkannte, und meiner Bereitwilligkeit, dieser neuen Wahrnehmung gemäß zu handeln.
Das Ziel von Einkehr ist es, die Erfahrungen meiner Reise mitzuteilen in der Hoffnung, daß Sie alle diese aufregende, wundersame, liebevolle Welt mit mir erkunden werden. Ich weiß heute, daß wir alle von Zeit zu Zeit Orientierungshilfe, Ruhe, Geborgenheit und freundschaftliche Zuneigung brauchen. Denken Sie daran: Niemand von uns ist allein in diesem Streben. Wenn Sie also in Ihrem Herzen eine schmerzende Leere verspüren oder das Gefühl haben, daß »irgend etwas« fehlt, dann schauen Sie mal an meinem Lieblingsort vorbei: der Himmelsbar.
Auf bald,
Oktober 1994