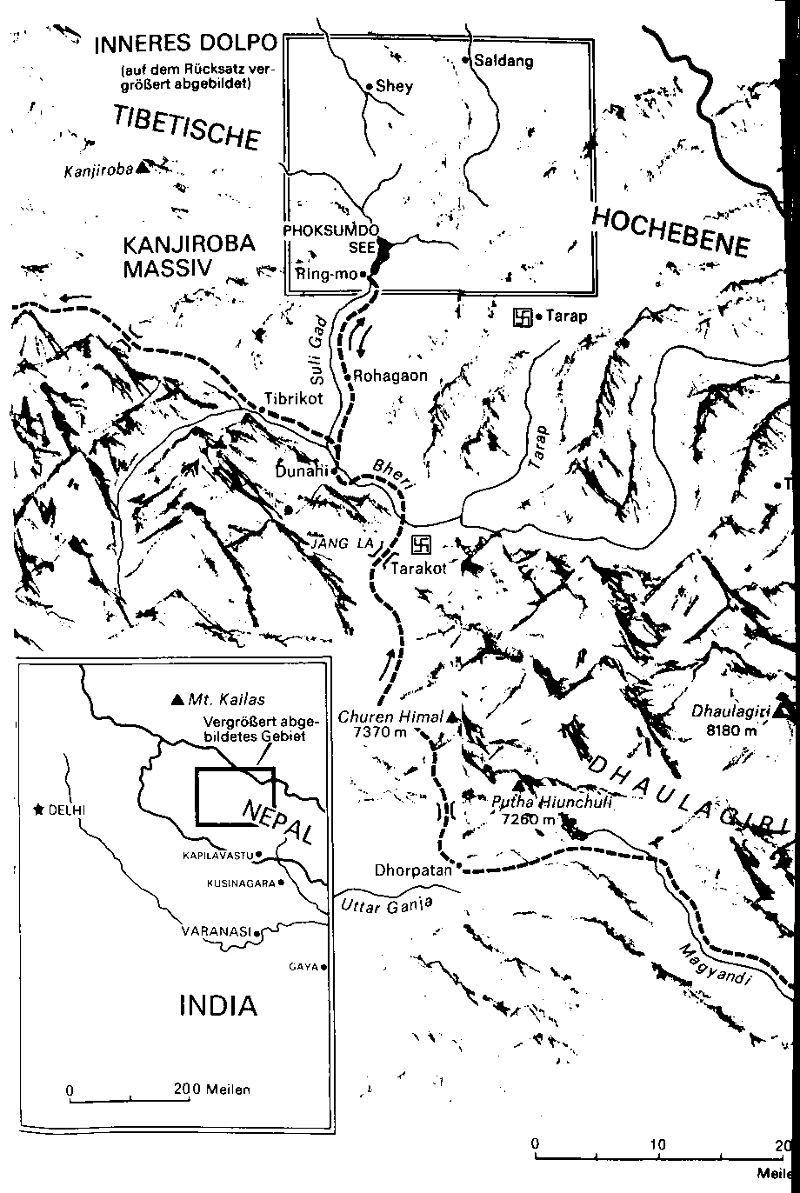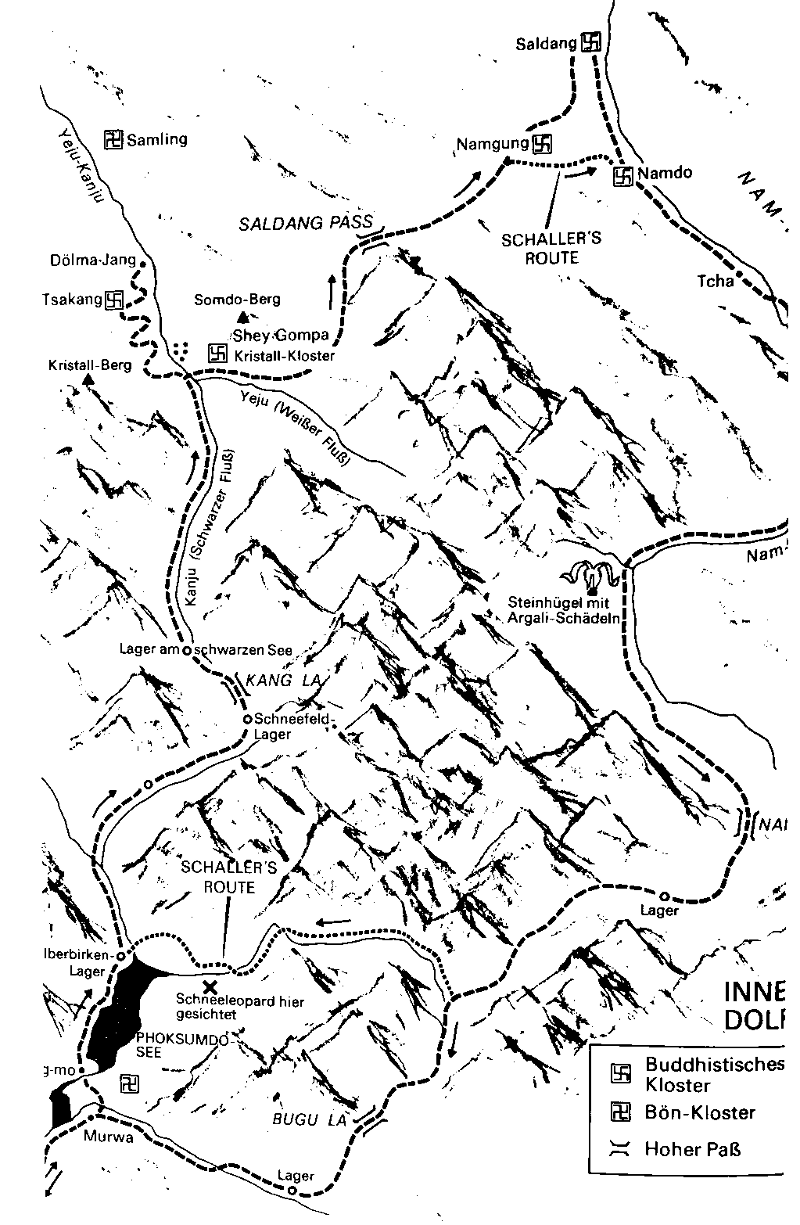Eine Forschungsreise an die äußersten Grenzen der Welt und die innersten Grenzen des Ich.
Dies ist der eindrückliche Bericht über eine außergewöhnliche Expedition in das Hochland an der tibetischen Grenze, über einen 400 Kilometer langen Fußmarsch durch eine Gegend, die noch kaum ein Fremder betreten hat.
Die extremen Bedingungen, das gleißende Licht und die sauerstoffarme Luft machen Peter Matthiessen durchlässig für Grenzerfahrungen des Bewußtseins. So wird diese Expedition für ihn zugleich eine Forschungsreise in sein Inneres, eine »Pilgerschaft des Herzens«.
Für diese faszinierende Beschreibung von Menschen, Landschaft und innerer Erfahrung erhielt der Autor den wichtigsten amerikanischen Literaturpreis.
»Matthiessen ist ein wunderbarer Beobachter, vielleicht deshalb, weil er sich stets bewußt ist, in der Gegenwart des Wunderbaren zu sein. Wenn er nach innen schaut und nach außen blickt, dann verschmelzen die beiden Landschaften miteinander.
Das ist Zen in der Kunst des Beobachtens.«
New York Times
Als Peter Matthiessen zusammen mit seinem Freund George Schaller von Pokhara in Westnepal zu einer außergewöhnlichen Expedition in das Hochland an der tibetischen Grenze aufbricht, liegt ein 400 Kilometer langer Fußmarsch vor ihnen. Er führt sie, unter extremsten Bedingungen, in eine Gegend, die noch kaum der Fuß eines Fremden betreten hat. Für Peter Matthiessen, der sich in einer Lebenskrise befindet, ist dieses Unternehmen zugleich eine »Pilgerschaft des Herzens«, der Versuch, zu seinem wahren Ich zu finden.
Äußerer Anlaß des Abenteuers ist die Hoffnung, einen der letzten Schneeleoparden, die seltenste und schönste Großkatzenart, aufzuspüren. Das scheue Tier, dessen Spuren sie immer wieder kreuzen, wird für Matthiessen zu einem Symbol seiner inneren Suche. Die Gefahren der Bergwildnis des Himalaja, denen er sich dabei aussetzt, – Wetterstürze, Sturm, Hagelschlag, alles erstickende Schneefälle – sind Belastungen, die bis an die Grenze des Ertragbaren gehen und unter denen eingefahrene Verhaltensmuster zerbrechen. Das gleißende Licht und die sauerstoffarme Luft machen ihn durchlässig für Grenzerfahrungen des Bewußtseins. Bergdämonen, die Berichte der Einheimischen vom legendären Schneemenschen Yeti und die Mystik der tibetischen Mönche verlieren ihre Fremdheit – sie erscheinen fast wirklicher als die für einige Monate hinter dem gläsernen Horizont versunkene Welt einer rein materialistischen Zivilisation.
Dem Amerikaner Peter Matthiessen, bekannt durch seine früheren Expeditionsberichte und Romane, brachte dieser atemberaubende Erfahrungsbericht den begehrten »National Book Award« ein. Seine Fähigkeit der genauen Beobachtung und präzisen Beschreibung von Menschen, Landschaften und inneren Erfahrungen, sein mitreißender Stil, der den Leser in die funkelnde, überwache Klarheit der Schneegipfel des Himalaja versetzt, ließen das Buch in den USA zu einem Bestseller werden.
Peter Matthiessen
Die Reise in ein vergessenes Land –
eine Expedition
in Grenzbereiche der Erfahrung
Scherz
Einzig berechtigte Übersetzung aus dem Amerikanischen von Maria Csollány und Stephan Schuhmacher. Titel des Originals: »The Snow Leopard«. Erste Auflage 1980. Copyright © 1978 by Peter Matthiessen. Gesamtdeutsche Rechte beim Scherz Verlag, Bern, München, Wien.

Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt: mutig zu sein zu dem Seltsamsten, Wunderlichsten und Unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Daß die Menschen in diesem Sinne feige waren, hat dem Leben unendlichen Schaden getan; die Erlebnisse, die man »Erscheinungen« nennt, die ganze sogenannte »Geisterwelt«, der Tod, alle diese uns so anverwandten Dinge, sind durch die tägliche Abwehr so sehr aus dem Leben hinausgedrängt worden, daß die Sinne, mit denen wir sie fassen könnten, verkümmert sind. Von Gott gar nicht zu reden.
7
Ende September 1973 machte ich mich zusammen mit GS auf eine Reise zum Kristall-Berg. Wir wanderten westwärts unterhalb des Annapurna und nach Norden den Lauf des Kali-Gandaki-Flusses entlang, dann in westlicher und nördlicher Richtung um die Dhaulagiri-Gipfel und über das Kanjiroba-Gebirge, insgesamt rund vierhundert Kilometer in das Dolpo-Gebiet auf der Tibetischen Hochebene.
GS ist der Zoologe George Schaller. Ich lernte ihn 1969 in der Serengeti-Steppe in Ostafrika kennen, wo er an seiner vielgepriesenen Studie über den Löwen arbeitete.[1] Als ich ihm das nächste Mal im Frühling in New York City begegnete, hatte er eine Forschungsarbeit über Wildschafe und -ziegen und die ihnen nahverwandten Ziegenantilopen begonnen. Er lud mich ein, ihn im kommenden Jahr auf eine Expedition in den Nordwesten Nepals zu begleiten, wo er in der Nähe der tibetischen Grenze die Bharals oder Himalaja-Blauschafe beobachten wollte; es ging ihm um einen Beweis für seine Vermutung, daß diese seltene »Schafsart« entlegener Gebirgsregionen weniger zu den Schafen als vielmehr zu den Ziegen gehört und möglicherweise der gemeinsamen Urform beider Arten sehr nahesteht. Wir wollten die Tiere in der Herbstbrunft beobachten, denn das Fressen und Schlafen, mit dem sie in den übrigen Jahreszeiten hauptsächlich beschäftigt sind, läßt kaum Hinweise auf ihre Evolution und für die vergleichende Verhaltensforschung zu. In der Gegend von Shey Gompa, dem »Kristall-Kloster«, dessen buddhistischer Lama verboten hatte, den Tieren etwas anzutun, sollten Bharals angeblich noch in größerer Zahl vorkommen und leicht zu beobachten sein. Und wo es genügend Bharals gab, da sollte eigentlich auch die seltenste und schönste der Großkatzen, der Schneeleopard, vorkommen. GS kannte nur zwei Nichtasiaten – er selbst war einer 8davon –, die im Laufe der letzten fünfundzwanzig Jahre mit eigenen Augen einen Schneeleoparden im Himalaja gesehen hatten; die Hoffnung, das nahezu schon mythische Tier dort in den Schneebergen zu Gesicht zu bekommen, wäre allein Grund genug für die Reise gewesen.
Vor zwölf Jahren hatte ich während eines Besuchs in Nepal die eindrucksvollen Schneegipfel im Norden gesehen; diese Entfernung zu überwinden, das großartigste Gebirge unserer Erde Schritt für Schritt zu überqueren, auf dem Weg zu einem Ort, der Kristall-Berg genannt wird, sollte eine echte Pilgerfahrt sein, eine Reise des Herzens. Seit die Chinesen sich Tibet angeeignet haben, gilt das bis heute im Westen nahezu unbekannte Gebiet von Dolpo als eine letzte Enklave reiner tibetischer Kultur, wie die tibetische Kultur ihrerseits zur letzten Bastion »all dessen geworden ist, wonach die heutige Menschheit sich sehnt, entweder weil es verlorengegangen oder noch nicht verwirklicht worden ist, oder weil es in Gefahr ist, ganz aus dem Blickfeld der Menschheit zu entschwinden: Das ist die Stabilität einer Tradition, die ihre Wurzeln nicht nur in der historischen oder kulturellen Vergangenheit hat, sondern im innersten Wesen des Menschen …«[2] Der Lama von Shey Gompa, der in Dolpo am höchsten verehrte Rimpotsche oder »Kostbare«, hatte seine einsame Klausur nicht verlassen, als vor siebzehn Jahren ein Kenner der tibetischen Religionen[3] zum Kristall-Kloster vorgedrungen war, doch wir waren überzeugt, daß wir mehr Glück haben würden.
Auf dem Weg nach Nepal besuchte ich Varanasi, die heilige Stadt am Ganges, und die buddhistischen Heiligtümer in Bodhgaya und Sarnath. Mitte September lag die braune Hitze der Monsuntage drückend über der Gangesebene, und ich war froh, daß ich nach wenigen Tagen weiter nach Norden, nach Katmandu in den grünen Ausläufern der Himalaja-Kette weiterfliegen konnte. Dieser Tag war klar, zwischen Tempeltürmen und abgestuften Pagoden taumelten rote und schwarze Drachen im Wind. Die trockene Luft in 1300 Meter Höhe war wohltuend nach der feuchten Hitze Indiens, doch die Gipfel im Norden waren von dichten Monsunwolken verhangen, und abends regnete es.
Im Hotel traf ich GS an. Wir hatten uns über ein Jahr nicht 9gesehen, die letzten Briefe hatten wir im Sommer gewechselt, und er war froh, daß mir nichts dazwischengekommen war. In den folgenden beiden Stunden hatten wir ein derart intensives Gespräch, daß ich mich fragte, ob es in den kommenden Monaten überhaupt noch etwas zu sagen geben werde. Wir würden einander als die einzige Gesellschaft haben, und wir kannten uns noch nicht sehr gut. (Ich hatte einmal über GS geschrieben, er sei »zielstrebig, unzugänglich«, außerdem »ein strenger Pragmatiker und als solcher nicht imstande, einen unwissenschaftlichen Standpunkt wohlwollend zu beurteilen; er mustert alles mit kritischem Blick«.[4] Aber auch als »eifrigen, schmächtigen jungen Mann« hatte ich ihn beschrieben, und auch jetzt war er eifrig und mager wie eh und je.)
Während der letzten drei Tage in Katmandu herrschte Regenwetter. Verzweifelt drängte GS zum Aufbruch, nicht nur, weil er Städte haßt, sondern weil der Winter früh in den Himalaja einfällt und der hiesige Monsunregen auf den hohen Pässen zwischen Katmandu und unserem Ziel wahrscheinlich als schwere Schneemasse niederging. (Wie wir später erfuhren, übertraf die in jenem Oktober gemessene Regenmenge alle bisherigen Rekorde.) Bereits Monate zuvor hatte GS eine Einreiseerlaubnis nach Dolpo beantragt, aber diesem Antrag wurde erst am letzten Tag stattgegeben. Wir schrieben die letzten Briefe und schickten sie ab; wo wir hingingen, würde es keine Post geben. Alle überflüssigen Gegenstände und Kleidungsstücke wurden ausrangiert, die Reiseschecks tauschten wir in schmutzige Päckchen kleiner Rupienscheine um, denn bei Bergvölkern kann man mit großen Banknoten nichts anfangen. Zusammen mit den Sherpa, unseren Reise- und Lagergehilfen, verstauten wir Zelte und Geschirr und kauften, was uns an Vorräten noch fehlte, im orientalisch lauten Asan Basar, wo ich 1961 einen kleinen, von grüner Patina überzogenen Bronze-Buddha erstanden hatte. Später begannen meine Frau und ich mit der Praxis des Zen-Buddhismus, und es war der grüne Buddha aus Katmandu, den ich im New-York-Hospital auf den kleinen Altar in Deborahs Zimmer stellte, wo sie im Winter letzten Jahres an Krebs starb.
10
Früh am Morgen des 26. September, bei heftigem Regen, quetschten wir uns samt Fahrer, zwei Sherpa und der gesamten Expeditionsausrüstung in einen Landrover, der uns nach Pokhara bringen sollte; zwei weitere Sherpa und fünf Tamang-Träger folgten anderntags mit dem Bus nach. Am achtundzwanzigsten September wollten wir aus Pokhara aufbrechen. Nun hatte es dreißig Stunden lang ununterbrochen geregnet, wodurch alle Abreisen und Ankünfte in Frage gestellt wurden. Bei diesem verheerenden Wetter erschien mir unsere Reise immer unwirklicher, und an der Hoteltheke stürzte mich das warme Lächeln einer hübschen Touristin in Zweifel: Wie stellte ich mir diese Reise vor, wohin wollte ich überhaupt und weshalb?
Von Katmandu führt die Straße nach Pokhara durch das ehemalige Gurkha-Reich am Fuß des Zentralgebirges; hinter Pokhara gibt es keine Straße mehr nach Westen. Durch die steilen Schluchten des Flusses Trisuli, der durch die Regenfälle zum reißenden Strom angeschwollen war, windet sich die Straße gegen Westen. Das schmutzige Wasser schäumte in den Stromschnellen und wurde zunehmend trüber, da immer wieder Erdrutsche von den Wänden hinabdonnerten. Hin und wieder stürzten Felsbrocken vor uns auf die Straße; dann wartete der Fahrer, bis alles zur Ruhe gekommen war, und schlängelte sich dann durch das Geröll, während wir zu den drohend über uns hängenden Gesteinsmassen hinaufstarrten. In den regenverhangenen Bergen begegnete uns eine Gruppe vermummter Gestalten. Sie trugen einen Leichnam, und ihr Anblick erweckte düstere, unbehagliche Vorahnungen.
Nach Mittag ließ der Regen nach, und im grell zwischen den Sturmwolken hervorbrechenden Sonnenlicht fuhr der Landrover in Pokhara ein. Der nächste Tag brachte eine wäßrige Sonne, am Südhimmel wechselte die Bewölkung, während vom Himalaja im Norden nichts zu sehen war als dicke Wolkenwirbel. In der Abenddämmerung schwebten weiße Reiher vor den tiefhängenden, jetzt wieder regenschwarzen Wolken; über die Erde brach Dunkelheit herein. Dann plötzlich strahlte mehr als sechs Kilometer über den schmutzigen Straßen des Flachlandes ein leuchtend weißer Schein auf, so hoch, als läge er gerade über unseren Köpfen: das Licht der Schneefelder. Gletscher tauchten auf und 11verschwanden wieder im Grau; und noch einmal öffnete sich der Himmel, und die Schneehaube des Machhapuchare glitzerte wie eine Turmspitze eines überirdischen Königreiches.
In der Nacht versammelten sich die Sterne, und obwohl der Mond nicht schien, leuchtete der Machhapuchare wie ein riesiger Geist in der Ferne. Der Schuppen, in dem wir hinter einer Art von Gasthaus kampierten, war voller Moskitos. Einmal schrie mein Freund im Traum auf. Ich fand keinen Schlaf und ging bei Tagesanbruch ins Freie, wo drei Gipfel des Annapurna klar aus einer niedrig hängenden Wolkenbank hervorragten. Heute wollten wir nach Nordwesten aufbrechen.
13
So wie eine weiße Sommerwolke im Einklang mit Himmel und Erde frei im blauen Äther schwebt und von Horizont zu Horizont zieht, dem Hauch der Lüfte folgend, so überläßt sich der Pilger dem Strom des größeren Lebens, das … ihn über ferne Horizonte zu einem seinem Blick noch verborgenen, aber stets gegenwärtigen Ziel führt.
Während die übrigen Wesen gebeugt zur Erde hin sehen, gab er dem Menschen ein aufrecht Gesicht und hieß ihn den Himmel schauen, aufwärts den Blick empor zu den Sternen erheben.
15
Bei Sonnenaufgang versammelt sich die kleine Expedition unter einem riesigen Feigenbaum außerhalb von Pokhara: zwei weiße Sahibs, vier Sherpa und vierzehn Träger. Die Sherpa kommen aus jenem berühmten Bergstamm in Nordost-Nepal, der von jeher die Bergführer und Begleiter für die Besteigung der Himalaja-Gipfel stellt. Das buddhistische Hirtenvolk der Sherpa ist in den vergangenen Jahrhunderten aus Osttibet eingewandert – Sherpa heißt auf tibetisch »Ostländer« – und die tibetische Herkunft zeigt sich sowohl in ihrer Sprache als auch in ihrer Kultur und ihrem Aussehen. Unter den Trägern ist ebenfalls ein Sherpa, dazu kommen zwei tibetische Flüchtlinge, die anderen sind gemischt arischer und mongolischer Rasse. Die meisten barfuß, in zerrissenen Shorts oder am Gesäß pludrigen und an den Beinen engen indischen Hosen, mit den verschiedensten alten Jacken, Schals und Kopfbedeckungen bekleidet, taxieren die Träger die großen Weidenkörbe. Zusätzlich zu ihrem eigenen Proviant und ihren Decken schleppen sie auf vornübergebeugtem Rücken eine Traglast von bis zu vierzig Kilogramm, gehalten von einem breiten Stirnband.
Vor einer jeden solchen Reise in das Gebirge gibt es zunächst ein langes Abwägen und Schimpfen über die Lasten, das von schrillem Gefeilsche begleitet wird. Die Träger stammen meist aus der näheren Umgebung, Leute ohne feste Arbeit, aus Gewohnheit unzuverlässig und berüchtigt dafür, daß sie nur Ärger machen. Allerdings werden sie für ihre Plackerei elend bezahlt; sie bekommen etwa einen Dollar pro Tag. In der Regel begleiten sie die Expedition nur bis zu einer Wochenreise von ihrem Heimatort aus und müssen dann durch neue Träger ersetzt werden, wobei das Schreien und Feilschen von neuem beginnt. Heute brauchen wir zwei Stunden, bis alle vierzehn Träger zufrieden sind und die zerlumpte Schar sich nach Westen aufmacht. Unterdessen sind am Himmel die ersten Wolken aufgezogen.
Wir sind froh, losmarschieren zu können. Am Stadtrand von Pokhara sieht es aus wie in den Außenbezirken aller tropischen Städte: herumlungernde Kinder, mißmutige Erwachsene, krumme Hunde und magere Hühner im Durcheinander zerfallender 16Baracken, zwischen Müll, Schlamm, Unkraut und stinkenden Wassergräben; in der Luft ein faulig-süßer Geruch, überall grellfarbener Plastikabfall und schmutzige Fruchtschalen, die von den Schweinen verschlungen werden. Die hungrigen Schweine und Hunde fressen sogar menschliche Exkremente, die überall am Wegrand liegen. Bei schönem Wetter kann man das Treiben mit etwas gutem Willen malerisch nennen, jetzt aber, am Ende der Regenzeit, scheint sich aller Dreck des Lebens in die fahle Haut der ausgemergelten Gestalten eingefressen zu haben, die sich kauernd abseifen und ihre Kleider jeden Morgen in den Regenpfützen spülen.
Braune Augen sehen uns nach. Die Not Asiens kann man weder ansehen noch sich von ihr abwenden. In Indien tritt das menschliche Elend derart geballt auf, daß man nur Einzelheiten wahrnimmt: ein verkrüppeltes Bein oder eine leere Augenhöhle, ein kranker Hund, der welkes Gras frißt, oder eine alte Frau, die den Sari lüftet, um ihren harten Kot am Straßenrand abzusetzen. In Varanasi gibt es noch Lebenshoffnung, die in Städten wie Kalkutta längst abgetan wurde, Städten, die an die Toten und Sterbenden in ihren Gossen aufgegeben scheinen. Shiva tanzt in den gewürzten Speisen, im heiteren Geklingel der Fahrradpulks, im ungehaltenen Hupen der Busse und im Gekecker der Tempelaffen, in den leuchtend roten Kastenzeichen auf den Frauenstirnen und selbst im Geruch von verbranntem Menschenfleisch, der über den Ghats liegt. Das größte Wunder dabei ist, daß die Menschen lächeln. Im heißen, stinkenden, lärmenden Varanasi, wo beim feurigen Sonnenaufgang Schwalben wie die Seelenvögel der Verstorbenen über den ruhigen, breiten Fluß entschwinden, rührt einen plötzlich dieses Lächeln an, das Lächeln eines blinden Mädchens oder eines würdigen alten Hindu mit weißem Turban, der dem schimpfenden Busfahrer gütig nachschaut, eines Flöte spielenden Betteljungen oder einer gebrechlichen alten Frau, die heiliges Wasser aus dem Ganga, dem Fluß, über einen rotgefärbten Steinelefanten ausgießt.
Gleich neben den Scheiterhaufen und den Schlachthöfen erhebt sich am Fluß ein großer Palast, bemalt mit riesigen Tigern in Bonbonfarben.
Varanasi dürfte auch das Ziel jenes uralten Hindu sein, dem 17wir am Rand von Pokhara begegnen; kauernd in einem Korb, der von vier Dienern an Stangen auf den Schultern getragen wird, befindet er sich offenbar auf seiner letzten Reise zur Mutter Ganges mit den dunklen Tempeln oberhalb der Scheiterhaufen, wo die Pilger warten können, bis ihre Stunde gekommen ist und sie sich den weißen Leichnamen zugesellen, welche wiederum darauf warten, auf brennende Holzstapel gelegt zu werden. Die Wärter schieben hier einen gelben Fuß, dort einen gekrümmten Ellbogen ins Feuer zurück und rechen zuletzt die Überreste von dem brennenden Scheiterhaufen in die rasche Strömung. Aber immer bleibt noch so viel übrig, daß die langschnäuzigen Aashunde davon leben können, die die Asche durchwühlen, während heilige Kühe – stille, große, weiße Geschöpfe – die Strohseile fressen, mit denen die ausgemergelten Körper auf ihrer Bahre festgebunden werden.
Der alte Mann, der an uns vorbeigetragen wird, ist innerlich ausgezehrt. Der blinde, gierige Blick aus tiefliegenden Augen und der vor sich hin mümmelnde Mund verraten, wer hier Wohnung bezogen hat und nun zu den Augen herausstarrt.
Ich nicke dem Tod im Vorübergehen zu, plötzlich des Tappens meiner eigenen Füße auf dem Pfad bewußt. Der Alte ist schon in einer Schattenwelt verloren und erwidert die Geste nicht.
Ein grauer Uferweg, darüber grauer Himmel. Eine bunte Bachstelze hüpft in der Schnelle von Fels zu Fels.
Begegnungen auf dem Weg: eine zarte Frau mit einem Packkorb voll kleiner silberner Fische, eine andere wird von einem Korb voller Steine niedergedrückt, der meinen Rucksack beschämend leicht erscheinen läßt. Die Steine werden in Pokhara von anderen Frauen zu Schotter zerklopft, die Arbeit von Millionen brauner Hände für eine neue Straße südwärts, nach Indien.
Die Sonne bricht durch, es nähert sich eine Gruppe von Magar-Frauen, sie tragen rote Schals und schweren Messingschmuck im linken Nasenflügel. Ein Hahn mit großem, rotem Kamm klettert im Morgenlicht eilfertig auf das Strohdach einer Hütte am Wegrand, ein kleines Mädchen stimmt ein Lied an. Unter dem Himmel türmen sich die leuchtend weißen Gipfel des Annapurna, ein Bollwerk inmitten der gewaltigen Brustwehr, die sich in 18westöstlicher Richtung über 2700 km erstreckt: der Himalaja, die alaya (Wohnstätte) des hima (Schnee).
Hibiskus, Rhododendron und Bougainvillea, vor der Kulisse der Schneegipfel scheinen die tropischen Blüten zu einer Märchenlandschaft zu gehören. Auf einer grünen Wiese tummeln sich Makak-Affen, eine Türkentaube dreht ihre Runden im strahlenden Licht. Die häufigsten Vogelarten in dieser Gegend sind Drongos, Tauben, Bartvögel und der weiße Ägyptische Geier; sie alle haben nahe Verwandte in Ostafrika, wo GS und ich uns kennenlernten. GS fragt sich, wie ein hiesiger Geier sich wohl beim Anblick eines Straußeneis verhalten würde; im Pleistozän war der Strauß auch in Asien heimisch. Den Ägyptischen Geier Afrikas zählt man zu den »werkzeugbenutzenden« Vogelarten, denn er bricht die riesigen Straußeneier auf, indem er mit seinem Schnabel Steine gegen die Schale schleudert.
Bis in jüngste Zeit waren die Ebenen Nepals mit Wäldern des immergrünen Salbaumes (Shorea robusta) bedeckt, die Elefanten, Tiger und das große Indische Nashorn beheimateten. Das Abholzen der Wälder und die Vernichtung der Grasnarbe durch Viehherden hat sie verschwinden lassen. Nur im Südosten, im Rapti-Tal, leben noch einige wenige Elefanten. Der letzte wilde indische Gepard wurde 1952 in Zentral-Indien gesichtet, der asiatische Löwe ist mit Ausnahme einer kleinen Population in den Gir-Wäldern nordwestlich von Bombay ausgerottet, und der Tiger gehört schon fast überall zu den Fabeltieren. Die Zahl der freilebenden Huftiere nimmt vor allem in Indien und Pakistan rapide ab, seit ihre Lebensräume durch die expandierende Landwirtschaft, durch Abholzen der Wälder und übermäßiges Abweiden durch ausgehungerte Haustierherden, durch Erosion und Überschwemmung zerstört werden – durch den ganzen unheilvollen Zyklus, der durch die Überbevölkerung einer Landschaft in Gang kommt. Mehr als anderswo auf der Erde ist in Asien die Errichtung von Naturschutzgebieten erforderlich, ehe noch die letzten Vertreter einiger Tierarten ausgerottet sind. Wie GS schrieb, »verändert der Mensch die Welt so rasch und grundlegend, daß die meisten Tiere sich den geänderten Bedingungen nicht anzupassen vermögen. Wie auch andere Orte der Erde ist der Himalaja Schauplatz eines großen Sterbens, das um so trauriger 19ist als das Aussterben der Arten im Pleistozän, da der Mensch inzwischen die Mittel hat und um die Notwendigkeit weiß, die Zeugen seiner eigenen Vergangenheit zu retten.«[5]
Der Trägerpfad entlang dem Yamdi-Fluß ist eine wichtige Handelsroute. Er führt durch Reisfelder und Dörfer bis zum Fluß Kali Gandaki und wendet sich dann nach Norden gegen Mustang und Tibet. Auf grünen, eingezäunten Weiden mit riesigen Feigenbäumen, alten Steinbecken und Mauerresten grasen Rinder und Wasserbüffel. Das frische Wasser und die schattige Kühle erinnern an die Harmonie einer Parklandschaft. Die Landbevölkerung hat noch weniger Besitz als die Bewohner von Pokhara, doch die Leute sind durch ihr althergebrachtes Wirtschaftssystem vor dem Elend der modernen Großstädte bewahrt. Man versteht, weshalb so viele Philosophen, von Laotse bis Gandhi, das dörfliche Leben als die natürliche, dem Menschen gemäße, glückliche Daseinsform preisen. In der warmen Sonne spielen Kinder, Frauen klopfen Wäsche auf den Steinen des Dorfbrunnens oder zerstampfen Korn in Steinmörsern. Überall gackern Hühner, Misthaufen dampfen, und von den niedrigen Herdstellen steigt dichter Rauch auf. Die Höfe hinter den festen Zäunen sind sauber gehalten, die Lehmhütten in rötlichen Erdfarben tragen Strohdächer und haben handgeschnitzte Fenstersimse und -läden, dazwischen blüht gelber Kürbis. Auf schmalen Holzgerüsten sind Maiskolben aufgestapelt, der Reis liegt auf großen Strohmatten zum Trocknen ausgebreitet, und zwischen den Bananen- und Papayabäumen hängen große, behäbige Spinnen vor dem hellen Himmel.
Durch die Ortschaft zieht sich ein Wassergraben, stellenweise von meterlangen Granitplatten überbrückt, das Wasser rinnt langsam über die glänzenden Kiesel. Mittags sitzen wir im kühlen Schatten auf einer Steinmauer, während die Luft in der Sonnenhitze flimmert. Am Wasserlauf steht das Teehaus des Dorfes, eine einfache, nach einer Seite offene Hütte mit roh gezimmerten Bänken und einem runden, kuppelförmigen Lehmherd auf dem Lehmboden. An der Seite des Herdes kann man Reisig durch eine Öffnung nachschieben, oben sind zwei Löcher für die Wasserkessel, aus denen das kochende Wasser geschöpft und durch 20ein mit billigem Teestaub gefülltes Sieb in ein Glas mit Rohzucker und Büffelmilch gegossen wird. Zu diesem Chiya essen wir trockenes Brot und frische Gurken. Kinder versuchen, uns mit Wasser aus dem Bach naßzuspritzen, auf einer hohen Bambusstaude schaukelt eine Kragentaube.
Einzeln kommen die Träger heran und drehen sich um, um ihre Traglast auf der niedrigen Mauer abzusetzen. Ein scheu dreinblickender Träger mit einem kindlichen Lächeln, der viel zu schmächtig für seine Last aussieht, bläst eine Melodie auf einem Feigenblatt. »Zu viel heiß«, sagt lächelnd ein anderer, der Sherpa-Träger namens Tukten. Er ist klein und drahtig, hat mongolische Augen und übergroße Ohren. Sein seltsames Lächeln stimmt mich nachdenklich – warum sich dieser Tukten wohl als Träger verdingt hat?
Als erster mache ich mich wieder auf den Weg und gehe im kühlenden Talwind allein voraus. Abwechselnd im hellen Septemberlicht und im Bergschatten – denn die steilen Berghänge rücken näher, das Tal verengt sich und verdeckt die Schneegipfel im Norden – führt der Pfad auf einen Damm zwischen dem verschilften Kanal und den grünen Reisterrassen, die Stufe auf Stufe bis zum Ufer herabreichen. Hinter dem Wasserlauf steigen sie wieder hügelan bis fast zum blauen Himmel.
An einem Rastplatz stehen zwei verschiedene Feigenarten: eine Bengalische Feige oder Banyanbaum (Ficus indica) und ein Pipalbaum (F. religiosa), der sowohl für Hindus wie für Buddhisten heilig ist. Kleine Sträuße wilder Blumen und bemalte Steine, die zwischen die hervortretenden dicken Wurzeln gelegt wurden, sollen dem Reisenden Glück bringen. Rings um die Stämme sind Mauerstufen errichtet, an die der schattensuchende Wanderer rückwärts herantreten und auf die er mit fast geradem Rücken seine Last absetzen kann. Derartige Rastplätze findet man überall entlang der Handelswege, manche so alt, daß die einst großen Bäume in der Mitte längst abgestorben sind und nur noch zwei runde Löcher in der Mitte einer ovalen Steinplattform von ihnen künden. Zusammen mit den Teehäusern und den großen Trittsteinen, die in die Hänge eingelassen sind, verleihen diese Rastplätze der Landschaft ein anheimelndes Gepräge, als wanderte man in einem versunkenen Reich des Goldenen Zeitalters.
21
Mit dem Rücken gegen den Baumstamm gelehnt, sitze ich auf der obersten Mauerstufe und warte auf die Träger, die sich durch die Reisfelder den Hang hinaufwinden. In der klaren, vom Bergwind leicht bewegten Luft beobachte ich zwei schwarze Kühe, die Reis dreschen; ihre Flanken glänzen in der Nachmittagssonne. Nachdem das Wasser von den Reisfeldern abgeleitet und der Reis mit Sicheln geschnitten wurde, führt man die in ein Joch gespannten Tiere an einer Leine in immer kleiner werdenden Kreisen um einen Pfahl in der Mitte des Feldes, wobei ihnen die Kinder ständig neue Reisbüschel unter die Hufe werfen. Die herausgefallenen Körner werden samt der Spreu in Körbe gekehrt und zu Tal gebracht, um dort im Wind geworfelt zu werden. In der Herbstluft tanzende, feuerfarbene Libellen, die leuchtend roten und gelben Gewänder der Träger, die schwarzglänzenden Rinder und die hellen Reisstoppeln, das frische Grün junger Reispflanzen und der schimmernde Bach – und über all dem flimmert ein Licht wie flüssiges Silber.
Die klare Luft trägt kaum Geräusch heran; es gibt hier nicht einmal die einfachsten Maschinen, und die Pfade sind zu steil und schmal, als daß man Karren benutzen könnte. Mit der Wärme, der Harmonie und dem scheinbaren Überfluß der Landschaft streift uns ein Hauch des paradiesischen Zeitalters. Der Salbaum-Hain namens Lumbini, nur etwa 50 km entfernt von hier in der fruchtbaren Ebene nördlich des Rapti-Flusses, mag sich seit dem sechsten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wohl kaum verändert haben, als dort im Reich der Elefanten und Tiger Siddhartha Gautama vom Adelsgeschlecht der Shakya geboren wurde. Gautama gab das Leben im Wohlstand auf, um ein heiliger Bettler, ein »Wanderer« zu werden, wie es noch heute in Nordindien Brauch ist. Er wurde zunächst unter dem Namen Shakyamuni (der Weise der Shakya) bekannt, später als Buddha, der Erleuchtete. In der Ganges-Ebene südlich von Lumbini, im Osten von Rajgir, Gaya und Varanasi, wo der Buddha sein Leben verbrachte, stehen noch heute die gleichen Feigenbäume und rauchenden Bauernhütten, mageres Rindvieh weidet auf grünen Wiesen, und darüber schweben weiße Silberreiher und Dschungelkrähen. Die Überlieferung sagt, daß er bis Katmandu gekommen sei (schon damals eine reiche Stadt der Newaren) und auf 22dem Hügel von Swayambunath zwischen Kiefern und Affen gepredigt habe.
In den Tagen Shakyamunis waren die Yoga-Techniken bereits hoch entwickelt. Rund tausend Jahre früher waren die dunkelhäutigen Drawiden im Tiefland Indiens von den nomadisierenden Ariern aus der asiatischen Steppe überfallen worden, die ihre Religion von den Himmels-, Wind- und Lichtgöttern über ganz Eurasien verbreiteten.[6] Die Glaubensvorstellungen der Arier sind in den Veden, uralten Sanskrittexten unbekannten Ursprungs, aufgezeichnet. Dazu gehören das Rigveda und die Upanishaden, die die Grundlagen der hinduistischen Religion darstellen. Dem wandernden Asketen Shakyamuni erschienen jedoch die epischen Schriften über das Wesen des Universums und des Menschen nicht geeignet als Heilmittel gegen das menschliche Leid. In seinen als die »Vier Edlen Wahrheiten« bekannten Lehrsätzen erklärt Shakyamuni, das Leben des Menschen sei untrennbar mit dem Leid verbunden; die Ursache des Leids sei Begierde; Friede könne nur durch das Auslöschen der Begierde erlangt werden; und der Weg zu dieser Befreiung sei der »Achtfache Pfad«: vollkommene Anschauung, vollkommener Entschluß, vollkommenes Denken, vollkommene Rede, vollkommenes Handeln, vollkommene Verinnerlichung, vollkommene Vertiefung, vollkommene Erleuchtung.
Bereits die Veden enthalten den Gedanken, daß die Gier nach Vergänglichem – da sie eine Empfindung des Mangels beinhaltet – der höchsten Daseinsstufe unwürdig ist; wichtig sei vielmehr die Erfahrung des »Todes im Leben« und der geistigen Wiedergeburt, die von allen geistigen Lehrern, von den frühen Schamanen bis zu den Existentialisten, gesucht wird. Shakyamunis Lehre ist also weniger eine Ablehnung der vedischen Philosophie als ein Versuch, sie in die Tat umzusetzen. Die von ihm vorgelebte intensive Meditationspraxis begnügt sich nicht mit der durch Yoga-Übungen hervorgebrachten inneren Stille (seiner Meinung nach macht diese vor den letzten Wahrheiten halt), sie geht darüber hinaus, bis die durchscheinende Helle des beruhigten Geistes sich in der Verwirklichung von Prajna auftut, jener transzendenten Erkenntnis, die den höchsten Stand des Bewußtseins auszeichnet, der allen Lebewesen innewohnt und dessen Voraussetzung eine 23unsentimentale Einswerdung mit der gesamten Existenz ist. Ein echtes Prajna-Erlebnis ist eine »Erleuchtung« oder Befreiung – keine Veränderung, sondern eine Umwandlung; es ist ein tiefes Wissen um die eigene Identität mit dem gesamten Universum, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, das den Menschen davor zurückhält, anderen Wesen Leid zuzufügen, und das ihn von der Angst vor Geburt und Tod befreit.
Fünf Jahrhunderte vor Christi Geburt, in der Gegend der Stadt Gaya südöstlich von Varanasi, erfuhr Shakyamuni Erleuchtung in der tiefen Erfahrung, daß sein eigenes Wahres-Wesen, sein »Buddha-Wesen«, sich nicht vom Wesen des Universums unterschied. Ein halbes Jahrhundert lang verkündete er fortan an Orten wie dem Wildgarten in Sarnath, in Nalanda und auf dem Geier-Hügel nahe dem heutigen Rajgir und anderswo seine Lehre von der Unbeständigkeit des individuellen Daseins und vom ewigen Werden, so wie ein Fluß morgens derselbe zu sein scheint wie in der Nacht zuvor, obwohl das Wasser darin ständig fließt. (Obwohl Shakyamuni auch zu Frauen sprach und das Kastensystem in Frage stellte, indem er Schüler niedriger Herkunft in seinen Orden aufnahm, beschäftigte er sich nie mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, geschweige denn mit Regierungsangelegenheiten; seiner Lehre zufolge ist die Selbstverwirklichung der größte Beitrag, den man zum Wohlergehen seiner Mitmenschen leisten kann.) Im Alter von achtzig Jahren starb er in Kusinagara (heute Kusinara) westlich des Flusses Kali Gandaki.
So weit die geschichtliche Wahrheit, alles andere gehört zur großen Buddhalegende, die eine Wahrheit anderer Ordnung darstellt. Über seine Erleuchtung wird berichtet, der Wanderer Shakyamuni sei dreißig Jahre alt gewesen, als er das harte Leben des Asketen aufgab und den »Mittleren Weg« zwischen dem Genuß und der Selbstkasteiung wählte, indem er die in einer goldenen Schale dargereichte Speise von der Tochter eines Dorfvorstehers annahm. Seine damaligen Jünger verließen ihn daraufhin. In der Abenddämmerung ließ er sich unter einem Feigenbaum nieder, wandte das Gesicht nach Osten und gelobte, er wolle sich so lange nicht von seinem Sitz erheben, bis er nicht vollkommene Erleuchtung erlangt habe, sollten ihm auch Haut, Sehnen und Knochen darüber schwinden und sein Lebensblut vertrocknen. 24Die ganze Nacht hindurch saß Shakyamuni, von Dämonen heimgesucht, in tiefer Meditation. Und, so wird berichtet, beim Anbruch des goldenen Tageslichtes erschaute der »Erwachte« den Morgenstern, als sähe er ihn zum erstenmal in seinem Leben.
An der gleichen Stelle, dem heutigen Bodhgaya – es ist immer noch dieselbe Savannenlandschaft mit weidendem Vieh, glitzernden Gewässern, Reisfeldern, Palmen und Hütten aus rotem Lehm, ohne gepflasterte Straßen oder elektrische Leitungen –, steht neben einem Buddhatempel ein uralter Feigenbaum, ein Abkömmling jenes ersten Bodhi-Baumes, des »Erleuchtungs-Baumes«, unter dem dieser Mann gesessen hatte. Vor zehn Tagen hatte ich an derselben Stelle, zusammen mit drei tibetischen Mönchen in kastanienbraunen Gewändern, in der warmen Morgendämmerung das Aufgehen des Morgensternes beobachtet, war aber hinterher nicht weiser als zuvor. Später fragte ich mich jedoch, ob die Tibeter wohl bemerkt hatten, daß im Bodhi-Baum lautes Vogelgezwitscher ausbrach, während es in einem anderen Baum derselben Art, der so nahebei stand, daß seine Krone die des heiligen Baumes berührte, völlig still blieb. Ich versuche damit nichts zu beweisen, ich berichte nur, was ich in Bodhgaya beobachtet habe.
Der Yamdi Khola wird zusehends schmaler, bald wird er ganz zwischen den Bergen verschwinden. In einem Dorf am Nordhang fallen uns mehrmals runde oder ovale Hütten statt der üblichen rechteckigen auf, und Jang-bu, der Sherpaführer, erklärt, es sei ein Dorf der Gurung, eines vor langer Zeit aus Tibet eingewanderten Volkes. Hier in dieser Gegend Nepals leben verschiedene Völker, teils mongolischer, teils arischer Abstammung, die meisten gehören zu den Paharis oder Berg-Hindus. Seit Jahrhunderten sind Hindus aus dem großen Gangesbecken nach Nepal aufgestiegen, während tibetische Einwanderer über die Bergpässe herabkamen. Die buddhistischen Stämme mit tibetischer Sprache, zu denen auch die Sherpa zählen, werden Bhotyas oder Südtibeter genannt. (Bhot oder B'od bedeutet Tibet, Bhutan am Südrand von Tibet heißt »Ende von Bhot«.) Auch unsere Träger stammen aus verschiedenen Völkerschaften, von denen die Stämme der Gurung und Tamang zum Buddhismus neigen, während 25die Chetri und Magar dem Hinduismus anhängen. Aber Hindus und Buddhisten, insbesondere die Gurung, verehren außerdem die animistischen Gottheiten der alten Religionen, die sich in den abgelegenen Winkeln der großen asiatischen Gebirge gehalten haben.
Ein paar langhaarige Tibeter, die flachen Gesichter mit Butter und Ocker eingerieben, kommen barfuß über die silbrigen Steine im Fluß gelaufen. (Ocker ist hier ein traditionelles Schutzmittel gegen Kälte und Insekten. Ehe der Buddhismus mit seinem zivilisierenden Einfluß nach Tibet gelangte, wurde es das »Land der rotgesichtigen Teufel« genannt.) Die Leute sind seit einer Woche von Dhorpatan nach Pokhara unterwegs. Nach der Getreideernte reisen Tibeter, Bhotyas aus Mustang und andere Bergbewohner in den Tälern und Schluchten nach Süden und Osten, bis nach Pokhara und Katmandu, wo sie ihre Wolle und ihr Salz gegen Getreide, Papier, Messer, Tabak und Tee eintauschen. Ein tibetischer Junge hat einen Fisch, eine Schmerle, im seichten Wasser gefangen, den er mir mit strahlenden Mandelaugen zeigt. Die Kinder hier sind zutraulich und fröhlich, sie betteln wohl auch ein wenig, aber nicht so hartnäckig wie die verhärmten Hindu-Kinder in den Städten. Manchmal nehmen sie einen bei der Hand und gehen ein Stück mit; andere schlagen Purzelbäume, spielen Haschen oder Verstecken.
An der Stelle, wo sich das Tal zur Schlucht verengt, steht ein Teehaus inmitten einiger Hütten. Eine Karawane mit vollbepackten schäbigen Mongolenponys kommt mit Glockengeläut den Berg herab und durchwatet spritzend das grünliche Wasser der Furt. Hinter dem Teehaus klettert ein steiler Pfad in den südwestlichen Himmel. Das Wirtschaftssystem dieser Bergvölker, die stets am Rande des Existenzminimums leben, baut von jeher auf den Handelsreisenden auf; in den Jahrzehnten, ja vielleicht Jahrhunderten, in denen dieser Fußpfad als Handelsroute der Bergstämme gedient hat, sind breite Stufen in den Berghang eingetreten worden. Wilde Kastanienbäume überschatten den Weg, wir pflücken einige der stachligen Früchte.
Bei Sonnenuntergang erreicht unsere Karawane ein Bergdorf namens Naudanda. Hier probiere ich meine neue Unterkunft, ein enges Einmann-Bergzelt in bereits mitgenommenem Zustand, 26aus. Phu-Tsering, unser freundlicher, rotbemützter Koch, bringt das Abendessen: Linsen mit Reis. Hinterher sitze ich draußen auf einem Hocker aus Weidenruten, den ich im Teehaus an der Furt gekauft habe, und höre den Zikaden zu. Auch ein Schakal ist zu hören. Der Bergkamm, den wir erklommen haben, verläuft in ostwestlicher Richtung und fällt beiderseits steil ab, zum Yamdi-Tal im Norden und zum Marsa nach Süden. Hier von Naudanda aus ist der Yamdi Khola nur noch ein weißes Band, das zwischen dunklen Koniferenwänden seiner Schlucht entgegenrauscht. Weit im Osten und weit unter uns, bei Pokhara, mündet der Marsa in den Phewa-See, der im Sonnenuntergang über dem Vorgebirge aufblinkt. Westlich von Pokhara gibt es keine Straßen mehr; seit wir diesen letzten Vorposten der modernen Welt hinter uns ließen, haben wir uns in einem Tagesmarsch Jahrhunderte von ihr entfernt.
Ein strahlender Bergmorgen. Nebel und Feuerrauch, gebündeltes Sonnenlicht und dunkle Klüfte, über Wolkenkissen schwebt ein Gipfel des Annapurna. Wir frühstücken im Teehaus neben piepsenden Küken und sind noch vor sieben Uhr wieder unterwegs.
Hinter dem Dorf kriecht ein Kind den Hügel empor, es zieht seine verkrümmten lahmen Beine hinter sich her. Das Gesicht nahe an den Steinen, dem Ziegendung und den schmutzigen Rinnsalen schiebt sich das kleine Mädchen wie eine Grille mit zerquetschten Hinterbeinen vorwärts. Wir bleiben stehen, beschämt über unsere kräftigen Schritte, und das Mädchen schaut mit klaren Augen ohne jeden Groll zu uns auf. Ihr Anblick berührt uns um so mehr, da das Kind hübsch ist. GS erklärt mit unbewegter Miene, daß bengalische Bettler oft ihren Kindern die Knie brechen, um den bedauernswerten Anblick für ihre Geschäfte zu nutzen: seine Art, die Erschütterung, die er empfindet, auszudrücken. Aber das Mädchen bettelt nicht, es ist nur ein Kind, das neugierig zu den großen weißhäutigen Fremden aufschaut. Ich würde dem Mädchen gern etwas schenken – ein neues 27Leben? –, schäme mich aber vor der Würde der Kleinen. So lächle ich denn, so freundlich ich kann, und sage: »Namas-te!«, »Guten Morgen!«. Wie absurd! Aber ihre zarte Stimme ruft uns freundlich nach, während wir weitergehen: »Namas-te!«, dieses alte sanskritische Gruß- und Abschiedswort mit der Bedeutung »Ich grüße dich!«
Diese Mahnung an das Leid dämpft unsere gute Laune. Ich denke an den Leichnam im Gurkha-Land, an den sterbenden Alten vor Pokhara, ich höre wieder den letzten Atemzug meiner Frau. Der Anblick solchen Leids hatte auch Shakyamuni bewogen, Lumbini zu verlassen und sich auf die Suche nach dem Geheimnis des Daseins zu begeben, dessen Ergründung den Menschen vom Samsara, den Leiden der Sinnenwelt, zu befreien vermag.
»Gräme dich nicht um mich, sondern trauere um jene, die zurückbleiben, gefesselt von Begierden, deren Frucht Leiden heißt … denn welche Zuversicht gäbe uns dieses Leben, wenn der Tod stets gegenwärtig ist? … Auch wenn ich aus Zuneigung zu meiner Familie zurückkehrte, würde uns am Ende doch der Tod scheiden. Die Lebewesen mit ihren Begegnungen und Abschieden gleichen Wolken, die sich sammeln und die der Wind wieder auseinandertreibt, oder den vom Baume gewehten Blättern. Was könnten wir unser eigen nennen in einem Zusammentreffen, das ein bloßer Traum ist …«[7]
Und doch kehrte Shakyamuni nach Hause in den Norden zurück, als er sich dem Tode nahe fühlte. (»Komm, Ananda, laß uns nach Kusinagara gehen.«) Vermutlich hatte er Heimweh wie wir alle.
Der Weg schlängelt sich um kleinere Anhöhen nach Westen und steigt dann steil zum Dorf an der Paßhöhe auf. Ein weißer Geier segelt im durchsonnten Dunst, darunter kommt Hochwald in Sicht, von dünnen Wasserfällen durchzogen. Durch das Dorf begleitet uns ein kleiner Junge mit seiner Trommel, er trägt ein flottes Hütchen, dazu ein kurzes Hemd mit Weste und darunter nichts weiter. Eines Tages werden dieser Junge und seine Freunde in den Wald dort gehen und ihn abholzen, der Regen wird die dünne Bodenschicht vom Steilhang waschen und in die Bäche 28spülen. Dieselbe Erde verstopft dann die Flußläufe in der Ebene, so daß die Monsunflut sich staut und das Land weithin überschwemmt. Mit der rasch anwachsenden Bevölkerungszahl, dem primitiven Stand des Ackerbaus und einer Landschaft, die zum größten Teil aus Fels und Steilhängen besteht, ist Nepal wie kein anderes Land vom Problem der Erosion betroffen. Und das Problem wird um so schlimmer, je mehr Wälder für Heizmaterial und für Anbauflächen gerodet werden. In Ostnepal, vor allem im Katmandu-Tal, ist Feuerholz zum Kochen (vom Heizen ganz zu schweigen) eine Kostbarkeit, die von den Bauern viele Kilometer weit auf dem Rücken herangeschleppt und in den Städten verkauft wird. Die Landbevölkerung wiederum kocht ihre Mahlzeiten auf getrocknetem Haustierdung und enthält dem Boden dadurch wertvollen Dünger vor, der ihn fruchtbar machen und das Wasser binden könnte. Ohne Waldhumus und Düngung verschlechtert sich der Boden immer mehr und zerfällt zu Staub, der von den Monsunfluten davongespült wird.
GS meint, in seiner Einstellung zum Naturschutz und zur Erhaltung der landschaftlichen Strukturen liege Asien um fünfzehn bis zwanzig Jahre hinter Ostafrika zurück, was fatale Folgen haben könnte. Das gesamte Gebiet von Westindien bis zur Türkei und ganz Nordafrika ist erst in geschichtlicher Zeit zur Wüste geworden. Doch nicht einmal ein Land wie Pakistan, das nur noch drei Prozent der ursprünglichen Waldfläche erhalten hat, trifft Vorkehrungen gegen die absehbare Katastrophe, obwohl man die übermäßig große Armee – selbstverständlich finanziert aufgrund militärischer wie industrieller Interessen der Vereinigten Staaten – ebenso gut im trostlosen Landesinneren zur Aufforstung einsetzen könnte.
Kiefern, Rhododendron, Berberitzen. Die terrassierten Berghänge hinab windet sich der felsige Pfad wie Quecksilber im Sonnenlicht, auch die Hütten haben Dächer aus silbrig glänzenden Steinplatten. Schließlich senkt sich der Pfad bis zur Sohle eines Kiefernwaldes, wo ein Weiler am Zusammenfluß des Modir mit einem seiner nördlichen Nebenflüsse liegt. Wie bei jeder Fußreise in Nepal geht es steil bergauf und bergab durch ein Labyrinth von Tälern. Der Abstieg beansprucht Beine und Füße 29besonders, staucht die Knie zusammen und drückt die Zehen in die Stiefelspitzen. Gyaltsen, unser jüngster Sherpa, hatte in Katmandu meine Bergstiefel zum Weiten zu einem Flickschuster gebracht. Die Stiefel kamen ungeweitet zurück, dafür waren sie an den Stellen, die ich Gyaltsen angedeutet hatte, mit hübschen runden Flecken aus hellem Leder besetzt. Die Flicken ließ ich dann zwar in Pokhara entfernen, aber auch hier hatte der Schuster keine Leisten zum Ausweiten, so daß die Stiefel nun eng sind wie zuvor, wegen der Nadeleinstiche aber nicht mehr wasserdicht.
Heute sind wir zehn Stunden marschiert, die ersten Blasen kündigen sich an. Gyaltsen, der meinen großen Rucksack trägt, ist irgendwo weit hinten, und da ich keine Segeltuchschuhe in dem kleinen Rucksack bei mir habe, ziehe ich die Stiefel aus und laufe barfuß weiter. Meine Füße sind noch vom Sommer her abgehärtet, und der Weg ist jetzt vom Regen aufgeweicht, denn wir sind wieder einmal in einer Niederung. Auf der Hut vor Steinen und Ästen habe ich den Blick auf den Boden gerichtet, und so entdecke ich einen kakaofarbenen Waldfrosch, die zarten, lavendelblauen Flügelblüten des Orchideenbaumes (Bauhinia), den noch warmen Fladen eines Büffels, der so aussieht, als habe ihn der Büffel in tiefer Gemütsruhe, vielleicht sogar Kontemplation abgesetzt.
Doch seit unserer Begegnung mit dem kriechenden kleinen Mädchen mißtraue ich dem Paradies. Am Ufer des Modir stoße ich meinen Fuß an eine scharfe Steinkante und im Dorf Gijan, wo wir unser Nachtquartier aufschlagen, müssen wir uns die Blutegel von der Haut lesen. Beim Abendessen glaubt GS Nässe in seinen Segeltuchschuhen zu spüren und sieht nach, sie sind voller Blut.
Es tröstet mich zu sehen, daß GS offenbar auch ein Sterblicher, den Gebrechen des gewöhnlichen Pilgers ausgesetzt ist. Ich bin schon ein begeisterter Wanderer, aber GS übertrifft mich bei weitem; müßte er sich nicht dem langsamen Trott der Träger anpassen, so würde ich mir an seiner Seite die Seele aus dem Leib rennen. GS hält seine kräftigen Beine für so wichtig für seine Arbeit in den Gebirgen der Welt, daß er weder Ski fährt noch eine der härteren Sportarten betreibt aus Furcht, die Beine könnten 30dabei Schaden leiden. Jetzt ziehe ich ihn wegen seiner blutigen Schuhe auf und zitiere den Brief eines Kurators am American Museum of Natural History in New York City (den dieser mir samt einigen Mausefallen, die ich GS aus Amerika mitbringen sollte, geschickt hatte): »Ich bin gespannt darauf zu hören, was Sie und George auf Ihrer Reise sehen, hören und erleben werden. Aber ich sollte Sie warnen, ein Freund, der sich von George zu einer Wandertour in Asien überreden ließ, kam zurück – oder besser gesagt, er kehrte um – mit blutgefüllten Stiefeln …«
»Der Junge hatte keine Kondition«, erwidert GS lakonisch.
Gestern haben wir einen langen Marsch von elf Stunden, bergauf und bergab, hinter uns gebracht, und heute ist der hagere kleine Träger, der auf dem Feigenblatt blies, verschwunden. Jang-bu, der Anführer der Sherpa, wirbt statt seiner in Gijan einen alten Magar namens Bimbahadur an, einen krummbeinigen Gurkha-Veteranen in viel zu weiten Shorts, der barfuß geht. (Jeder Nepalese, ob Hindu oder Buddhist, wird nach seinem Eintritt in die Armee »Gurkha« genannt. Die legendäre Geschichte der Gurkhas beginnt um 1769, als die Heere des Gurkha-Königs aus den zentral gelegenen Tälern in die benachbarten Stammeskönigtümer vordrangen und sie unterwarfen. Die Gurkhas gründeten einen Hindu-Staat, das heutige Nepal. Dann fielen sie nach Tibet ein, wurden aber von den Chinesen zurückgeworfen, die Tibet schon damals als zu China gehörig empfanden. Während des indischen Aufstandes in der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurden Gurkha-Truppen den britischen Rajas zu Hilfe geschickt, ihr Kukri, das rasiermesserscharfe Gurkha-Messer schwingend. Von da an unterhielten sowohl die Inder als auch die Briten eigene Gurkha-Regimenter.)
Auch unser Sherpaträger Tukten ist ein solcher Gurkhaveteran; er und Bimbahadur finden bald zueinander, da Tukten – vielleicht weil er sich als Träger verdingt hat oder aus anderen, uns noch nicht bekannten Gründen – von den jüngeren Sherpa auf Distanz gehalten wird. Tuktens Gesicht verrät sein Alter 31nicht, er könnte ebensogut fünfunddreißig wie dreiundfünfzig Jahre alt sein, während Jang-bu, Phu-Tsering, der Koch, und die beiden Gehilfen Gyaltsen und Dawa alle Anfang Zwanzig sind, Gyaltsen in seinen Kniehosen und hohen Turnschuhen sieht aus wie ein Schuljunge, und tatsächlich trägt er zerfledderte Schulbücher in seinem Gepäck mit sich.
Westlich von Gijan führt der Weg entlang einem Bergrücken zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man in vier tiefe Täler hinunterblickt. Wieder unten in einem Dorf, in dem Modir und Jare zusammenfließen, sitzt eine alte Frau hinter einem geschnitzten Fensterrahmen. Über den Modir spannt sich eine Holzbrücke mit Kettengeländer, die Brücke schwankt und ächzt über den grauen Fluten, die von den Gletschern des Annapurna herabfließen.
Durch Reisfelder folgt der Pfad den schmalen Deichen, die von menschlichen Füßen festgestampft und glattpoliert sind. Über den Bergen hängt Nebeldunst, die Hitze hier unten ist drückend. Der grüne Reis, die roten Hütten und roten Kleider der Frauen machen die Dunkelheit dieser Täler deutlich. Hin und wieder bricht ein krähender Hahn die Stille, eine Frau schimpft ihren Büffel aus, und einmal hallt das irre Lachen eines Wahnsinnigen zwischen den Bergen.
Sonnenstrahlen treffen auf Libellenflügel über einer Wiese, auf der schon Schatten liegt, eine Taube gurrt in ihrem Bergversteck. Der Machhapuchare kommt in Sicht, mit einem dichten Kranz von Federwolken um seine Spitze. (Im Gegensatz zu den anderen Gipfeln des Annapurna-Massivs ist der Machhapuchare unbestiegen, 1957 kehrte eine Bergsteigergruppe 15 Meter unterhalb der höchsten Stelle um, nicht weil er unbezwingbar wäre, sondern weil die Gurung ihn als heiligen Berg verehren und die nepalesische Regierung klugerweise das Betreten des Gipfels verboten hat.) Nicht lange danach liegt das ganze Annapurna-Massiv hoch und deutlich vor uns, der Blickwinkel verschiebt sich während des Tages langsam, während die Karawane nach Westen vorrückt. Der Westgipfel, Annapurna I, wurde 1950 als erster Achttausender von Menschen bezwungen.
Ohne Eile und ohne eigentliches Ziel komme ich mir auf dieser Expedition manchmal recht überflüssig vor – Gnaskor oder 32»von Ort zu Ort herumwandern«, so nennen die Tibeter die Pilgerschaft zu heiligen Stätten. GS bleibt zurück, um die Träger anzutreiben, die keine Gelegenheit zum Rasten auslassen; die Sherpa tun so, als wollten sie ihm helfen, obwohl sie wissen, daß die Träger nach Möglichkeit niemals länger als sieben Stunden gehen. Da sie keine Zelte haben, wissen sie zudem schon morgens beim Aufbruch, in welcher Hütte oder Höhle sie die folgende Nacht verbringen wollen. Auch GS ist sich dessen bewußt, aber die Jahreszeit ist gegen ihn, und er wird nicht eher Ruhe geben, ehe er im Land der Blauschafe und des Schneeleoparden angelangt ist. »Wenn ich erst einmal die ersten Beobachtungsergebnisse sammele«, hatte er zu mir in Katmandu gesagt, »kümmert mich alles andere nicht mehr; dann habe ich das Gefühl, meine Existenz zu rechtfertigen.« (Diese Zielstrebigkeit trägt viel zu seinem Ansehen bei; einmal hörte ich, wie ein Kollege ihn den »tüchtigsten Biologen, der heutzutage Feldforschung betreibt« nannte.) Auch die vielen Dörfer entsprechen nicht seinem Geschmack, für GS sind wir der Zivilisation noch viel zu nahe. »Je weniger Leute, desto besser«, bemerkt er öfter. Ursprünglich sollte unsere kleine Expedition bis Dhorpatan fliegen, eine Ansiedlung geflüchteter Tibeter westlich von hier, wo uns genügend Träger zur Verfügung gestanden hätten. Aber bis zur zweiten Oktoberwoche war keine freie Maschine zu bekommen, auch war das Wetter so unsicher, daß es uns besser schien, den Weg nach Dhorpatan zu Fuß zurückzulegen. Einmal knurrt GS, während er mich einholt: »Wir könnten in vier Tagen statt in acht oder neun in Dhorpatan sein, wenn wir nicht dauernd auf die verdammten Träger warten müßten.«
Er seufzt, denn er weiß wohl, daß nichts die Träger zu einem rascheren Tempo veranlassen könnte. »Wenn wir wenigstens schon dort oben in 2500 Meter Höhe wären, ich mag die klare Bergluft.« Ich sage nichts. Die Gangart der Träger ist mir gerade recht, um so mehr, als meine Stiefel sich immer härter und kleiner anfühlen. Auch ich mag klare Luft, aber für den Augenblick bin ich ganz zufrieden; bald genug werden wir in Eis und Kälte sein.
Ein Eichhörnchen mit glänzendem, nußfarbenen Fell beobachtet uns von seinem Hochsitz in einem Baumwollbaum (Bombax) voll großer roter Blüten. Dieser Verwandte des afrikanischen 33Baobab-Baumes ist oft der einzige wildwachsende Baum, den die Einheimischen stehen lassen, und er trägt zum Wildpark-Charakter dieser sanften südlichen Landschaft bei. Der schrille Laut einer einzelnen Zikade durchschneidet die Luft wie der grelle Ton eines Messers am Schleifstein, und doch auch fein, wie ein Glockenton, der die Spinnennetze in der Sonne vibrieren läßt. Wie gebannt lausche ich dem überirdischen Ton, der von überall gleichzeitig auf mich eindringt, als Tukten lächelnd an mir vorübergeht. Sein rätselhaftes Lächeln erinnert mich an Kasyapa, einen Jünger Buddhas. Als Shakyamuni nach einem Nachfolger unter seinen Jüngern suchte, hielt er eine einzelne Lotusblüte empor und schwieg. Kasyapa, der in dieser Geste das einheitliche Wesen allen Seins wahrnahm, lächelte.
In Kusma, einem großen Hindudorf am Kali Gandaki, sind wir auf etwa 1000 Meter Höhe an einen der tiefsten Punkte unserer Reise gelangt. Phu-Tsering kauft frische Gurken und Guava-Früchte als Vorrat ein. Kurz vor Mittag sind wir wieder unterwegs und ziehen am Ostufer nordwärts. Im ersten Dorf am Fluß steht ein kleiner Holztempel mit zwei steinernen Kühen, die mit roten Hibiskusblüten geschmückt sind, von der Tempelwand lächelt ein Steinkopf unergründlich auf uns herab. Über dem Dorf liegt das eintönige Quietschen einer alten Reismühle, Babys schaukeln in Weidenkörben unter den Fenstern. In der heiteren und zwanglosen Häuslichkeit dieser sonnigen Dörfer sind Sau und Ferkel, Kuh und Kalb, Mutter und Kind, Geiß und Kitz, Henne und Küken im gemeinsamen Pulsschlag vereint. Im Teehaus essen wir Papayas, hinterher baden wir in den tiefen Tümpeln eines Bergbaches, der sich schäumend über die hellen Felsen stürzt. Eine Weile stehe ich unter einem sonnendurchwärmten kleinen Wasserfall, während meine gewaschenen Kleider auf den Steinen in der Sonne trocknen.
Den übrigen Nachmittag folgt unser Trupp dem Lauf des Kali Gandaki, der sich von Tibet und Mustang herunter in die Ganges-Ebene ergießt. Da er sich zwischen den aufragenden, über 8000 Meter[8] hohen Massiven des Annapurna und Dhaulagiri hindurchzwängt, bildet das Tal des Kali Gandaki die tiefste Schlucht der Welt. Kali bedeutet »schwarzes Weib« oder »dunkle Frau«, 34und in der Tat herrscht zwischen den steilen Wänden, den grauen Fluten und dem schwarzen Felsgeröll eine unheimliche Finsternis. Die grausame Schwarze Kali, die alle Dinge verschlingende weibliche Verkörperung von Tod und Zeit, ist die Gefährtin Shivas, des Hindu-Gottes des Himalaja, Schöpfergott und Zerstörer zugleich; ihr schwarzes Antlitz über einem Halsband aus Menschenschädeln ist das Symbol dieses düsteren Flusses, der von versteckten Berggipfeln aus unermeßlichen Wolken des Nichtwissens herabgurgelt und die Reisenden mit Angst erfüllt, seit ihn der erste Mensch zu überqueren versuchte und von seinen Fluten mitgerissen wurde.
Über dem dumpfen Rauschen des Wassers erhebt sich klar der schrille Gesang einer entfernten Zikade. Windenblüten, ein einsamer Löwenzahn, Senna, Orchideen. Überraschend ist der Anblick eines purpurfarbenen Landkrebses, er erscheint mir wie ein Relikt aus jenen fernen Tagen, als der indische Subkontinent bei der Drift auf der Erdkruste im Norden mit der asiatischen Landmasse zusammenstieß und diese einst unter dem Meeresspiegel liegenden Felsmassen Zentimeter für Zentimeter in die Höhe trieben, bis sie über acht Kilometer hoch in den Himmel ragten. Die Schlucht des Kali Gandaki ist bekannt als eine Fundstelle der heiligen schwarzen Steine, Saligrams genannt, die spiralenförmige Fossilien einstiger Meeresschnecken enthalten. Die Auffaltung des Himalaja-Gebirges begann vor mehr als fünfzig Millionen Jahren im Eozän und dauert immer noch an. Während eines Erdbebens im Jahre 1959 stürzten ganze Berghänge in die Flüsse hinab und änderten den Lauf des großen Brahmaputra, der von Tibet her Nordostindien durchquert und sich mit dem Ganges kurz vor dem Delta am Bengalischen Golf vereint. Alle großen Flüsse Südasiens entspringen dem höchsten Land der Erde: der Indus, der seinen Lauf östlich vom Ganges beginnt, aber dann zum Arabischen Meer strömt, der Brahmaputra, der Mekong, der Yangtsekiang und sogar der gewaltige Gelbe Fluß, der sich durch ganz China hindurch ins Chinesische Meer wälzt. Da alle diese Flüsse aus dem Tibetischen Hochland kommen, sind sie viel älter als das Gebirge, und so hat der Kali Gandaki seine tiefe Schlucht in das aufsteigende Gebirgsmassiv geschnitten.
Bei Paniavas, wo ein Kuhkopf aus Messing den Dorfbrunnen 35schmückt, führt eine Brücke über den brausenden Fluß. In einem plötzlich einsetzenden Regenguß schlagen wir unser Lager am anderen Ufer auf. In der Dämmerung gehe ich unter den tropfenden Bäumen spazieren. Pahari-Kinder rufen mir von einem Hügel mit ihren Vogelstimmen Sätze aus dem englischen Schulbuch zu und lachen über meine Antworten:
Good-a morning!
What it is you-a name?
What time it is by you-a watch?
Where are you-a going?
Der Monsunregen dauerte die ganze Nacht an, morgens war es kühl und bewölkt. Flußaufwärts werden die Ansiedlungen am Gandaki seltener, seltener auch die Steinhütten, die dem Reisenden Unterkunft gewähren und mit dem Nordwind kommt das unbehagliche Gefühl in mir auf, daß wir in dieser herbstlichen Jahreszeit völlig dem Wind und dem Wetter ausgeliefert sind. Ein Fluß-Uferläufer wippt und huscht den Wasserlauf herab, von einem schwarzen Felsblock zum anderen, unterwegs zu den Bänken mit warmem Uferschlamm im Süden. Er ist ein eurasischer Verwandter unseres bunten Uferläufers; ich bin dem munteren Vogel vielerorts von Galway bis Neuguinea begegnet, das Wiedersehen heitert meine Stimmung ein wenig auf.
Unterhalb der Wolken zeigen sich die tiefer liegenden Hänge des gewaltigen, über 8100 Meter hohen Dhaulagiri, weiß vom Schneefall der vergangenen Nacht. Die Schneegrenze liegt weit unterhalb der Höhe der Pässe, die wir auf unserem Weg nach Dolpo übersteigen müssen. Der Weg, dem wir bisher gefolgt sind, geht über Jamoson und Mustang nordwärts. Ursprünglich wollten wir ihm bis Jamoson folgen und dann westwärts über Tscharka nach Dolpo hineinwandern. Aber es ist sehr schwierig, über Jamoson hinaus eine Reisegenehmigung zu bekommen, da die nepalesische Regierung bedacht ist, keinerlei Aufmerksamkeit auf die wilde Gegend an der Nordwestgrenze zu richten. Dolpo und Mustang waren vor den Gurkha-Kriegen am Ende 36des achtzehnten Jahrhunderts tibetische Königtümer, eine historische Tatsache, die den Chinesen Anlaß geben könnte, sich auch diese Gegend anzueignen. Außerdem dienen beide Regionen als Schlupfwinkel der sogenannten Khampas, wilder tibetischer Nomaden, die sich noch immer mit allen Kräften gegen die chinesische Okkupation wehren und sich nach ihren Überfällen in das unwegsame Gelände von Dolpo und Mustang zurückziehen. Schon zu Zeiten Marco Polos waren die Khampas berüchtigte Räuber, und nach allem, was man hört, haben sie diese Tradition bewahrt.[9] Auf unserer jetzigen Route, auf der wir uns Dolpo von Süden nähern, laufen wir weniger Gefahr, den Khampas in die Hände zu fallen und damit die Aufmerksamkeit auf Zustände zu lenken, die Nepal mit Rücksicht auf seinen übermächtigen Nachbarn möglichst ignoriert.
Eine Brücke führt hinüber zu dem Handelsflecken Beni, von wo aus ein anderer Handelsweg südlich am Dhaulagiri vorbei nach Westen führt. Sechs Tage lang wollen wir in dieser Richtung marschieren und dann um die westlichen Ausläufer des Dhaulagiri herum eine andere Route nach Norden einschlagen. Die Polizei in Beni Bazar ist mißtrauisch und aggressiv, unsere Einreisegenehmigung nach Dolpo ist offenbar so ungewöhnlich, daß man uns mit übertriebener Sorgfalt abfertigt. Schließlich aber erhalten wir unsere Papiere zurück und können unseren Weg fortsetzen, was wir so rasch wie möglich tun.
Der Pfad folgt nun dem Nordufer eines Nebenflusses des Magyandi. Die Talhänge sind hier viel zu steil für den Ackerbau, und in den armseligen Dörfern gibt es nicht einmal ein Teehaus. Es ist Oktober geworden, die Orchideen verblühen allmählich. Geisterhafte Wasserfälle jenseits des Flusses scheinen unmittelbar den Wolken zu entspringen, manchmal fallen sechs oder sieben gleichzeitig herab. Ein steinernes Mühlhaus überspannt eine Schlucht, durch die sich ein Sturzbach in den Fluß ergießt, aber nirgends ist eine Brücke hinüber, kein Zeichen von Leben, und falls ein Einsiedler darin haust, teilt er die Einsamkeit mit den Affen, die wie Wächter vor der stillen Wohnstätte hocken.
Ein Tibeter in Begleitung zweier Frauen überholt uns und lädt uns nach einem prüfenden Blick ein, mit ihm nach Dhorpatan zu gehen. GS und ich würden sein Angebot nur zu gern annehmen 37und in schnellerem Tempo weiterreisen, aber wir deuten nur resignierend zurück, wo unsere Träger wie üblich eine Wegstunde hinter uns zurückgeblieben sind.
Im strömenden Regen schlagen wir unser Lager am Flußufer bei Tatopani auf.
Irgendwann einmal hat ein Wanderer Weihnachtssterne und Oleander nach Tatopani gebracht. Ein Teehaus gibt es hier auch. Gegenüber dem Teehaus wächst auf einem Strohdach ein gelbblühender Kürbis, auf der lehmigen Fensterbank darunter liegen eine Flöte, ein Holzkamm und hellroter Pfeffer wie ein Stilleben komponiert. Kinder tollen unter dem Fenster, ein kleines Mädchen wechselt mit selbstverständlicher Gelassenheit sämtliche Kleidungsstücke. Mitten auf der schlammigen Straße hocken drei Buben Knie an Knie unter einem schwarzen Regenschirm und spielen Karten.
Später als sonst, bei leichtem Regen, brechen wir auf. Der Magyandi schwillt an, über den dahinschießenden Fluten des grauen Flusses ziehen Schwalben gegen Süden. Regenschauer kommen und gehen. Nachmittags erreichen wir Darbang, das größte Dorf in dieser Gegend. Die aus roten und weißen Lehmziegeln gebauten Häuser sind mit Schiefer gedeckt und haben geschnitzte Holzfenster.
Auf der Veranda des Schulhauses zünden Jang-bu und Phu-Tsering ein Feuer zum Trocknen der Schlafsäcke an, die von Dawa und Gyaltsen immer wieder gewendet werden. Wie immer besorgen die Sherpa ihre Arbeit heiter und sorgfältig, auch Tukten greift mit zu, obwohl so etwas nicht zu den Aufgaben des Trägers gehört und er nicht dafür bezahlt wird. Die Sherpa sind immer aufmerksam und hilfsbereit, aber sie sind nie aufdringlich und schon gar nicht unterwürfig; wenn man schon für eine Dienstleistung bezahlt wird, warum sie dann nicht so gut wie möglich verrichten? »Yes Sir, ich wasche den Schlamm sofort ab!« – »Das dort kann ich noch tragen, Sir.« GS bemerkt dazu: »Wenn irgend etwas passiert, kümmern sich die Sherpa zuerst um 38ihre Dienstherren.« Ihre Würde leidet dadurch keineswegs Abbruch, denn zu dienen ist für sie Selbstzweck; sie setzen sich für die Aufgabe ein und nicht für den Auftraggeber. Als Buddhisten wissen sie, daß es auf das Tun mehr ankommt als auf den Erfolg oder die Belohnung, daß auf diese selbstlose Weise zu dienen bedeutet, frei zu sein. Ihr Glauben an das Karma – das Prinzip von Ursache und Wirkung, das Buddhismus und Hinduismus gemeinsam ist (sich aber auch im Christentum findet, wie in dem Beispiel: »Wie du säst, so sollst du ernten« gezeigt wird) – verleiht ihnen Toleranz und Vorurteilslosigkeit, denn sie wissen, daß böse Taten auch ohne Vergeltung seitens des Opfers ihre Strafe erlangen. Der Großmut und die Offenheit der Sherpa, gewissermaßen eine Art fröhlicher Wehrlosigkeit, ist auch bei Naturvölkern keineswegs die Regel; ein ähnliches Verhalten habe ich sonst nur bei den Eskimos angetroffen. Und da einer Theorie zufolge die Urahnen der Tibeter und der amerikanischen Eingeborenen nomadisierende Mongolenstämme aus denselben Stammgebieten Nordasiens sein sollen, frage ich mich, ob ihre ähnliche Lebensauffassung nicht auch ein gemeinsames Erbteil aus ferner Vergangenheit ist.
Diese einfachen, ungeschulten Leute verfügen über die weise Gelassenheit der Mönche, ihr Wohlbefinden läßt sich nicht von ihrer Religion trennen. Und natürlich sind sie alle werdende Buddhas – so wie wir alle –, das lehren die Schriften des Mahayana-Buddhismus, die mehrere Jahrhunderte nach Shakyamunis Tod zusammengestellt wurden. Das Mahayana lehrt die gegenseitige Abhängigkeit aller Lebewesen und verheißt allen Menschen Erlösung, nicht nur denjenigen, die sich einer mönchischen Disziplin unterwerfen. Das Mahayana verlangt deshalb auch nicht den Verzicht auf ein gewöhnliches Alltagsleben (obwohl es voraussetzt, daß der Verzicht irgendwann ganz von selbst geleistet wird) und ist deshalb in jeglicher Hinsicht großzügiger als der Hinayana-Buddhismus von Ceylon und Südostasien, der sich eng an den frühen Buddhismus Shakyamunis anlehnt. Ähnlich den Überlieferungen des Juden- und Christentums, die sich im selben Zeitraum entwickelten, sagt das Mahayana, daß die geistige Entwicklung der Menschen beschränkt bleibt, die Gott nur zu ihrem eigenen Seelenheil suchen: »Hast du dein Sein auf 39das unendliche Leid der Menschheit eingestellt, o Erleuchtungsuchender?«[10] Daraus entwickelte sich das Ideal des Bodhisattva (Erleuchtungs-Wesen) als eines Menschen, der seinen Eingang in den ewigen Frieden des Nirwana aufschiebt und im Zustand des Samsara (Kreislauf der Wiedergeburten) verharrt, um andere Wesen zur Erleuchtung zu führen. Das Mahayana erfüllt dadurch die Sehnsucht des Menschen nach einem persönlichen Gott und Erlöser, der im frühen Buddhismus und im Hinayana fehlt. Das Mahayana ist auch die Grundlage des tantrischen Buddhismus im Himalaja, in Tibet und in Mittelasien, ebenso jener unorthodoxen Sekte, die sich in China entwickelte und über Korea und Japan ostwärts ausbreitete, und die nun auch in den Vereinigten Staaten Eingang gefunden hat.
Als Begründer des Chan-Buddhismus (in Japan Zen-Buddhismus) wird Bodhidharma verehrt, ein großer Lehrer in der Überlieferungslinie, die auf Shakyamuni zurückgeht, der 527 n. Chr. die Lehre aus Indien nach China brachte. Wohl auch unter dem Einfluß der Einfachheit der chinesischen Philosophie vom Tao (dem »Weg«) ermahnte der grimmig dreinschauende »blauäugige Mönch« oder »wandanstarrende Mönch« seine Anhänger, vom Sektengezänk, dem ausgeklügelten Schrifttum, dem wuchernden Bilderkult und vom priesterlichen Pomp der etablierten Religionen abzulassen und sich der tiefen Meditation zu widmen, die seinerzeit der Beginn des Buddha-Weges gewesen war. Von einer Überlieferungslinie großer Zen-Meister ausgehend, deren erster Patriarch in China Bodhidharma war, durchdrang die karge Klarheit des Zen-Buddhismus die gesamte Kunst und Kultur Ostasiens. Nach der Lehre des Zen ist das Haften selbst an den »goldenen Worten« des Buddha ein Hindernis für die Erlangung der höchsten Stufe der Erkenntnis; deshalb der Zen-Ausruf: »Töte den Buddha!« Das Universum selbst ist das Lehrbuch des Zen-Buddhismus, für den Religion nichts anderes ist als die Wahrnehmung des Unendlichen in jedem Augenblick.
Wie wunderbar, wie geheimnisvoll!
Ich sammele Feuerholz und hole Wasser.[11]
40
Vom Flußufer oberhalb von Darbang ertönt bedrohliches Donnern. Gesteinsbrocken prasseln herab, drei nasse Hunde, die sich im Schulhof herumtreiben, spitzen die Ohren. Ganze Felsen geraten ins Zittern und rutschen in den Fluß, der nach zwei heftigen Regentagen seinen Weg schäumend und rauschend durch die Schlucht bricht.
Der tagelange Regen geht uns auf die Nerven, auf meine besonders, denn er tropft in mein enges, zerschundenes Zelt. In einem kalten, durchweichten Schlafsack zusammengekrümmt, liege ich mitten in den Pfützen und beneide den Besitzer des blitzblauen Zeltes nebenan. Möglicherweise trugen diese dummen Gefühle dazu bei, unsere erste Auseinandersetzung am nächsten Morgen auszulösen, als GS leere Konservendosen und Papier in den Schulhof warf. Er rechtfertigte sich, die Leute hier seien scharf auf jede Art Behälter. Das stimmt, aber warum stellte er die Büchsen dann nicht auf die Mauer, anstatt sie in den Schmutz zu werfen, aus dem die Leute sie herausklauben müssen?
Auch unter der Oberfläche der stets beherrschten Art von GS blitzt bisweilen Zorn auf, so scheint mir, wenn er auch so wenig von sich spricht, daß man nur schwer in ihn hineinsehen kann. Im Grunde ist er ein Eigenbrötler; eine gewisse scheue Wärme kommt vor allem dann zum Vorschein, wenn er von Krähen und Schweinen redet. Voriges Jahr bat er mich in New York: »Vielleicht könntest du mir beibringen, wie man über Menschen schreibt, ich weiß nämlich nicht, wie ich das anstellen soll.« Derart offenherzige, seine Einsamkeit widerspiegelnde Bemerkungen versöhnen mich mit seinem düsteren Gemüt und seinem bei manchen Gelegenheiten mangelnden Augenmaß, einem Ausdruck seiner Arbeitswut. »Wenn Kay meine Notizen abtippt«, erzählt er, »und die Schreibmaschine ist plötzlich still, gehe ich manchmal zu ihr und frage, was los ist; dann wird sie ganz böse auf mich.« Er sagt oft: »Kay wird böse auf mich«, als müßte er sich ständig daran erinnern, daß seine Frau offenbar allen Grund dazu hat.
In der Serengeti war GS allseits beliebt und geachtet, er besitzt 41eine Menge etwas altmodischer Tugenden. Seine Mischung aus Vernunft, Strenge und Zuverlässigkeit ist auf einer Expedition wie der unseren nicht hoch genug einzuschätzen; wie vielen sogenannten Freunden kann man heute sein Leben bedingungslos anvertrauen?
Sobald der Regen ein wenig nachläßt, machen wir uns auf den Weg. Ein Mann kommt uns von Westen entgegen und warnt Phu-Tsering vor den Gefahren des Pfades. Phu-Tsering, der sonst nicht so leicht etwas ernst nimmt, murmelt: »Zwei Tage Regen – sehr schlecht« und macht eine gleitende Gebärde mit seiner braunen Hand. An mehreren Stellen ist der Saumpfad in den Fluß abgerutscht, ein paarmal liegt er unter Geröll verschüttet. Beim Überschreiten dieser Stellen schauen die Träger ängstlich durch die dräuenden Nebelschwaden zu den überhängenden Felswänden empor.
Der junge Tamang-Träger Pirim, der ein wenig Englisch radebrecht, sagt im Vorbeigehen zu mir: »Heute, morgen, Weg nix gut.« Und um mich von seiner Ernsthaftigkeit zu überzeugen, schwenkt er die schwere Traglast auf seinem Rücken hin und her und schielt unter seinem Stirnriemen zu mir empor; dann humpelt er weiter den steilen Pfad durch den Canyon hinauf. Nach GS gehen derartige Warnungen oft der Weigerung weiterzumarschieren oder der Forderung eines höheren Lohnes voraus. Aber später sieht er selbst die Gefährlichkeit der Lage ein und weist die Träger an, dichter beisammen zu bleiben: »Wenn uns einer dieser Burschen abrutscht, würden wir es erst abends bemerken.« Ein Stück weiter müssen wir uns einen Weg durchs Gebüsch bahnen, da ein ganzer Berghang in die Tiefe niedergegangen ist.
Hinter der Brücke über den Danga-Fluß müssen wir noch einen steilen, schlüpfrigen Aufstieg bewältigen, dann haben wir den schlimmsten Teil hinter uns. Ein nebelspeiender Tannenwald gleitet vorbei, auf dem Berghang gegenüber sehen wir durch aufreißende Wolken Wasserbänder, die auf ihrem Weg hinab in den Fluß ihre Farbe von Weiß zu Braun wechseln, indem sie immer mehr Erdreich mitreißen. An einer Wegkehre steht ein gespenstischer Schrein, bei dem die Hörner vieler geschlachteter Ziegen zu einer Art Altar aufgestapelt sind; die Äste der umstehenden 42Bäume sind mit roten Bändern geschmückt. Zu dieser Zeit opfert man hierzulande der Göttin Durga, einer dämonischen Gottheit aus archaischen Zeiten, die in den Jahrhunderten nach der Zeitwende in der Gestalt der Schwarzen Kali, dem weiblichen Aspekt des Gottes Shiva, wiedererstand und alles vom menschlichen Geist erdenkbare Grauen verkörpert.
Nur Vogelrufe und das Rauschen des Wassers brechen die Stille. Selbst im Regendämmer hat die Landschaft etwas Psychedelisches mit ihren Schluchten und Wasserfällen, den dunklen Kiefern und vorbeiziehenden Wolkenschwaden. In den Dörfern feuerrote, mit sonderbaren Blumen und bizarren Figuren bemalte Häuser, Reisfelder, in denen sich die Wolken spiegeln, auf den Terrassen der steilen Berghänge, und im windzerzausten Bambus ein Schwarm rotgestreifter Blutfasanen.
Wir stapfen weiter durch Schlamm, Finsternis und Kälte. In einem Bergdorf namens Sibang läßt man bei einer Zeremonie zu Ehren der Göttin Durga unter Trommelklängen einen Büffel ausbluten; das frische Blut wird sofort getrunken, die Kinder stehen wartend im Kreis herum. Wie üblich regnet es. Die Kinder haben dicke Bäuche, das typische Zeichen von Unterernährung. Sie sehen zwar nicht unzufriedener aus als die Kinder in den Tälern, aber sie sind stiller und singen uns keine Lieder entgegen. Unter den kleinen Bluttrinkern sehe ich eines der hübschesten Kindergesichter, die mir je begegnet sind.
Gegen Morgen wird der Regen heftiger. Die Wege sind unpassierbar geworden, so daß wir den Tag in diesem alten Kuhstall verbringen müssen. Der gute Dawa in seinen orangefarbenen Kniestrümpfen – ein großer kräftiger Bursche, wenn auch so schüchtern, daß er den Sahibs nicht in die Augen sehen kann – hat den Mist an eine Wand gekehrt und die tiefsten Pfützen auf dem Lehmboden mit Schrittsteinen überbrückt. Wir leben auf der Insel einer Zeltplane, die zwischen den Rinnsalen ausgelegt ist, und verbringen den größten Teil des dunklen Tages gegen die Wand gelehnt in unseren Schlafsäcken.
43
Seit einiger Zeit leben wir fast ausschließlich von Reis und Tschapatis (ungesäuerten Brotfladen), ergänzt durch Dhal (kleine Linsen), zerstoßenen Mais und Kartoffeln. In den Dörfern weiter unten am Fluß konnte man hin und wieder ein paar Guajaven, Papayas, Gurken oder Pisangfrüchte kaufen, hier oben, wo der Herbst schon weiter vorgerückt ist, sind keine mehr zu haben. Gestern kaufte Phu-Tsering ein paar silbrige Fische, die mit Weidenreusen in den Stromschnellen gefangen werden, sowie Fleisch vom Opferbüffel, mit dem auch wir Durga Puja feiern. Auch ein wenig Arrak oder Raki – beides weißlicher, aus Reis, Mais oder Hirse gebrannter Schnaps – findet sich. Ein alter einäugiger Träger tanzt zu den Klängen der Mundharmonika von Jang-bu, an dessen Fingern Ringe blitzen. Der Sherpaführer ist noch recht jungenhaft, er ist höchstens vierundzwanzig, fordert aber durch seine Intelligenz und seine Persönlichkeit den Respekt der anderen.
Uns beiden ist weniger nach Feiern zumute. GS hängt seinen eigenen Gedanken nach, ich denke an meine Kinder. Rue, Sara und Luke sind im Internat, nur Alex, der Jüngste, ist zu Hause. Als meine Reisepläne im vorigen Sommer Gestalt annahmen, lud GS ihn ein, nach Lahore mitzukommen, wo Kay Schaller ihn betreuen wollte und er mit den beiden Schallerbuben die amerikanische Schule hätte besuchen können. Da Alex erst acht ist, hielt ich es jedoch für besser, ihn zu Hause bei einer befreundeten Familie unterzubringen. Bis jetzt schien alles in Ordnung zu sein. Kurz vor unserem Aufbruch aus Katmandu erhielt ich den folgenden Brief von ihm:
Lieber Dad,
Wie geht es dir. Mir geht es gut. Ich war traurig und habe sogar geweint, weil ich dir so lange nicht geschrieben habe. Jetzt ist es besser, seit ich dir schreibe. Die Katze und der Hund sind schon groß und ich werde traurig sein, wenn sie sterben müssen. In der Schule geht es auch gut. Ich hoffe, du bist zu Thanksgiving wieder da. Habe ich das richtig geschrieben?
Ja ☐ Nein ☐.
Sind deine Bergstiefel noch gut. Ich wünsche dir alles Gute. In Liebe Alex
44
Bitte hebe meine Briefe auf und bring sie nach Hause zurück, damit ich weiß, ob du alle bekommen hast. Viele Millionen Küßchen
in Liebe
deine Sonne Alex 
Ich dachte an den Tag zurück, an dem ich von ihm Abschied genommen hatte. Es war gerade einen Monat her, an einem hellen Septembermorgen, Schmetterlinge gaukelten im Ostwind über den späten Rosen. Alex fragte, wie lange ich fortbleiben würde, und brach in Tränen aus, als er es erfuhr: »Das ist zu lang, viel zu lang!« Als ich ihn zur Schule fuhr, fürchtete er, man könne ihm ansehen, daß er geweint hatte. Ich umarmte ihn und versprach, noch vor dem Erntedankfest heimzukommen.
Bei Tagesanbruch ziehen wir los. Mit kurzen Unterbrechungen fällt leichter Regen den ganzen Vormittag. Eigentlich müßte der Monsun längst zu Ende sein.
Bei Muna verläßt der Pfad die Schlucht des Magyandi und führt mehrere Meilen auf einem Bergkamm hoch über dem Tal des Dara Khola entlang. In über 2000 Meter Höhe wandern wir durch Eichenwälder. Nirgends im Gebirge sind Anzeichen von Bewohnern oder Ackerbau erkennbar, GS ist in seinem Element. Wir halten Ausschau nach den Spuren von Waldtieren wie dem Asiatischen Schwarzbären (auch Kragenbär oder Mondbär genannt), dem Buntmarder oder dem hübschen roten Panda oder Katzenbären. In diesem wolkenverhangenen Wald könnte sich auch – wer weiß? – ein Yeti verstecken. Am Waldrand stehen Eschen und Stechpalmen, Berberitzen und Rhododendron, darunter Gänseblümchen und wilde Erdbeeren zwischen Moosen und Farnkraut, und hellila Astern, wie sie zu Hause jetzt in Wald und Feld blühen. Aus dem herbstlichen Wald tönt der Ruf eines Spechtes, Meisen zwitschern und erinnern mich mit ihren vertrauten Stimmchen wieder an meine Kinder.
In einem dunklen Hain moosbehangener Eichen schlagen wir 45in 3000 Meter Höhe unser nasses Lager auf. Durch die vom Wind zerzausten Baumwipfel beobachten wir, wie der Himmel sich aufklart. Bald steigt der Mond auf, es wird kalt.
Wie seltsam mir alles vorkommt, wie seltsam alles ist. Ein »Ich« betrachtet den Mann, der hier im Schlafsack mitten zwischen den asiatischen Bergen liegt; ein anderes »Ich« ist in Gedanken bei Alex, und das dritte ist der müde Mann selbst, der zu schlafen versucht.
In seinen ersten Lebensjahren stand mein Sohn oft im Sandkasten regungslos neben seinem Spielzeug und sah den Tauben und Rotstärlingen nach, die sich im Sommerwind wiegten. Die Blätter tanzten, Wolken segelten vorüber, Vögel zwitscherten, und über alldem verbreitete sich der süße Duft von Liguster und Rosen. Das Kind beobachtete seine Umgebung nicht, es ruhte im Mittelpunkt des Universums, eins mit allen Dingen, eines Endes oder Anfangs unbewußt – noch im Einklang mit dem Urgrund der Schöpfung ließ es alles Licht und alle Erscheinungen durch sich hindurchfließen. Ekstase bedeutet Einssein mit allem Sein, und ekstatisch waren auch die Bilder, die Alex malte. Wie einst bei dem Jäger von Aurignac, der zu dem Hirsch wurde, den er an die Höhlenwand malte, gab es kein »Selbst«, das sich zwischen ihn und den Vogel oder die Blume geschoben hätte. Die gleiche spontane Identität mit dem Objekt findet sich in den kühnen japanischen Sumi-Gemälden; sie sind ein Ausdruck der Zen-Kultur, denn Einszuwerden mit dem, was man gerade tut, bedeutet letztlich die Verwirklichung des »Weges«.
Unbegreiflicherweise halten wir es für unumgänglich, daß Überlebenswille und Todesangst uns vom Glück der reinen, unreflektierten Erfahrung trennen müssen, in der Körper, Geist und Natur eins sind. Wir lassen zu, daß unsere Erfahrung entwürdigt wird, und weichen vor dem Wunder zurück; wie Krebse verkriechen wir uns in Spalten, statt frei im Wasser zu schwimmen, verzweifelt darüber, daß unser Leben vorbeigeht, ohne daß wir es gelebt haben. Diese Verzweiflung widerspiegelt sich auch in den freudlosen Begierden der Menschheit, der Jagd nach dem vergänglichen Geld und der maßlosen Verschmutzung von Erde, Luft und Wasser, unserem Lebensraum.
Man vergleiche nur die spontane freie Zeichnung eines Kleinkindes 46mit den steif gemalten »Bildern« des größeren Kindes, das den Prozeß des Malens bewußt ausführt und nun die Wirklichkeit so wiederzugeben versucht, wie andere sie sehen; nun selbst-bewußt, tritt es aus seinem Gemälde heraus, findet sich von den Dingen getrennt, bemerkt die Stille um sich herum und erschrickt vor der Unendlichkeit der Schöpfung. Der Panzer des »Ich« beginnt sich zu bilden, die Konstruktion und verzweifelte Bestätigung einer abgetrennten Identität, die Einsamkeit: »Der Mensch schließt sich selber ein, bis er alles nur noch durch die engen Spalten seiner Höhlenwände betrachtet.«[12]
Alex, der Achtjährige, hat bereits die Unbefangenheit der Welt gegenüber verloren, so wie auch ich sie bereits in früher Kindheit verloren habe. Doch Erinnerungen an diese glückliche Zeit kommen immer wieder auf Flügeln des Lichts daher – ein glänzender Vogel, hohe Tannen in der Sonne, das Feuer in einem dahintreibenden Blatt, die herbstliche Wärme in modrigem Holz, ein Kind, ein Moospolster auf einem Stein – lichtdurchdrungene Unmittelbarkeit, die glänzt und atmet und doch so vergänglich ist, daß sie mich atemlos und voller Schmerz zurückläßt. 1945 hielt ich eines Nachts im schweren Sturm auf einem Marineschiff im Pazifik Bugwache; der Mann, der mich ablösen sollte, kam nicht, da er seekrank geworden war, und ich war acht Stunden lang allein in einem Malstrom von Wind, Wasser und klapperndem Eisen; immer wieder schlugen Brecher über das Deck, bis Wasser, Luft und Eisen verschmolzen und Eins wurden. Überwältigt und erschöpft waren plötzlich alle Gedanken und alle Gefühle aus mir herausgeschüttelt, ich verlor mein Ich-Gefühl, das Herz, das ich schlagen hörte, war das Herz des Universums, ich atmete mit der steigenden und fallenden Erde, und dieses Verlorensein in der Welt war nicht im mindesten beängstigend, sondern höchst aufregend. Hinterher hatte ich das Gefühl eines unbestimmten Schmerzes, als ob ich einen Verlust erlitten hätte; was habe ich bloß verloren, fragte ich mich, denn ich verstand nicht, was mir widerfahren war.
Viele Dichter kennen diesen Schmerz, und aus manchen Prosawerken sprangen mich unvermittelt sonderbare Gedanken an, wie ein Einhorn, das aus dem Dickicht bricht. Zu meinen frühen Entdeckungen gehört The Piper at the Gates of Dawn (Der Pfeifer 47am Tor der Finsternis)[13], ferner die singenden Fische in einer Erzählung von Hamsun, einiges von Borges und Thoreau, und vieles von Hesse, der ja kaum über andere Themen schrieb. Hamsuns Gestalten neigen zur Selbstzerstörung, und Hamsun und Hesse warnten mit der Erfahrung der Gescheiterten vor dem gefährlichen Zauber der mystischen Suche, desgleichen auch Kierkegaard, als er schrieb, daß zu viele »Möglichkeiten« einen ins Irrenhaus brächten. Als ich diese warnenden Worte las, war ich selbst schon angesteckt von dem, was Kierkegaard »die Krankheit der Unendlichkeit« nannte, und ich wechselte von einem Weg zum anderen über, ohne wirklich zu wissen, daß ich mich auf einer Suche befand, und mit kaum einer Ahnung von dem, was ich suchte. Ich spürte nur undeutlich, daß am Grund jedes Atemzuges eine Leere lag, die gefüllt werden mußte.
1948 führte mich ein Schüler des Mystikers und Philosophen George Gurdjieff in Paris in »die Arbeit« ein, in der wie bei vielen Schulungswegen großer Wert auf »Selbst-Besinnung« gelegt wird, darauf, sich des gegenwärtigen Augenblicks voll bewußt zu sein, anstatt in den unwirklichen Welten von Vergangenheit und Zukunft herumzuwandern. Nach meiner Rückkehr nach Amerika führte ich die Praxis dieser »Arbeit« fort, allerdings nicht für lange; Gurdjieffs Methoden erschienen mir bald zu esoterisch. Zwar war die innere Kraft einiger Führer dieser Bewegung offensichtlich, aber zu wenige von uns anderen schienen ihnen folgen zu können. So wandte ich mich dem Lesen wieder zu und begann zu schreiben; aus meinen ersten Büchern ist mein verwirrter Zustand deutlich herauszulesen.
1959 lernte ich im Dschungel von Peru die Wirkung von Yajé oder Ayahuasca kennen, einer Droge, die von den Schamanen der Amazonasstämme dazu benutzt wird, um Bewußtseinszustände hervorzurufen, die wir »übernatürlich« nennen, nicht, weil dadurch die Naturgesetze aufgehoben würden, sondern weil sie von den konventionellen Wissenschaften noch nicht erklärbar sind. (Die meisten Halluzinogene sind Derivate von Wildpflanzen – Pilzen, Kakteen, Windenarten und anderen –, die überall in der Welt zu kultischen Zwecken verwendet werden; auch der »Soma« der Antike ist wahrscheinlich aus einem Giftpilz der Gattung Amanita hergestellt worden.) Obwohl sie mich erschreckte, 48lehrte mich die Erfahrung, daß diese Chemikalien (Phenolalkaloide) zu einer anderen Art der Wahrnehmung führen können, und zwar ohne die langwierigen Mühen einer asketischen Schulung, sondern rasch und wirksam, wie im Fluge. Ich habe die Drogen nie als Heilspfad, geschweige denn als Grundlagen einer Lebensform angesehen. Dennoch nahm ich sie in den folgenden zehn Jahren regelmäßig – meist LSD, aber auch Mescalin und Psilocybin. Die immer etwas beängstigenden Trips waren oft wundervoll oder grotesk, hin und wieder geriet ich dabei in eine Verzückung, die ich in meiner Unwissenheit für ein religiöses Erlebnis hielt: Ich glaubte an meinen Zauberteppich und war bereit, so weit zu fliegen, wie er mich tragen wollte. In Thailand und Kambodscha lernte ich 1961 auf dem Weg zu einer Expedition in Neuguinea Heroin im Rohzustand kennen (es wurde mir als »Opium« verkauft). Während einer fürchterlichen Nacht in einem alten Hotel am Dschungelrand, von dem aus man auf die Ruinen von Angkor Wat blickte, stand ich Todesängste aus und war dem Tod wohl auch nicht fern. Nach dem ersten ekstatischen Flug befiel mich eine Lähmung, ich war außerstande, mich zu bewegen und konnte kaum atmen; auch wenn ich hätte rufen können, wäre mein Ruf ungehört geblieben, und ich fand mich mit dem Gedanken ab, in dem abgelegenen Zimmer unter dem träge kreisenden Ventilator sterben zu müssen. Als ich Monate später heimkehrte, war mein Respekt vor den Drogen gewachsen. Ich nahm an wissenschaftlichen Versuchen teil, die ein fortschrittlicher Psychiater zur Erprobung der Halluzinogene in der Therapie anstellte. Zu den Teilnehmern an diesen frühen und gewagten Experimenten gehörte auch ein Mädchen namens Deborah Love, die genau wie ich von einer unbestimmten Suche getrieben war.
Eine solche Suche mag mit einem Gefühl der Unruhe beginnen, als ob man ständig beobachtet würde. Man schaut sich um und findet nichts, obwohl man spürt, daß es eine Ursache für die tiefe Ruhelosigkeit geben muß und daß der Weg, nach dem man sucht, uns nicht an einen fremden Ort, sondern nach Hause bringt. (»Aber du bist ja zu Hause«, ruft die Hexe des Nordens. »Du brauchst bloß aufzuwachen!«) Der Weg jedoch ist mühsam, denn der geheime Ort, an dem wir uns schon immer befinden, ist 49von einem Dornengestrüpp von »Vorstellungen«, Ängsten und Rechtfertigungen, von Vorurteilen und Verdrängungen überwuchert. Der Heilige Gral entspricht dem, was die Zen-Buddhisten das innere »Wahre-Wesen« nennen; im Grunde ist jedermann sein eigener Erlöser.
Die Tatsache, daß so mancher, der seinen eigenen Weg geht, schließlich scheitert, bedeutet nichts … Er muß dem eigenen Gesetze gehorchen, als ob es ein Dämon wäre, der ihm etwas von neuen, seltsamen Pfaden einflüstert … Nicht wenigen aber geschieht es, daß sie von dieser Stimme wachgerufen werden, wodurch sie sofort von den anderen unterschieden sind und sich mit einem Problem konfrontiert sehen, von dem die anderen nichts wissen. Meist ist es unmöglich, den anderen zu erklären, was geschehen ist, denn die Verständnismöglichkeit ist durch undurchdringliche Vorurteile abgeschirmt. »Du bist nicht anders als alle anderen«, rufen sie im Chor, »so etwas gibt es nicht«, und selbst wenn es so etwas gibt, dann wird es sofort als »krankhaft« gebrandmarkt … So ist er denn plötzlich unterschieden und isoliert, denn er hat sich entschlossen, dem Gesetz zu gehorchen, das ihm aus seinem Inneren befiehlt. »Seinem eigenen Gesetze«, werden alle rufen. Doch er weiß es besser: es ist das Gesetz … Das einzig sinnvolle Leben ist ein Leben, welches nach der – absoluten und unabdingbaren – individuellen Verwirklichung seines ihm eigentümlichen Gesetzes strebt … In dem Maße, in dem ein Mensch dem Gesetz seines Seins untreu wird, hat er den Sinn seines Lebens verpaßt.
Die unentdeckte Ader in uns ist ein lebender Teil der Psyche; die klassische chinesische Philosophie nennt diesen inneren Weg das »Tao« und vergleicht es mit einem Wasserlauf, der unaufhaltsam auf sein Ziel zustrebt. Im Tao ruhen, ist Vollendung, Ganzheit, das Erreichen des Ziels, die Erfüllung der Aufgabe; es ist Anfang und Ende und die völlige Verwirklichung des allen Dingen innewohnenden letzten Sinns.[14]
Diese Abschnitte aus dem Werk von C. G. Jung waren der erste greifbare Hinweis auf die Herkunft meiner Unruhe. Als ich diese 50Zeilen las, saß ich in einem Garten in den Bergen Italiens; es war das erste und einzige Mal in meinem Leben, daß ich tatsächlich vor Begeisterung aufschrie und aus meinem Stuhl aufsprang: also war mein Suchen doch nicht krankhaft!
Deborah und ich betrachteten uns selber keineswegs als »Suchende«; peinlich berührt von derartigen Ausdrücken mieden wir vielmehr die Leute, die sie im Munde führten. Wir lasen, sprachen über das Gelesene und lasen nochmals, doch fehlte uns ein Lehrer und ein Schulungsweg. Die Eintags-Gurus sprossen zwar wie Pilze aus der Erde, aber ein wirklicher Lehrer war kaum zu finden. Schließlich bat Deborah, ich sollte sie mit den Halluzinogenen bekanntmachen, und in einer windigen, regnerischen Herbstnacht gab ich ihr zum ersten Mal Mescalin.
Auf ihrem ersten Drogentrip flippte Deborah aus; das ist der Ausdruck aus der Drogensprache und es gibt keinen besseren. Sie fing an zu lachen, ihr Mund öffnete sich weit und sie konnte ihn nicht mehr zumachen; ihr Panzer war aufgebrochen und alle nächtlichen Winde der Erde heulten durch sie hindurch. Als sie mich anschaute, sah sie das Fleisch von meinen Knochen schwinden, mein Kopf wurde zum Totenschädel – und so ging es die ganze Nacht hindurch. Später meinte sie jedoch, sich befreien zu können, indem sie die Todesangst auslebte, jene teuflische Wut über die eigene Hilflosigkeit, die die Drogenhalluzinationen darzustellen schienen, und dadurch die das Leben erstickende Anhäufung von Abwehrmaßnahmen aus dem Weg schaffte. Und Deborah nahm die eine große Gefahr der mystischen Suche an: es gibt keinen Weg zurück, ohne daß man dabei Schaden leidet. Es bieten sich viele Pfade an, aber wenn man einmal auf dem Weg ist, muß man ihn zu Ende gehen.
Deborah nahm ihren Mut zusammen und versuchte es wieder und wieder, manchmal mit mehr Erfolg. Ich erinnere mich an einen Nachmittag im April 1962, als wir beide LSD genommen hatten. Deborah kam von der Terrasse eines Landhauses und schwebte über den Rasen auf mich zu. Sie hatte schwarzes Haar und wunderschöne große Augen, vor den hellen Blüten im Frühlingswind sah sie wie verzaubert aus. Wir hatten uns in den Tagen zuvor gestritten und auch jetzt stiegen zunächst Groll und gegenseitige Vorwürfe auf, die ausgesprochen sein wollten. Doch als 51wir uns einander näherten, schwanden alle so oft zitierten Argumente dahin und versanken in unserem Schweigen. Wir brauchten keine Worte, jeder von uns wußte bis aufs letzte Wort, was der andere sagen wollte. Sprachlos vor Erstaunen über diese Telepathie, öffneten und schlossen wir unsere Münder im selben Augenblick und brachen dann über die Komik dieser Pantomime unserer vergangenen Auseinandersetzungen in Lachen aus; überglücklich umarmten wir uns und lachten, lachten. Und obwohl wir immer noch kein Wort sprachen, stellte sich später heraus, daß alle unsere Gedanken und Gefühle sowie unser Lachen nicht ähnlich, sondern völlig gleich gewesen waren, wir waren eine Seele, ein und derselbe Geist. Das ging so weit, daß, als wir uns in den Armen hielten, unsere beiden Körper zu jungen Bäumen wurden, die zu einem starken Stamm zusammenwuchsen, der eine Pfahlwurzel tiefer und tiefer in die Erde senkte.
Und doch … und doch … es blieb immer irgendwo ein »Ich«, bewußt, daß irgend etwas geschah, bewußt selbst dessen, daß irgend etwas durch die Drogen geschah. Und nie ging das Wunder so weit, dieses »Ich« auszulöschen.
Meist ging Deborah auf lange, düstere Reisen und wurde von Todesängsten geplagt. Auch ich hatte schlechte Trips, aber sie waren selten, die meisten waren ein magisches Theater, geheimnisvoll und faszinierend. Auch nach den schlechten Trips hatte ich das Gefühl, als hätte ich einen Teil der alten Last von Ärger und Mühsal abgeworfen. Seien sie angenehm oder beängstigend, die Drogen-Visionen können überaus erstaunlich sein; doch irgendwann beginnen sich die Eindrücke zu wiederholen, bis selbst das magische Theater langweilig wird. Zu dieser Erkenntnis kam ich in den späten 1960ern, als Deborah sich schon dem Zen-Buddhismus zugewandt hatte.
Nun liegen die psychedelischen Jahre weit hinter mir, ich vermisse sie nicht, bereue sie aber auch nicht. Drogen können die Vergangenheit auslöschen und die Gegenwart deutlicher erfahrbar machen, aber auf den Garten im Inneren können sie nur hinweisen. Da den Drogenvisionen die Disziplin einer asketischen Schulung fehlt, bleiben sie eine Art von Traum, der nicht ins Alltagsleben hinübergerettet werden kann. Sie können alte Nebelschleier zerreißen, das ist nicht zu bestreiten, dafür aber 52erzeugen die chemischen Wirkstoffe andere, neue Nebel, die ebenso wie die alten das »Ich« von der wahren Erkenntnis der Einheit abhalten.
Der aufdämmernde Tag legt einen kupferfarbenen Schimmer über das Farnkraut zwischen den Eichenstämmen. Während wir höher steigen, nimmt die graue Bartflechte den Platz der Farne ein. Bei einer Höhe über 3000 Meter hören auch die Eichenwälder auf, Wolken hüllen uns ein und schicken hie und da einen Regenschauer nieder.
Auf dem Jaljala-Kamm zeigt der Höhenmesser von GS 3420 Meter. Die dunklen Ausläufer von Annapurna und Dhaulagiri sind zu sehen, dazwischen als tiefer Schatten die Schlucht des Kali Gandaki. Alle Gipfel sind von dräuenden Wolkenfeldern verhüllt, gleich darunter breitet sich weiße Stille aus; die Schneegrenze liegt kaum mehr als 300 Meter über dem Bergkamm, auf dem wir stehen, und weit unterhalb der hohen Pässe, die wir noch übersteigen müssen. Wenn der Monsun nicht aufhört, solange es warm genug ist, daß der Neuschnee abtaut, werden wir in den nächsten Wochen Schwierigkeiten bekommen.
Wir ziehen westwärts über den Jaljala durch nasse Tundravegetation, in der purpurner Enzian und rosafarbenes Heidekraut blühen. Dann glänzen die ersten Sonnenstrahlen seit Tagen auf dem bunten Federkleid eines Wiedehopfes. Wie so viele Vögel hier am Fuß des Himalaja hat auch der Upupa Verwandte in der Vogelwelt Afrikas; den letzten Wiedehopf habe ich aber genau vor einem Monat in Italien, in den Umbrischen Bergen gesehen. Seiner goldenen Federhaube wegen verehrte man den Wiedehopf als »Sonnenvogel«, in der Mythologie der Sufis wird sein Brustfleck als Zeichen dafür gesehen, daß er den Weg zur wahren Erkenntnis gefunden hat:
Ich (der Wiedehopf) bin ein Bote der unsichtbaren Welt … Seit Jahren fliege ich über Meer und Land, über Berge und Täler … Wir haben einen wahren König, er wohnt hinter den 53Bergen … Er ist uns nahe, aber wir sind ihm fern. Der Ort, an dem er weilt, ist unzugänglich, keine Zunge vermag seinen Namen zu sprechen. Vor ihm hängen hunderttausend Schleier aus Licht und Dunkelheit … Glaube nicht, daß die Reise kurz sei, und man muß das Herz eines Löwen besitzen, um den ungewohnten Weg gehen zu können, denn er ist sehr lang … Man taumelt dahin voller Verwunderung, lachend manchmal und manchmal weinend …[15]
Der Eiskegel des Achttausenders Dhaulagiri taucht aus den Wolken auf und verschwindet bald wieder; obwohl weit entfernt, füllt er den gesamten Nordosten aus. Vor uns fällt ein mit gelben Ahornbäumen bewachsenes Tal sanft nach Westen ab, an einer Seite von einer Tannenwand, an der anderen von nacktem Fels gesäumt. Der auf der Talsohle glitzernde Wasserlauf hat drei Arten des hübschen asiatischen Rotschwänzchens (Phoenicurus) angelockt, sie sind der Nachtigall verwandt. »Heute fühle ich mich zum ersten Mal seit unserem Aufbruch in freier Natur«, sagt GS.
Die Wildnis dürfte bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein. Sobald sich das Tal weitet, werden erste Anzeichen von Kahlschlag und Brandrodung sichtbar. (»Feuer sehr schlimm, Sah«, sagt Tukten.) Die Zerstörung des Waldes hat zur Folge, daß ganze Hänge abgeglitten sind und den Fluß mit riesigen mitgerissenen Baumstämmen versperren. Das bräunliche Wasser wirbelt in Strudeln, weiter unten teilt Treibholz und verschlammtes Gestein den Fluß in einzelne Läufe. Es ist der Uttar Ganga (Nördlicher Fluß), der nach Westen in den Bheri und mit diesem zusammen zum großen Karnali fließt, der ihre Wasser dann nach Süden weiterführt.
Der von den Monsunregen überflutete Pfad verliert sich im Gewirr der Flußinseln, Tümpel und Nebenflüsse. Gelegentlich benutzen wir die angetriebenen Baumstämme als Stege, die GS langsam, aber immerhin aufrecht überschreitet. Ich bin nicht so sicher im Schritt, außerdem stört der Rucksack mein Gleichgewicht, so daß ich an kritischen Stellen, würdelos aber sicher, auf dem Hintern hinüberrutsche. Schließlich schneide ich mir einen kräftigen Stecken, etwa so lang wie ich groß bin, als Sonde und Balancierstange ab, später kann er mir als Wanderstab dienen.
54
Der Wald öffnet sich zu dem einzigen Flachtal dieser Gebirgsgegend, das von den Magar der südlicheren Gegenden als Sommerweide genutzt wird. Neuerdings entstand in der Gegend um Dhorpatan ein großes Lager der Tibeter, die seit 1950 vor den Chinesen über die Grenze flüchten. Sie züchten Pferde, bauen Kartoffeln an und unternehmen im Winter Reisen nach Pokhara und Katmandu, um ihren letzten Silber- und Türkisschmuck oder ihre Kultgegenstände zu verkaufen, oder auch nur, um mit ihren Landsleuten zusammenzukommen, denn die Tibeter sind als geborene Nomaden gern unterwegs.
In Tibet, wo man sich vor Räubern und Wölfen schützen muß, werden die Nomadenzelte und abgelegenen Dörfer von großen schwarzen oder scheckigen Doggen bewacht. Diese Art Hunde gibt es auch in Nepal. GS wurde vor einem Jahr von zwei Doggen angegriffen, die auf dem Pfad zurückgelassene Traglasten bewachten; nur knapp entkam er ihnen ohne ernstere Verletzungen. Die Doggen sind so bösartig, daß tibetische Reisende eigens ein Amulett tragen, auf dem ein tobender, in Ketten geschlagener Hund abgebildet ist. Die Kette wird von einem Dorje, dem mystischen »Donnerkeil«, zusammengehalten, und eine Inschrift sagt: »Das Maul des blauen Hundes ist im voraus zugebunden.«[16] Tagsüber liegen die Hunde an der Kette, nachts laufen sie frei herum und streifen als Warnposten und Wächter durch die Siedlung. Im ersten der Lager von Dhorpatan liefen wir lieber durch den ärgsten Schmutz in der Mitte der Straße, um den zähnefletschenden und knurrenden Biestern nicht zu nahe zu kommen. Plötzlich riß sich einer der Hunde los und stürzte ohne zu bellen hinter uns her.
Da GS ein paar Schritte vorging, wurde ich das Angriffsziel. Zum Glück hörte ich das Tier kommen. Ich wirbelte herum und konnte das Tier im letzten Moment mit einem kräftigen Schlag meines schweren Stockes abwehren. Das Vieh wich zurück und griff mit bösartigem Geknurr erneut an. Ich versuchte verzweifelt, ihm eins auf den Schädel zu hauen, während der Hund rasend vor Wut gerade außerhalb der Reichweite meines Steckens um mich herumsprang. Inzwischen hatte GS einen schweren Holzklotz gefunden und schleuderte ihn mit ganzer Kraft gegen den Hund, der sich wegduckte, ihm dann nachsprang und seine 55scharfen Zähne tief in den Holzklotz trieb. Jetzt erst kam ein Tibeter herbei und führte das Tier ab; er hatte in der Tür seiner Hütte in aller Ruhe abgewartet, wie ich wohl mit der Bestie zurechtkäme. Wie ich erfuhr, gibt es nördlich von Dhorpatan überall solche Hunde, so daß ich meinen Stock von jetzt an immer bei mir trug. Hätte ich ihn nicht vor einer Stunde abgeschnitten (nachdem ich acht Tage ohne Stock ausgekommen war), so hätte der Hund mich wohl ernsthaft verletzt. Bis zum heutigen Tag staune ich darüber, daß mir genau zum rechten Zeitpunkt eine Waffe in die Hände kam.
Dhorpatan hat weder einen Bazar noch eine Dorfmitte, die Hütten stehen gruppenweise verstreut entlang der Nordseite des Tales. Außer ein paar Magar, die den niederen Kasten angehören, sind die Einwohner tibetischer Herkunft. Buddhistische Gebetsfahnen flattern über jeder Hütte, und im Talgrund erheben sich große Haufen aufeinandergestapelter Gebetssteine.
Nach der Ankunft unserer Träger werden die Vorräte im kalten Hinterzimmer eines düsteren Lehmhauses verstaut, das sich gegen den Berghang lehnt. Auch wir werden hier schlafen und auf unsere Sachen aufpassen, denn wie überall in Flüchtlingslagern sind hier Diebstähle an der Tagesordnung. Jenseits des Flusses liegt ein Gemeinschaftsraum, in dem die Dorfbewohner ein und aus gehen. Weiter hinten, etwa in der Mitte des Hauses, steht ein einfacher Altar. Der Tag endet hier mit einem Gemurmel von om mani padme hum. Während sie das Mantra rezitiert, schiebt eine alte Frau mit einer Hand die dunklen Elfenbeinperlen einer Gebetskette weiter, mit der anderen wirbelt sie eine alte Gebetsmühle aus Kupfer und Silber herum. Auf der Gebetsmühle ist dasselbe Mantra eingraviert, das auch auf dem fest zusammengerollten Stück Papier im Inneren der Mühle geschrieben steht. So wird das Mantra mit jeder Umdrehung abgespult und das Universum wachgerufen:
om!
56
An diesem Morgen kehrt die Hälfte der Träger über den Jaljala-Kamm in ihre Heimat am Kali Gandaki zurück; die Tibeter, die wir an ihrer Stelle anwerben wollten, sind mit der Kartoffelernte beschäftigt. Verständlicherweise ist GS verärgert: warum haben ihn die Leute im Trekking-Büro in Katmandu nicht vor der Kartoffelernte gewarnt, sondern im Gegenteil versichert, er werde in Dhorpatan genügend Träger bekommen? Jang-bu kommt mit der Nachricht, heute sei kein einziger Träger aufzutreiben – »Vielleicht morgen«.
Die fünf jungen Tamang aus Katmandu sowie die Träger Tukten und Bimbahadur, der alte Magar, begleiten uns auch weiterhin. Die Tamang oder Lamas sind ein Bergvolk mongolischer Herkunft, sie wohnen in der Gegend des Trisuli-Flusses westlich von Katmandu. Zusammen mit den Gurung und Magar gehören die Tamang zu den Ureinwohnern Nepals. Ursprünglich hingen sie einer Form des alten Bön-Glaubens an, wenden sich aber mehr und mehr dem Buddhismus zu. In ihrer freundlichen, gefälligen Art ähneln die Tamang den Sherpa, mit denen sie sich gut verstehen. Pirim und sein Bruder Tulo Kansha, Karsung, Danbahadur und Ram Tarang sind hagere, barfüßige Burschen, die sich das Abenteuer einer Reise nicht durch die schwere Arbeit verderben lassen. Sie wollen uns begleiten, solange wir sie brauchen können, obwohl sie weder Stiefel noch warme Kleider besitzen und für die Schneeregionen schlecht ausgerüstet sind. Der alte Magar wollte sich zuerst mit den anderen Trägern verabschieden, aber Tukten überredete ihn zu bleiben, dieser Tukten mit seinem rätselhaften Lächeln.
Tukten hat die spitzen Ohren eines Elfen, einen dünnen Hals und eine gelbliche Gesichtsfarbe, dazu die durchdringenden weisen Augen eines Naldjorpa oder tibetischen Yogis. Er strahlt jene innere Ruhe aus, die häufig mit der Erlangung spiritueller Kräfte einhergeht, aber vielleicht sind es bei ihm auch schwarzmagische Kräfte. Jedenfalls fühlen sich die anderen Sherpa in seiner Nähe nicht wohl, sie murmeln vor sich hin, er trinke zuviel, gebrauche häßliche Wörter und ihm sei nicht zu trauen. Offenbar hat er sich durch die Tatsache, daß er Trägerarbeit leistet, in ihren Augen 57erniedrigt. Dennoch haben sie Respekt vor ihm, als ob er über Zauberkräfte verfüge, und manchmal glaube sogar ich, etwas von seiner Macht zu spüren.
Der nicht ganz geheure Bursche kommt mir irgendwie bekannt vor, wie eine dunkle Erinnerung aus einem früheren Leben. Tukten scheint sich der besonderen Beziehung ebenfalls bewußt zu sein, nimmt sie aber, im Gegensatz zu mir, als selbstverständlich hin, während mir der Gedanke, er sei nicht zufällig zu uns gestoßen, eher Unbehagen bereitet. Öfter als mir lieb ist, spüre ich seinen Blick auf mir, als sei er hier, um auf mich aufzupassen, als sei er es gewesen, der mich gestern dazu gebracht hätte, den Stock abzuschneiden. Sein Blick ist offen, ruhig, gutmütig und ohne Kritik irgendwelcher Art; und doch bringt er mir wie ein Spiegel, der mir vorgehalten wird, alle dunklen Flecken in meinem Inneren zu Bewußtsein, meinen Zorn, meine Gier und meine Unwissenheit.
Dankbar genieße ich den Ruhetag. Alles tut weh, mein Rücken, meine Knie und Füße, meine gesamte Ausrüstung ist durch und durch naß. Ich habe das letzte Paar trockene Socken so angezogen, daß das Loch in der Ferse oben auf dem Fuß sitzt; auch die Unterhosen sind aufgerissen und müssen umgekehrt getragen werden. Mein zerbrochenes Brillengestell ist mit Klebstreifen geflickt, meine Haare sind ein schmutziges Gewirr. Dawa bringt heißes Wasser, in dem ich mich und meine Wäsche wasche – wir beiden sind die einzigen Leute der Expedition, die gern baden –, dann ziehe ich die feuchten, aber sauberen Sachen wieder an und lasse mir von GS die langen Haare dicht am Kopf abschneiden. Seit Jahren trage ich ein Armband aus starker, geflochtener Kordel – zuerst, weil es ein Geschenk war, und später aus Sentimentalität. Auch dieses wird durchschnitten, und schließlich lege ich noch die Armbanduhr ab, da die Zeit, die sie anzeigt, alle Bedeutung verliert.
Den ganzen Tag über regnet es, Tibeter kommen zu Besuch. Immer wieder überrascht mich die Ähnlichkeit zwischen den amerikanischen Ureinwohnern und diesen Mongolenvölkern. Die meisten Tibeter in Dhorpatan sind ebenso kleinwüchsig, haben die gleichen kleinen Hände, Füße und Nasen wie unsere 58Eskimos, die Mongolenfalte der Augenlider, die dunkle Kupferhaut und das rabenschwarze Haar; sogar die rotverzierten Halbstiefel aus Häuten und Wolle ähneln in Form und Muster den Mukluks der Eskimos. Ihr Türkis- und Silberschmuck wiederum erinnert an den der Pueblo-Indianer und Navajos, während die Kordel- und Perlenverzierungen an der Kleidung und die gestreifte Wolldecke, die die Leute über den nackten Schultern tragen, alte Bilder der Präriestämme heraufbeschwören. Die verwahrlosten Behausungen und die streitsüchtigen Hunde verstärken den Eindruck noch. Die Leute benutzen auf Reisen Zelte aus Tierfellen, sie tragen ihre Kinder in einer Schlinge am Körper, auf dieselbe Art wie die Indianer, und ihre Grundnahrung ist ein Gerste- oder Maismehl, das Tsampa heißt. Man hat bisher keine echte Verwandtschaft zwischen den Sprachen der amerikanischen Indianer und asiatischen Sprachen festgestellt – allerdings heißt ein ähnliches Mehl bei den Algonkin-Indianern meiner Heimat »samp«.
Solche Übereinstimmungen beweisen zweifellos noch nichts, aber andere merkwürdige Gemeinsamkeiten zwischen diesen in Raum und Zeit so weit getrennten Kulturen geben dennoch zu denken. Die animistische Verwandtschaft mit der Umwelt, wie sie von den Gurung und den anderen Gebirgsstämmen dieser Gegend empfunden wird (auch wenn sie zu neueren Glaubensformen übergegangen sind), findet sich ebenso bei den Tschuktschen und den anderen Jagd- und Sammelvölkern Ostasiens wie auch, mit nur geringfügigen Unterschieden, bei vielen Eskimo- und Indianerstämmen. Der Große Donnervogel der nordamerikanischen Ureinwohner ist auch bei den Tungusen in den sibirischen Wäldern bekannt; Sonnensymbole, heilige Augen, die mit Garn umspannten Kreuze, Lebensbäume und Swastikazeichen, wie sie in allen esoterischen Religionen der alten Welt von Ägypten bis zum heutigen Tibet gebräuchlich sind, wurden auch in der neuen Welt bereits in so frühen Zeiten verwendet, daß die Mutmaßungen über den Zeitraum, in dem asiatische Nomadenvölker nach Nordamerika eingewandert sind, ins Wanken gerieten. (Überhaupt müssen derartige Zeitangaben immer wieder zurückdatiert werden und sind vielleicht sogar bedeutungslos, denn an klaren Tagen sind die Küsteninseln beider Nachbarkontinente 59in Sichtweite, und allen Anzeichen nach zogen ständig, auch nachdem die Beringstraße überflutet worden war, Einwanderer über Eis und Meer in beiden Richtungen.)
Wenn man einmal von den Theorien über versunkene Kontinente oder »kosmische Lehrmeister« – die ein Kapitel für sich sind – absieht[17] und die neuesten Spekulationen über die Seefahrten so atypischer Indianer wie der Inka ablehnt sowie übersieht, daß zwischen den Kulturen der vorarischen Drawiden und der Maya Ähnlichkeiten bestehen und daß es Hinweise darauf gibt, daß buddhistische Missionare vermutlich im vierzehnten Jahrhundert über die Aleuten eingewandert und bis nach Kalifornien vorgedrungen sind[18], so bleibt einem nur die schwierige Wahl, an die verblüffend gleichartige universale Manifestation archetypischer Symbole zu glauben oder aber an die Existenz und Überlieferung eines grundlegenden intuitiven Wissens, das älter ist als alle bekannten Religionen der Menschheitsgeschichte.
Die Überlieferung Asiens erzählt von einem verborgenen Königreich – Shambala, der Mittelpunkt –, das irgendwo in einer unbekannten Gegend Innerasiens liegen soll. (In diesem Zusammenhang wird oft die einst fruchtbare Gobi-Wüste, jetzt eine Fundstelle uralter Knochenreste, zitiert; als sich im Laufe der Austrocknung Mittelasiens große Seen in Trockenbecken und Wiesenlandschaften in Sandwüsten verwandelten, könnte von einer ehemals blühenden Stadt leicht nur noch eine Legende zurückgeblieben sein. Eine Zivilisation kann rasch vergehen: Der Klimawechsel, der die Flüsse und Savannen der Zentralsahara austrocknete, löschte auch die großen Hirtenkulturen von Fessan und Tassili um 2500 v. Chr. in wenigen Jahrhunderten aus.) Shambala ist jedoch wohl eher ein Symbol für die arischen Kulturen, die zwischen 6000 und 5000 v. Chr. in jener weitläufigen Region entstanden sind und von denen sich wahrscheinlich die esoterischen Mysterienkulte in Eurasien herleiten, deren Spuren sich noch heute im tantristischen Buddhismus Tibets finden. Ein tibetischer Lama sagte, diese Geheimnisse seien »das schwache Echo einer Lehre, die vor undenklichen Zeiten in Zentral- und Nordasien vorherrschte«.[19]
Ein anderer meinte, es habe »seit Urzeiten kein Volk gegeben, 60das nicht wenigstens einen Bruchteil dieser geheimen Lehre gekannt hätte«.[20] Diese Ansicht wird von Ethnologen gestützt[21], die nicht nur in Asien und Amerika, sondern auch in Afrika, Australien, Ozeanien und Europa dieselben Grundstrukturen der schamanistischen Praktiken festgestellt haben. Für die historische, möglicherweise auch die prähistorische Verbreitung derartiger Lehren spricht auch die überraschende Einheitlichkeit jener Praktiken, die von der westlichen, aller Geheimnisse verlustig gegangenen Welt halb geringschätzig, halb fasziniert als »Mystizismus« oder »das Okkulte« bezeichnet werden, die jedoch für jene Kulturen der Vergangenheit und Gegenwart, die sich weniger dem Ursprung entfremdet haben, nur einen anderen Aspekt der Wirklichkeit darstellen.
Die Überlieferungen der amerikanischen Ureinwohner sind östliche Lehren, Tausende von Kilometern und wohl auch Jahrtausende von ihrem Ursprung entfernt. Wer sich mit dem Gedankengut des Zen oder den Lehren des tibetischen Buddhismus befaßt hat, wundert sich nicht über die Einsichten, die vor einigen Jahren einem indianischen Zauberer der Yaqui-Indianer in Nordmexiko zugeschrieben wurden.[22] Was den Inhalt, die Vorstellungen und vor allem jene dunkle Ausdrucksweise betrifft, die das Unaussprechliche erfordert, so gibt es kein Wort in den Darlegungen des indianischen Schamanen, das nicht auch von einem Kargyütpa-Lama oder einem Zen-Roshi stammen könnte. Es ließen sich zahllose Parallelen zwischen den Traditionen der amerikanischen Ureinwohner und den Lehren des Ostens zitieren, etwa die Vorstellung der Azteken vom Dasein als einem Traumzustand, oder die Verehrung von Himmel und Wind, die die Ojibwa der nördlichen Präriegegenden mit den verschollenen Ariern der asiatischen Steppenländer teilten.[23]
Tibetische Orakelpriester und sibirische Schamanen verstehen sich auf die Praktiken der Traumreisen, Telepathie, mystischen Wärmeerzeugung, des Trance-Laufes, der Todesankündigungen und Seelenwanderung, die den Schamanen der neuen Welt allesamt bekannt sind: dem Medizinmann der Algonkin, der als Vogel in die Geisterwelt emporsteigt, oder den Jaguar-Priestern des Amazonasgebietes, die von den Kräften der Yogis und Naldjorpas sicherlich beeindruckt, aber kaum überrascht wären. Die 61Energie oder der Lebensatem, der von den Hindu-Yogis Prana und von den Chinesen Ch'i genannt wird, ist den Stammesangehörigen der Cree-Indianer unter dem Namen Orenda bekannt.[24] Vorstellungen wie die vom Karma oder dem zyklischen Verlauf der Zeit sind in der Überlieferung nahezu aller amerikanischen Ureinwohner selbstverständlich. Die Weltanschauung der Hopi kennt die Vorstellungen von der Zeit als Raum und des Todes als eines neuen Werdens; sie vermeiden alle linearen Vorstellungen, da sie genau wie die Buddhisten wissen, daß alles Hier und Jetzt ist. Wie bei den großen Religionen des Ostens gibt es auch für die Ureinwohner Amerikas keinen wesentlichen Unterschied zwischen religiösen und alltäglichen Handlungen: das Leben an sich ist eine religiöse Zeremonie.
Wie das »Atman« der Veden, das »Bewußtsein« des Buddhismus, das »Tao« des Laotse ist auch der »Große Geist« der Indianer unwandelbar und überall in allen Dingen enthalten. Sogar die Eingeborenen Australiens – die als älteste lebende Rasse der Erde gelten – unterscheiden zwischen der linearen Zeit und der »Großen Zeit« der Träume, Mythen und Heldentaten, in der alles und in diesem Augenblick gegenwärtig ist. Ein faszinierender Gedanke, daß die in den Uranfängen der Menschheit gewonnene Erkenntnis durch Worte und Taten über alle Grenzen und Jahrtausende hinweg bewahrt wurde, und daß sie die Traumwelt der primitiven Völker ebenso erhellte wie die frühen indoeuropäischen Zivilisationen, die Kulturen der Sumerer und Hethiter, der alten Ägypter und Griechen. Im Mittelalter des Christentums durch Geheimbünde bewahrt, liegt sie dem Mystizismus der Griechen, der Chassidim und der Moslems (Sufismus) ebenso zugrunde wie den großen Religionen des Ostens. Und sie ist ein tiefer Trost, vielleicht der einzige, für diese heimgesuchte Kreatur, die den größten Teil eines Lebens damit verbringt, auf ihren Hinterbeinen in Vergangenheit und Zukunft herumzuwandern, immer auf der Suche nach einem Sinn, nur um in den Augen ihrer Artgenossen zu sehen, daß sie sterben muß.
62
Ein Abgesandter des Dalai Lama kam vor kurzem den Weg von Tarakot im Norden nach Dhorpatan und berichtete, der Pfad sei »sehr schwierig, sehr steil und schlüpfrig, mit vielen Auf- und Abstiegen«. Da dies so ungefähr für alle Wege im Himalaja zutrifft, besonders bei Schneewetter, nehmen wir die Warnung nicht allzu ernst. Ein anderer Tibeter, der vor ein paar Tagen aus dem Norden gekommen ist, berichtet jedoch, daß der Schnee auf dem Jang-Paß nach Tarakot schon über kniehoch liege, und diese schlechte Nachricht wird es noch schwerer machen, neue Träger zu bekommen. Außerdem werden uns die Polizisten in Tarakot als launische und eigensinnige Leute beschrieben, die sich nicht um Dokumente und Genehmigungen ihrer Kollegen im fernen Katmandu scheren. Wir müssen damit rechnen, daß sie uns die Einreise nach Dolpo verweigern, obwohl unser »Trekking Permit« uns den Weg bis zum Phokumdo-See im Norden gestattet. Voriges Jahr hatte ein Anthropologe die Reiseerlaubnis bis Tarap in Dolpo bekommen, durfte aber seinen Weg über Tarakot hinaus nicht fortsetzen und saß schließlich den ganzen Winter in Tarakot fest, nachdem ein Schneesturm im Oktober den Jang-Paß unpassierbar gemacht hatte. Auch von solchen Schneestürmen zu hören, erfüllt uns mit Unbehagen, denn der zweite Paß zwischen Tarakot und Shey, den wir vor dem Wintereinbruch auf dem Hin- und Rückweg überqueren müssen, ist noch höher als der Jang-Paß.
Dhorpatan ist eine Art Fegefeuer. Der Kerkergeruch in dem kalten Gemäuer unserer Unterkunft, der gnadenlose Regen, der durchs Dach auf den lehmigen Fußboden tropft, das abscheuliche Gekläff der Hundekämpfe vor dem Fenster – vier in der letzten Nacht – vertiefen unsere Niedergeschlagenheit, die sich infolge all der Unheilsberichte über Hindernisse und Risiken, vereiste Flüsse und Schneefälle zwischen unserem Aufenthaltsort und unserem Ziel einstellt.
Gestern abend verwirrte mich der geheimnisvolle Gesang einer klaren tibetischen Jungenstimme, die mir seltsam bekannt vorkam, sie erinnerte mich an die traurigen Huainas der Quechua in den Anden. Dann schlief ich ein und träumte von meinem 63hübschen achtjährigen Sohn, dessen Mutter voriges Jahr an Krebs gestorben ist. In meinem Traum besuchte ich ihn in einem sonderbaren käfigartigen Raum, wo er mit anderen Jungen spielte. Lächelnd kam er mir entgegen, und wir streichelten zusammen einen kleinen Fuchs, der sich auch in dem Käfig befand. Dann war der Käfig ein Stall, in dessen Ecke sich eine struppige Schar elender Tiere drängte, und mir fiel auf, daß der kleine Fuchs vernachlässigt und schmutzbedeckt war. Verschreckt dreinschauend suchte er Zuflucht unter einer großen Henne, die sich vor allem um ihre eigenen Küken kümmerte. Als ich bemerkte, daß der kleine Fuchs Alex war, wachte ich vor Schreck auf.
Mein Versprechen, am Erntedankfest zu Hause zu sein, werde ich kaum halten können. Ursprünglich planten wir, um den 15. Oktober im Kristall-Kloster, Shey Gompa, einzutreffen. Die Aussicht schwindet zusehends dahin und damit auch die Hoffnung, vor Anfang Dezember heimzukommen.
Zudem ist es möglich, daß wir in Shey durch Schneestürme von der Welt abgeschnitten werden, auch für GS ein Alptraum, da auch er seiner Frau versprochen hat, daß er Weihnachten bei seiner Familie sein werde. Kay und die Kinder wollen ihn in Katmandu abholen. Obwohl er den unheilkündenden Berichten weniger Bedeutung beimißt, ist er ebenfalls verstimmt. »Wenn man allen Leuten in diesem Winkel der Welt glauben wollte«, sagte er, »könnte man gleich daheim bleiben.« In der Tat werden die Gefahren und Schwierigkeiten von der einheimischen Bevölkerung immer übertrieben als gute Ausrede, um höhere Löhne zu erpressen oder um sich vor der Arbeit zu drücken; die Wahrheit muß man stets selbst herausfinden.
Wir sind entschlossen, dieses halbzivilisierte Loch so bald wie möglich zu verlassen, damit wir über die Pässe kommen, solang dies überhaupt noch möglich ist. Auf seiner vorigen Expedition im letzten März konnte GS nur unzureichende Angaben über das Leben der Blauschafe sammeln; wenn er jetzt wegen des Schneefalls ihre Brunftzeit verpaßt, wird auch die zweite Expedition umsonst sein. Obwohl für ihn sehr viel auf dem Spiel steht, bleibt er bewundernswert gelassen, und trotz unseres ungemütlich engen und kalten Quartiers kommen wir gut miteinander aus.
64
GS hat alle eigenen Bücher ausgelesen (verschlungen, wie er sein letztes Stück Schokolade verschlingt; ich dagegen neige zur Sparsamkeit, immer der »Zukunft« mißtrauend). Nun liest er, weil es nichts anderes gibt, mein Bardo-thödol, das »Totenbuch der Tibeter«, und macht sich sogar Notizen darüber. Außerdem schreibt er Haiku, ausgesprochen geschickt und lebendig, und dieses Gedicht gefällt mir besser als meine eigenen:
Auf Wolkenpfaden gehe ich,
Allein mit den schwatzenden Trägern.
Dort, eine Krähe.
Morgens läßt der Regen nach und legt tagsüber größere Pausen ein, aber wir müssen uns noch einen weiteren Tag gedulden. Wenigstens wissen wir, daß bei solchem Wetter keine Flugzeuge in dieser Gegend fliegen. Hätten wir den Luftweg nach Dhorpatan gewählt, so säßen wir wohl noch immer in Katmandu fest. Unterdessen schreitet die Jahreszeit voran, die Schneefälle häufen sich und die neu angeworbenen Träger werden unruhig. Jang-bu, unser Sherpa-Führer, fürchtet, sie könnten es sich wieder anders überlegen, wenn der Regen noch einen Tag anhält. Unter den argwöhnischen Blicken von Phu-Tsering heben die Träger alle Körbe und Packlasten prüfend an, wobei er sie mit komischen Gesten nachmacht und dabei keinen Hehl daraus macht, daß er sie allesamt für Gauner und Langfinger hält. Phu-Tsering hat GS auf seiner ersten Expedition zu den Blauschafen begleitet, und es war eher seine stets gute Laune als seine Kochkünste, die ihn auch für dieses Unternehmen empfahl.
Unsere Mutmaßungen über das Kristall-Kloster führen unweigerlich zu Gesprächen über den Buddhismus und das Zen. Um GS auf meine nichtwissenschaftlichen Anschauungen vorzubereiten, hatte ich ihm voriges Jahr das Buch mit dem Titel Zen-Geist, Anfänger-Geist geschickt. Höflich hatte er geantwortet: »Vielen Dank für das Zen-Buch. Bisher habe ich nur ein wenig darin geblättert. Vieles scheint recht vernünftig, anderes weniger, aber ich muß mir diese Dinge noch eine Weile durch den Kopf 65gehen lassen.« GS glaubte nicht, daß ein abendländischer Geist die nichtlineare Sichtweise des Ostens nachvollziehen kann. Mit vielen anderen teilt er die Ansicht, das östliche Gedankengut flüchte vor der »Realität« und lasse deshalb den Mut zum Leben vermissen. Aber es ist gerade der Mut zum Da-Sein, hier und jetzt und nirgendwo anders, was der Zen-Buddhismus letzten Endes fordert: wenn du ißt, dann iß, wenn du schläfst, dann schlafe! Die Zen-Lehre hat nichts mit Mystizismus, geschweige denn mit Okkultismus zu schaffen, obwohl ihre Betonung der Vorrangigkeit der inneren Erfahrung der »Erleuchtung« (Kensho oder Satori genannt) das Zen von anderen Religionen und Philosophien unterscheidet.
Ich erwähne GS gegenüber christliche Mystiker wie Meister Eckhart, den heiligen Franziskus, den heiligen Augustinus und die heilige Katharina von Siena, die drei Jahre in schweigender Meditation zubrachte: »Der ganze Weg zum Himmelreich ist schon das Himmelreich«, sagte die heilige Katharina, und das entspricht genau dem Geist des Zen, das die Göttlichkeit nicht über die einfachen Wunder des Alltags erhebt. GS hält dem entgegen, diese Leute hätten zu Zeiten gelebt, in denen das Wesen des westlichen Denkens noch nicht durch die wissenschaftliche Revolution grundlegend verändert worden war. Damit hat er natürlich recht; ebenso wahr ist aber, daß die Wissenschaftler des Westens sich in jüngster Zeit mit steigendem Interesse und Respekt den intuitiven Lehren des Ostens zuwenden. Einstein beispielsweise gab wiederholt seinen Bedenken über die Beschränktheit des linearen Denkens Ausdruck und erklärte, alle Lehrgebäude, die lediglich aufgrund logischer Folgerungen zustande gekommen seien, entbehrten jeglicher Realität, selbst wenn man den Begriff der »Realität« genau definieren könnte; in seinem Denken sei immer die Intuition entscheidend gewesen. In der Relativitätstheorie gibt es manche Parallele zur buddhistischen Vorstellung von der Einheit von Zeit und Raum, die, wie die hinduistische Kosmologie, auf den uralten Lehren der Veden fußt. Einstein bemerkte einmal, man könne seine Theorie mühelos den Indianern der Uto-Aztekischen Sprachgruppe erklären, zu der unter anderem die Pueblo und die Hopi gehören. (Die Hopi sagen nicht »es blitzt«, sondern lediglich »blitz« ohne Subjekt 66oder Zeitangabe, die Zeit ist nicht in Bewegung, denn sie ist auch der Raum. Beide Begriffe sind untrennbar, es gibt weder Wörter noch Vorstellungen in ihrer Sprache, durch die Zeit und Raum als voneinander getrennt beschrieben werden. Dies kommt dem »Feld«-Begriff der modernen Physik sehr nahe. Auch eine Zukunftsform gibt es nicht, denn die Zukunft ist als Möglichkeit oder »Sich-Manifestierendes« bereits in der Gegenwart enthalten. Was in den Sprachen des Abendlandes Zeitunterschiede sind, ist in der Hopi-Sprache ein Unterschied in der Ausprägung der »Gegebenheit«.[25])
Die Wissenschaft schreitet heute fort in Richtung auf Theorien der fundamentalen Einheit und der kosmischen Symmetrie (wie der einheitlichen Feldtheorie). Unterscheiden sich derartige Theorien denn noch von jener Einheit, die Plato »unaussprechlich« und »unbeschreiblich« nannte, dem Ganzheitsbewußtsein, das so viele Völker der Welt, auch die christlichen, besaßen, ehe die vordringende industrielle Revolution die Völker des Westens zu einer neuen Art Barbarei verdammte? Noch bevor die Spiritualisten in den Vereinigten Staaten am Ende des vorigen Jahrhunderts törichterweise den Mystizismus mit dem Okkultismus vermischten und dadurch beide Denkweisen abwerteten, schrieb William James sein metaphysisches Meisterwerk; Emerson kündete von »dem Schweigen der Weisheit und der vollkommenen Schönheit, die allen Dingen bis in ihren kleinsten Partikeln innewohnt, vom Ewig-Einen …«; Melville sprach von dem »tiefen Schweigen, der einzigen Stimme Gottes«; Walt Whitman verriet das uralte Geheimnis, »kein Gott könnte göttlicher sein als der Mensch selbst«. Aber schon bald wurden diese klaren und feinsinnigen Einsichten, die dem Leben Größe verliehen und im Tode Frieden schenkten, vom grellen Schein der Technologie überstrahlt. Doch ihr Licht ist stets vorhanden, wie das der Sterne in der Mittagssonne, der Mensch muß es nur wiederentdecken, wenn er seine Angst vor der Sinnlosigkeit überwinden will, denn keine Art »Fortschritt« kann es ersetzen. Wir haben uns selber ausgetrickst wie gierige Affen und jetzt hocken wir da mit unserer Angst.
Noch vor nicht allzulanger Zeit wurde im Abendland darüber diskutiert, ob die Sonne oder die Erde im Mittelpunkt des Universums 67stehe. Noch in unserem Jahrhundert glaubte man, es gäbe nur eine einzige Galaxie, die unsere, während asiatische Philosophen lang vor Beginn unserer Zeitrechnung intuitiv erkannt hatten, daß die Zahl der Galaxien in die Milliarden geht und daß die kosmischen Zeiträume jedes Vorstellungsvermögen überschreiten: ein Tag ihres Schöpfers dauerte über vier Milliarden Jahre und seine Nacht war gleich lang, und doch war dies nicht mehr als »ein Augenzwinkern des unwandelbaren, unsterblichen, anfanglosen Gottes, des Herrn des Weltalls«.
Das Rigveda schildert ein pulsierendes Universum, das sich von einem Mittelpunkt her ausdehnt, was genau der Theorie des »Big Bang« (Urknall) entspricht, die erst im letzten Jahrzehnt von der Mehrzahl der Astronomen anerkannt wurde. Laut einem indischen Mythos wurde der »Feuernebel« vom Schöpfer wie Milch in einem riesigen Butterfaß gequirlt, bis sich daraus einzelne Sterne und Planeten absonderten: im wesentlichen also die Urnebel-Theorie der modernen Astronomie, wobei man unter »Feuernebel« allerdings den Nebel aus Wasserstoffatomen verstehen muß, aus denen, wie man annimmt, sich alle übrige Materie aufgebaut hat.
»Es gibt nichts außer den Atomen und der Leere«, schrieb Demokrit. Und es ist die Leere, auf die sich alle östlichen Lehren beziehen; sie ist nicht etwa ein »Nichts« oder die Abwesenheit von »Etwas«, sondern das Ungeschaffene, das aller Schöpfung vorausgeht, das anfanglose Potential aller Dinge.
Es gibt ein Ding, das ist unterschiedslos vollendet.
Bevor der Himmel und die Erde waren, ist es schon da,
so still, so einsam.
Allein steht es und ändert sich nicht.
Im Kreis läuft es und gefährdet sich nicht.
Man kann es nennen die Mutter der Welt.
Ich weiß nicht seinen Namen.
Ich bezeichne es als Tao.[26]
Es herrschte Dunkelheit, gehüllt in noch tieferes Dunkel … Das Uranfängliche war überdeckt von Leere. Jenes Eine … wurde durch die Kraft der Hitze freigesetzt aus seiner Abgeschiedenheit … 68Wo diese Schöpfung herrührt, Er, der sie aus höchsten Himmeln gebot, Er weiß es oder Er weiß es nicht.[27]
Die mystische Sichtweise (mystisch erscheint sie uns nur, wenn wir die Wirklichkeit auf das von den Sinnen und vom Verstand Erfaßbare einschränken) war und ist zu allen Zeiten und überall auf der Welt, in Ost wie West, überraschend einheitlich, eine Tatsache, die der modernen Wissenschaft keineswegs entgangen ist. Der Physiker versucht, die Wirklichkeit zu verstehen, während der Mystiker dazu geschult ist, sie unmittelbar zu erfahren. Beide Richtungen sind sich darin einig, daß die Sozialisierungsmechanismen einer Gesellschaft, die nichts als das »Greifbare« gelten läßt, die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit in hohem Maße einschränken; es entsteht ein sehr eng eingegrenztes Bild des Daseins, das zweifellos über das physikalisch Beweisbare hinausgeht. Auch stimmten beide Gruppen darin überein, daß Erscheinungsformen illusionär sind. Ein großer Physiker hat diese Einsicht so formuliert: »Die moderne Wissenschaft unterteilt die Welt … nicht in Gruppen unterschiedlicher Objekte sondern unterschiedlicher Zusammenhänge … Die Welt erscheint folglich als ein kompliziertes Gewebe aus Ereignissen, in dem sich Zusammenhänge unterschiedlicher Art abwechseln, sich überlagern oder sich ergänzen, und so die Struktur des Ganzen bestimmen.«[28] Alle Phänomene sind Prozesse und Zusammenhänge, alles fließt, und manchmal wird dieser Fluß tatsächlich sichtbar: man braucht nur seinen Geist in der Meditation zu öffnen oder die Schranken der Wahrnehmung durch Drogen oder im Traum niederzureißen, um zu sehen, daß nichts wirklich abgegrenzt ist und daß in der endlosen gegenseitigen Durchdringung aller Dinge im Universum eine kosmische Energie im Innersten von Stahl und Stein ebenso gegenwärtig ist wie in Fleisch und Blut.
Nur wenige Physiker haben der uralten Intuition widersprochen, daß alle Materie, jede »Wirklichkeit« aus Energie besteht und daß alle Phänomene einschließlich der Zeit und des Raumes nur Manifestationen des Geistes sind, seit die Relativitäts-Theorie erstmals die Getrenntheit von Energie und Materie in Frage stellte. Die meisten Wissenschaftler würden heute jener alten Hinduweisheit zustimmen, daß nichts wirklich existiert und auch 69nichts zerstört werden kann, da die Dinge lediglich ihre Form und Gestalt ändern, und daß die Materie im Grunde keinen stofflichen Charakter besitzt, sondern nur eine zeitweilige Verdichtung der überall vorhandenen Energie ist, jener Energie, die auch das Elektron hervorbringt. Was sind diese unendlich kleinen »Nicht-Dinge« im Vergleich zu einem Staubkorn und ein Staubkorn gegen den Erdball? »Wissen wir wirklich, was Elektrizität ist? Trotz unserer Kenntnis der Gesetze, nach denen Elektrizität wirkt und unserer Fähigkeit, hiervon Gebrauch zu machen, wissen wir nichts über den Ursprung oder die wirkliche Natur dieser Kraft, die sich schließlich als Quelle allen Lebens, allen Lichtes und allen Bewußtseins herausstellen mag: als der göttliche Atem, der alles durchdringt und bewegt.«[29]
Die kosmische Strahlung, von der man annimmt, daß sie ihren Ursprung in der Schöpfungsexplosion des Weltalls hat, trifft mit gleicher Stärke aus allen Richtungen auf die Erde auf; also müßte sich die Erde entweder im Mittelpunkt des Universums befinden, wie wir früher in aller Unschuld glaubten, oder aber das bekannte Universum besitzt keinen Mittelpunkt. Für den Mystiker liegt nichts Erschreckendes in dieser Vorstellung, in der mystischen Schau sind das Weltall, sein Ursprung und sein Mittelpunkt eins, und dieses Eine ist alles um uns und alles in uns, sind wir selbst.
Ich bin überall und in allem; ich bin die Sonne und die Sterne. Ich bin Zeit und Raum, und ich bin Er. Wenn ich überall bin, wohin soll ich gehen? Wenn es weder Vergangenheit noch Zukunft gibt und ich ewiges Sein bin, wo ist dann die Zeit?[30]
Im Buche Hiob fragt der Herr: »Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sprich, wenn du wahre Erkenntnis besitzt! Wer legte ihren Eckstein, als die Morgensterne miteinander sangen und jauchzten alle Kinder Gottes?«
»Ich war dort« – lautet wohl die richtige Antwort auf Gottes Frage. Denn wie auch das Universum entstanden ist, die meisten Atome in dem vergänglichen Gebilde, das wir unseren Körper nennen, existieren von Beginn an. Was der Buddha erkannte, war sein Einssein mit dem Universum; die Existenz auf diese Weise zu erfahren, heißt, der Buddha zu sein. Auch das strahlende »weiße Licht«, das so oft mit mystischen Erlebnissen einhergeht 70(von den Eskimo-Schamanen wird es das »innere Licht« genannt), kann man als eine Urerinnerung an die Schöpfung deuten. »Der Mensch ist die Materie des Kosmos, die sich selbst betrachtet«, meint ein moderner Astronom,[31] und ein anderer weist darauf hin, daß wir mit jedem Atemzug Hunderttausende derselben unveränderten Argon-Atome einatmen, die der Buddha zu Lebzeiten ausgeatmet hat und die »Teil hatten an allem Schnauben, Seufzen, Klagen und Schreien«[32] aller Geschöpfe, die je gelebt haben, heute leben und einst leben werden. Die Atome fluten hin und her in den zwar nützlichen, aber künstlichen Konstrukten von Zeit und Raum, in den gleichen Rhythmen des Weltalls, dem kosmischen Atem, wie die Gezeiten und der Lauf der Gestirne, und sie vereinen Tote und Lebende in der Manifestation der Energie, die das ganze Universum belebt. Unwandelbar und unsterblich kann nie der individuelle Körper-Geist sein, sondern nur jener Geist, der allem Seienden innewohnt, jene Stille, der Ursprung, der nie vergeht, weil er nie wird, sondern immer nur ist. Diese in den hinduistischen und buddhistischen Religionen enthaltene Lehre geht zurück auf den Begriff der Maya, wie er schon in den Veden formuliert wurde und sehr wohl aus noch älteren Kulturen stammen mag. Maya ist die Zeit, die Illusion des Ego, der Stoff, aus dem das individuelle Dasein ist, der Traum, der uns von unverfälschter Wahrnehmung der Ganzheit abhält. Die Maya wird oft mit einem versiegelten Glas verglichen, das die Luft in seinem Inneren von der freien Außenluft oder Wasser von dem allumfassenden Meer abschließt. Aber das Gefäß ist nichts anderes als das Meer selbst, und man muß es nur zerschlagen oder auflösen, um die Wiedervereinigung mit dem universalen Leben herbeizuführen, die alle Mystiker suchen, die ersehnte »Heimkehr«, die Rückkehr ins verlorene Paradies unseres »Wahren-Wesens«.
Die heutige Wissenschaft lehrt, was die Veden der Menschheit seit dreitausend Jahren offenbaren: daß wir das Universum nicht so sehen, wie es ist. Was wir sehen, ist nur Maya, Illusion, das magische Theater der Natur, eine kollektive Halluzination jenes Teiles unseres Bewußtseins, den wir mit unseresgleichen gemeinsam haben und der den gemeinsamen Nenner und die Kontinuität unserer Lebenserfahrungen bildet. Nach der Lehre des Buddhismus 71(im Gegensatz zum Hinduismus) existiert diese Welt der Sinneswahrnehmungen, diese zwar nicht absolute, aber relative Wirklichkeit, dieser Traum ebenso wie das Absolute, ist ebenso bedeutsam – aber diese relative Wirklichkeit ist nur ein Aspekt der Wahrheit, so wie es die kosmische Vision der Ziege dort an der schiefen Türöffnung unserer Behausung ist, die durch Regenschleier in den Schlamm hinausstarrt.
Morgen wollen wir nach Norden aufbrechen. Wir werden das Dhaulagiri-Massiv über den Jang-Paß überqueren und ins Flußtal des Bheri hinuntersteigen. Von dort geht es weiter über Suli Gad zum Phoksumdo-Fluß und dann über den Kang-Paß im Kanjiroba-Gebirge zum Kristall-Berg. Im Frühling oder im Sommer dürften vierzehn Tage für diese Strecke ausreichen, aber da auf den hohen Pässen schon Schnee liegt, müssen wir froh sein, wenn wir überhaupt ankommen.
Am frühen Nachmittag kommt die Sonne durch, es ist der erste richtige Sonnenschein seit einer Woche. Das Tal von Dhorpatan, das uns bislang so düster vorkam, ist plötzlich wunderschön. Ich spaziere zu den Talwiesen hinunter und umwandle dort eine Wand aus Gebetssteinen; sie ist ziemlich hoch und enthält alte und neue, flache und runde Steine verschiedener Größe und Farbe, die offensichtlich von verschiedenen Orten stammen. Wie und wann die ältesten von ihnen hierher gelangten, scheint niemand mehr zu wissen. Vier lange Stangen tragen Gebetsfahnen in den Himmelsfarben Blau und Weiß, die im frischen Wind flattern und ihr om mani padme hum in alle zehn Richtungen schicken. Die Wolken verziehen sich, und kurz vor der Dämmerung taucht weit hinter dem Osthang des Tales ein Gipfel des Annapurna auf. Während der letzten Tage haben sich auch die niederen Berge rund um das Tal in eine weiße Decke gehüllt.
73
Ach, alles war unverständlich und eigentlich traurig, obwohl es auch schön war. Man wußte nichts. Man lebte und lief auf der Erde herum oder ritt durch die Wälder, und manches schaute einen so fordernd und versprechend und sehnsuchterweckend an: ein Stern am Abend, eine blaue Glockenblume, ein schilfgrüner See, das Auge eines Menschen oder einer Kuh, und manchmal war es, als müsse jetzt gleich etwas Niegesehenes und doch lang Ersehntes geschehen, ein Schleier von allem fallen; aber dann ging es vorüber, und es geschah nichts, und das Rätsel wurde nicht gelöst und der geheime Zauber nicht entbunden, und zuletzt wurde man alt und sah pfiffig aus … oder weise … und wußte vielleicht noch immer nichts, wartete und horchte noch immer.
Mönch: »Was geschieht, wenn die Blätter fallen und die Bäume nackt sind?«
Ummon: »Der goldene Wind – offenbar!«
75
Ein herrlicher Sonnenaufgang, glitzernde Spinnennetze und Grünfinken, die im goldenen Oktoberglanz von Tanne zu Tanne hüpfen. Ponyglocken und fröhliches Pfeifen; die Kinder und Tiere springen herum, als wären sie zu neuem Leben erwacht. Ein hübsches junges Mädchen, fast ein Kind noch, mit silbernem Halsband und rotgrüngestreiften Bändern in den rabenschwarzen Zöpfen, trägt einen Säugling; es ist ihr eigenes Kind.
Ein derart prächtiger Reisetag eignet sich auch vorzüglich zur Kartoffelernte. Die neuen Träger weigern sich aufzubrechen, wollen aber auch den Vorschuß nicht zurückgeben, den sie zum Ankauf von Vorräten bekommen haben. »Dhorpatan-Leute nicht gut«, meint Phu-Tsering. Jang-bu bleibt zurück, um die fehlenden Träger aufzutreiben, Gyaltsen, um auf die Lasten aufzupassen, solange sein Freund nach Trägern sucht. GS bleibt ebenfalls noch, um erst einmal zu sehen, wie es weitergehen soll. Ich breche mit den anderen Trägern auf, wir sehen uns erst am Abend wieder.
In der würzigen Tannen- und Zedernluft windet sich der Pfad die Phagune-Schlucht hinauf. Ein Monal, ein Fasan mit hellrotem Wangenfleck, rauscht über das Tal, kleine, murmeltierartige Pfeifhasen oder Pikas sonnen sich vor ihren Löchern, ohne sich von den Rufen der Gebirgsvögel stören zu lassen. Silberne Flechten, grüngoldenes Moos und der Schrei eines Falken; der Blick südwärts, die Phagune-Schlucht hinab: flutendes Licht.
Wir nähern uns dem Dhaulagiri-Massiv, den »Weißen Bergen«.
Der nachts gefallene Schnee taut in der Sonne vor uns weg, erst am Nachmittag in etwa 4000 Meter Höhe holen wir ihn wieder ein. Der Schnee liegt schmutziggrau auf den steilen Geröllhalden, der Weg steigt in die Wolken hinauf, die die Berggipfel umhüllen. Die einzigen Farbtupfer in dieser grauen Einöde sind tiefgrüne Steinmispeln mit roten Beeren.
Im Schneematsch fällt uns das Gehen schwer, und die Paßhöhe will nicht kommen. Der Paß ist ein V weit vor uns und hoch gegen den Himmel, das sich in dem rasch wechselnden Wetter immer wieder in Wolkenbänke entzieht, und wenn es erreicht ist, 76dann ist es nur der Eingang zu noch einem höheren Tal mit einem weiteren V an seinem fernen Ende. Der enge Pfad über die Steilhänge ist im nassen Schnee nur schwer auszumachen und sehr heimtückisch. Phu-Tsering und Dawa besitzen von ihren früheren Expeditionen her noch Bergstiefel. Die meisten der Tamang gehen jedoch barfuß, damit sie die Segeltuchschuhe, mit denen wir sie ausgerüstet haben, später in Katmandu verkaufen können. Aber auch so kommen sie immer noch schneller vorwärts als der alte Bimbahadur mit seinen krummen Beinen; jeden Morgen bricht er früh vor den anderen auf und trifft abends als letzter, lange nach allen anderen im Lager ein.
Wegen der schmerzhaften Blasen trage ich Segeltuchschuhe, meine nassen Füße sind starr vor Kälte. Dawa, der mit dem Korb voller Kochgeschirr gleichmäßig vor sich hinstapft, überholt mich kurz vor dem Paß in fast 4500 Meter Höhe. Die Wolken sind hier oben so dicht, daß wir einander kaum sehen, der scharfe Wind führt leichten Schnee mit. Aus der Phagune-Schlucht unter uns dröhnt das Gepolter eines Felssturzes, dann ist tiefe Stille. Besorgt setzt Dawa seinen Korb ab, geht ein Stück zurück und pfeift nach Phu-Tsering und den anderen Trägern.
Unbeweglich bleibe ich stehen, den Blick nach Norden gerichtet, instinktiv rühre ich mich nicht. Nebelschwaden, Schneetreiben, völlige Stille und tiefe Verlorenheit: das Gefühl, ausgelöscht zu sein. Dann, in der atemlosen Stille, reißt der Wolkenvorhang plötzlich auf und gibt die riesigen Schneefelder des Dhaulagiri dem Blick frei, ich atme auf, und schon hat der Nebel alles wieder verschluckt – Leere. Unwillkürlich verneige ich mich.
Nun senkt sich der Weg durch nassen Schnee bis zur Baumgrenze, die hier von Zwergzedern angedeutet wird, um in der Dämmerung schließlich die Hochgebirgsmatten eines Bergsattels zu erreichen, auf dem es flach genug zum Aufschlagen der Zelte ist. Hier stoßen Tukten und GS zu uns. Nach Einbruch der Dunkelheit ziehen die Wolken ab, unser Lager in 4200 Meter Höhe ist von hellen Eiswänden umgeben. Vor dem schwarzen Himmel leuchten die fünf Gipfel des Dhaulagiri und über der weißen Einöde klingt metallen der Mond, der volle Mond des Oktobers, in dem der Lotus erblüht.
77
In der klaren Nacht sind die Sterne zu sehen, bis sie den Horizont berühren, und kurz vor dem Morgengrauen erscheint hinter den Gipfeln ein tiefschwarzes Band, so als könne man dort über den Horizont hinaus in die Tiefe des Weltraums blicken. Die Spitzen der Silbergipfel färben sich rosa und nehmen dann eine reinweiße Farbe an, sobald das Sonnenlicht den 7371 Meter hohen Churen Himal und den um rund 125 Meter niedrigeren Putha Hiunchuli trifft. Die Luft ist wie tönendes Glas. GS muß zugeben, daß er nicht einmal in Ostnepal, am Fuß des Mount Everest, einen Anblick erlebt hat, der sich mit dem Panorama dieses, von riesigen Eistürmen umstandenen Hochtals messen könnte.
Der Himmel ist wolkenlos – Wind, Wind und Kälte. Frierend haben sich die Tamang zu den Sherpa ins Zelt gequetscht, aber während der Nacht hat das Gestänge nachgegeben, und jetzt singen sie fröhlich unter der Plane des zusammengesackten Zeltes. Halbnackt und barfuß hocken die Tamang etwas später im schneidenden Wind vor dem Feuer, kneten Tsampa und summen dabei vor sich hin. Sie erinnern mich an die jungen Machiguegange-Indianer, wie ich sie vor langer Zeit am Lagerfeuer eines Anden-Flusses kauern sah. Jang-bu und Gyaltsen müssen mit den neuen Trägern auf der Südseite des Passes kampiert haben. Der Kälte wegen brechen wir unser Lager schnell ab und setzen den Abstieg nach Norden fort, ohne auf sie zu warten.
Wie aus dem Inneren der Erde dringt von tief unten das Rauschen des Flusses zu uns herauf. Die Rhododendronblätter an der Kante des Abgrunds sind poliertes Silber, doch in den Schluchten herrscht noch Nacht. Zugvögel lassen sich auf ihrem Weg nach Süden in die Schluchten nieder, um Nahrung zu suchen und sich auszuruhen. Die goldfarbenen Vögel fallen wie Funken aus der Morgensonne und verlöschen in der dunklen Tiefe.
Mit den ersten Sonnenstrahlen steigen wir in einen stillen Wald aus knorrigen Birken und dunkel ragenden Tannen hinab. Im Sonnenlicht, das kaum durch die mit Flechten behangenen Äste dringt, fliegt ein Vogel auf eine Zeder und breitet sein rötliches Gefieder aus. Plötzlich ist er verschwunden und hinterläßt ein Gefühl unbestimmter Sehnsucht und Leere.
78
Weiter unten führt der Weg durch einen Eichenwald, um dann, noch einmal dreihundert Meter tiefer, auf eine Bergweide mit einer Schäferhütte hinauszulaufen, wo wir auf Jang-bu und seine Leute warten. Beim wärmenden Feuer aus Dung und Stroh lehne ich mich gegen die besonnte Mauer. Ein leuchtend schwarzroter Käfer krabbelt vorbei, eine magere Heuschrecke reibt die feuerroten Hinterbeine. Mit trägem Flügelschlag zieht eine Krähe zum Fluß hinunter, und auch auf ihren Schwingen glänzt das harte Silberlicht des Himalaja. »Man kann gehen, wohin man will, Krähen tauchen früher oder später immer auf«, sagt GS. »Von der ganzen Krähenfamilie mag ich die Raben am liebsten. In Alaska, vierzig Grad unter Null, nirgends ein Zeichen von Leben – und dann plötzlich ein Rabe!« (Als GS noch die Universität von Alaska besuchte, hatte er einen zahmen Raben, dem er das erste Zusammentreffen mit seiner späteren Frau verdankte. Sie war auf einen Mann aufmerksam geworden, der zum Himmel schrie und einen unsichtbaren Raben zu sich zurückrief.)
Mit den Krähen, den Weiden am Fluß und den Schneebergen ringsumher hätte diese Talsenke auch im Westen Nordamerikas liegen können. Deborah hätte sich in diesen Bergen wohl gefühlt. Meine Frau hatte als Kind lange in den Rocky Mountains von Colorado gelebt, später wohnte sie eine Zeitlang in den südfranzösischen Alpen. Es war immer ihr Wunsch gewesen, einmal den Himalaja zu sehen.
Als Kind ritt ich oft auf einen Berg, wo die Sonne auf mich niederschien und das grüne Wiesental weit unter mir lag. Ich sah voller Sehnsucht in den Himmel auf und wartete. Nirgendwo ein Laut. Betrübt warf ich mich auf die Erde und breitete die Arme aus, um sie zu umarmen. Die Erde war warm und genau richtig, alles war genau richtig, das Stück Baumrinde, der Geruch des Grases, das Blätterrascheln im Wind, und ich wünschte mir, auch ich könnte genau richtig sein.
Aber keine Stimme sagte mir, wie ich es anfangen könnte, und so erhob ich mich wieder vom schweigenden Boden, stieg zu Pferd und ritt den Berg hinunter.[33]
79
Eine liebenswürdige, geistreiche Frau, eine begabte Schriftstellerin, eine wundervolle Lehrerin mit einem leidenschaftlich fordernden Verstand, außergewöhnlich intelligent und freundlich – so lautete die Meinung aller, die sie gut kannten. Einmal sagte ein Freund über sie: »Sie hat keinen Flecken auf der Seele«. Zeitweilig schien sie jedoch dem weltlichen Leben entrückt, als probte sie schon für jenen Tag, der ihr den herbeigesehnten höheren Bewußtseinsstand bringen werde. Mit einer Heiligen zu leben ist nicht schwer, denn Heilige stellen keine Vergleiche an, aber mit dem Streben nach Heiligkeit umzugehen, ist nicht leicht. Deborahs Tugend machte mich gereizt, und ich benahm mich ihr gegenüber schlecht. Die mit ihr verbrachten Tage waren oft durch Gewissensbisse vergällt, ich konnte mich in ihrer Nähe selbst nicht ausstehen und ergriff jede Gelegenheit zur Flucht, wann immer mir meine Arbeit die Möglichkeit einer Reise in einen anderen Erdteil bot – einmal war ich sieben Monate unterwegs. Und doch verband uns Liebe, nur halb verstanden, nie ganz verwirklicht, aber die gegenseitige Achtung, deren Verlust das Ende so vieler Beziehungen bedeutet, ging nie verloren.
Das metallische Licht über den Bergspitzen erinnert mich an eine Schneelandschaft bei Courchevel in den französischen Alpen, wo wir ein Jahr vor Deborahs Tod einen Skiurlaub verbrachten. Es waren glückliche Tage, in denen wir neue Hoffnung für unsere Zukunft schöpften. Von Courchevel fuhren wir nach Genf; Deborah wollte am nächsten Tag nach Amerika fliegen, während ich nach Italien fuhr, um ein kleines Bauernhaus in den Höhen von Umbrien zu verkaufen, in dem sie nicht hatte leben wollen.
An jenem dunklen Winternachmittag entdeckten wir in einem Schaufenster der Genfer Altstadt eine herrliche alte Schale aus Isfahan, dreizehntes Jahrhundert, mit sieben schwarzen schlanken Fischen auf weißlich-hellblauem Grund. Doch die Schale war sehr teuer, und ich kaufte ihr etwas anderes. Am nächsten Morgen flog ihre Maschine vor der meinen ab, und während ich auf den Abflug meiner Maschine wartete, rief ich vom Schmerz unseres Abschieds überwältigt im Antiquitätengeschäft an und kaufte die Schale aus Isfahan, die mir nach Italien nachgeschickt wurde. Das kostbare Gefäß sollte ein Symbol unseres neuen Anfangs 80sein, ich wollte Deborah an ihrem Geburtstag damit überraschen. Doch gerade an jenem Tag stritten wir uns heftig, und für eine bessere Gelegenheit zurückgelegt, geriet die Schale ganz in Vergessenheit, während unsere Ehe immer mehr in die Brüche ging. Keine Trennung war endgültig, jeder turbulenten Versöhnung folgte eine neue Krise. An einem Sommermorgen, nur fünf Monate vor ihrem Tod, faßten wir, von den ständigen Aufregungen erschöpft, den Entschluß, uns scheiden zu lassen. Ruhig und in vollem Ernst trafen wir zusammen die Entscheidung und waren hinterher beide erleichtert. Aber bereits am folgenden Morgen trieb mich ein innerer Zwang, mich ihr endgültig und unwiderruflich zu versprechen. Sie wußte, daß es mir ernst war. Während sie auf der Terrasse ihren Kaffee schlürfte, nahm sie mein Angebot mit einem Kopfnicken an.
Rückschauend erscheint mir, daß jener geheimnisvolle innere Befehl mit einer vorausgegangenen Intuition zusammenhing. Seit Jahren wurde in mir die Gewißheit immer tiefer, daß mein Leben auf irgendeinen dramatischen Wendepunkt zuraste. Die Macht dieser Vorahnung ließ mich argwöhnen, ich könnte bald sterben. Ich sprach nur zu einigen Freunden darüber, stürzte mich in die Arbeit und schrieb an meinem Afrika-Buch in dem Bewußtsein, daß mir nur wenig Zeit dafür übrig blieb. Ende November trug ich das Buch zu der Dame, die meine Manuskripte ins reine tippt. Einen Tag später ging Deborah zum erstenmal ins Krankenhaus, und ich schrieb fast ein Jahr lang keine Zeile mehr.
Schon seit dem Herbst klagte Deborah über unbestimmte Schmerzen, deren Ursache die Ärzte nicht herausfinden konnten. Sie wurde schmal, großäugig, wunderschön. Anfang Dezember kam sie aus dem Krankenhaus heim, ohne daß sich eine plausible Erklärung für ihre Schmerzen gefunden hätte. Aber bereits zwei Wochen darauf wurden Krebsmetastasen festgestellt, und noch vor Weihnachten mußte Deborah erneut ins Krankenhaus. In ihrer Angst und Niedergeschlagenheit verlangte sie verzweifelt nach Gewißheit, daß meine Bemühungen um sie nicht aus Mitleid geschahen, sondern daß unsere Liebe irgendwie auch während der Krisen fortbestanden hatte. Mir fiel die Schale aus Isfahan ein.
Heiligabend fuhr ich nach Hause, um den Kindern eine Art 81Weihnachtsstimmung vorzugaukeln, vergaß aber dann, die Schale auf dem Rückweg nach New York mitzunehmen. Damals hätte Deborah sofort verstanden, was ich damit andeuten wollte. Doch dann, im Januar, waren ihre Schmerzen unerträglich geworden, sie stand unter der Wirkung stärkster Beruhigungsmittel, so daß sie kaum noch ihre Freunde erkannte. Was konnte sie nun wohl mit einer Schale anfangen, die sie ein Jahr zuvor auf einem anderen Kontinent gesehen hatte? Den unwiederbringlichen Augenblick hatte ich versäumt, so glaubte ich zumindest, als ich sie im Bett aufstützte und ihr dann die Schale in die Hände legte. Mein Herz klopfte bis zum Hals. Ich konnte es kaum ertragen, wie Deborah mit vor Schmerz verzerrtem Gesicht gegen den Nebel der Betäubungsmittel und den Druck des Tumors in ihrem Gehirn ankämpfte. Aber als ich ihr die Schale aus den Händen nehmen wollte, drückte sie sie an sich und legte sich mit leuchtenden Augen wie ein beschenktes Kind zurück. »Die Schweiz«, flüsterte sie.
Hoch über uns kreist ein Lämmergeier. Die Träger kochen ihr Vormittags-Essen; die zweite und letzte Mahlzeit ihres Tages nehmen sie am späten Nachmittag nach beendetem Tagesmarsch. Noch immer kein Lebenszeichen von Jang-bu, kein Ruf kommt aus den Bergen. Vielleicht sucht er immer noch in Dhorpatan nach Trägern oder sie machen ihm unterwegs Schwierigkeiten. Phu-Tsering schickt Dawa zum Nachsehen zurück, der unermüdliche Tukten bietet sich freiwillig als Begleiter an. Binnen einer Stunde kommen die beiden zurück, sie haben die anderen oben am Berg erblickt. Als Jang-bu und Gyaltsen gegen Mittag endlich eintreffen, bereiten die neuen Träger erst einmal ihr Frühstück, was unseren Aufbruch nochmals um eine Stunde verzögert.
Wir warten vor der Steinhütte. GS, der innerlich kocht, klettert vor Ungeduld ein Stück bachaufwärts. Danach sucht er die Berge mit seinem Fernglas nach Blauschafen ab. Auf den nackten Felswänden könnten sie hier schon vorkommen, doch die hinduistischen Paharis aus Dhorpatan haben in dieser Gegend alle Bharals erlegt, deren sie habhaft werden konnten, und so ist kein einziges Blauschaf zu sehen. Auf einem hohen bewaldeten Grat entdeckt er jedoch zwei Himalaja-Thare, eine Übergangsform 82zwischen Ziegenantilope und Ziege. Die dunklen Tiere stehen bewegungslos vor dem blauen Himmelsrand, und doch geben sie dem ganzen Berg Leben. Die Tamang, die zum erstenmal in ihrem Leben durch ein Fernrohr schauen dürfen, tanzen und pfeifen vor Aufregung.
Die neuen Träger sind schmutzige Burschen in zerlumpten Kleidern, sie tragen kleine schwarze Kappen und das Kukri, das Kampfmesser der Gurkhas. Sie haben kein Interesse für das Fernrohr. Die meisten sind »Kami«-Leute aus der Kaste der Schmiede, rußschwarze Gesellen des Schmelzfeuers und des dem Berg entrissenen Eisens, die seit Beginn der Eisenzeit bei allen primitiven Völkern Eurasiens und Afrikas als Schwarze Magier gefürchtet waren. Auch zwei junge Tibeter sind dabei, sie haben die schwersten Lasten bekommen, nicht nur weil sie kleiner und schwächer sind als die anderen, sondern auch, weil sie als Buddhisten selbst von diesen Hindus der niedrigsten Kaste mit Verachtung behandelt werden.
Die »schmutzigen Kamis« sind ein schlitzohriger Haufen, wir wissen, daß wir ein Auge auf sie haben müssen. Und richtig, kaum sind wir unterwegs, als sich auch schon die ersten Simulanten unter dem Vorwand von Durchfall oder wehen Füßen ins Gebüsch schlagen. Wir scheuchen sie zurück und bleiben hinter ihnen, damit sie sich nicht mit ihren Lasten aus dem Staub machen können. Während ihrer häufigen Ruhepausen gesellt sich der listige Tukten zu ihnen, er raucht und flucht mit ihnen und zwinkert uns dabei zu, bis die Leute nicht mehr wissen, woran sie sind.
Unser Weg folgt jetzt dem Ghustang, einem wilden Sturzbach aus den Dhaulagiri-Gletschern, der über rostfarbene Felsblöcke durch einen Wald mit riesigen Nadelbäumen rauscht, um sich weiter westlich mit dem Uttar Ganga und dem Unterlauf des Bheri zu vereinen. Wo wir wieder auf Bambus stoßen, etwa 1500 Meter unterhalb unseres Lagers am Dhaulagiri, führt eine Bohlenbrücke über den Bach. Dann klettert der Pfad einen offenen Hang hinauf, in dem vereinzelte klobige Eichen und knorrige, wilde Olivenbäume stehen, deren Silberblätter im Nachmittagswind tanzen.
Auf dem Kamm über dem Tal führt der Weg über einen 83schmalen Grat nach Westen. Unterwegs bemerken wir die Losung eines Fuchses und eines Buntmarders, Vögel hingegen sind hier selten, von drei aufgeschreckten Fasanen abgesehen. Aufziehende Wolken bringen einen anhaltenden Nieselregen, der erst gegen Sonnenuntergang aufhört, als verstreute Sonnenstrahlen noch einmal die Berggipfel treffen. Weit hinter uns deutet ein Sonnenfleck noch einmal auf unser Hochlager am Dhaulagiri.
Und wieder einmal abwärts, vorbei an Bergweiden zum Dörfchen Yamarkhar. In der Dunkelheit treffen wir bei einem Haufen Steinhütten ein. Jang-bu versucht eine Unterkunft aufzutreiben, die Träger haben keine Zelte und müssen ein Dach überm Kopf haben. Wir sind den ganzen Tag marschiert, auf steilen Pfaden erst bergab, dann bergauf und abermals den Berg hinunter, von unserem Lager in 4200 Meter Höhe bis zum nur 2700 Meter hoch gelegenen Dorf Yamarkhar. Ich habe wehe Füße, wehe Knie und einen nicht weniger schmerzenden Rücken. Der Lämmergeier von heute morgen hätte in einem kaum fünfzehnminütigen Gleitflug die Strecke zurückgelegt, zu der wir zehn harte Wegstunden gebraucht haben.
Die Nacht legt sich über das enge Tal. Der Mond versteckt sich noch hinter den Gipfeln, aber sein Widerschein dringt in die tiefen Schluchten. Das Flackern eines einsamen Feuers in der dunklen Wand uns gegenüber hat etwas Unheimliches; es sieht aus, als bräche aus dem Inneren der Erde eine Zunge des Höllenfeuers hervor.
Die schwarzen Kamis halten sich an die Tradition aller Träger auf der Erde und wollen nicht weitergehen, als sie den steilen Pfad an der Bergwand jenseits des Flusses erblicken. Auch mir wird davor angst und bange. Mit einem letzten resignierenden Blick auf die ungeplünderten Traglasten kehren sie nach Dhorpatan zurück, auch die beiden jungen Tibeter gehen mit. Obwohl wir froh sind, diese Burschen loszusein, müssen wir jetzt entdecken, daß in Yamarkhar keine Träger zu bekommen sind. Jang-bu verhandelt mit dem Eigentümer der Hütte, um fünf Ponys zu mieten. 84Was wir allerdings oben im Schnee des Jang-Passes mit den Tieren anfangen sollen, wird sich zeigen, wenn wir oben sind.
Wegen der hohen Berge im Osten liegt das Dorf noch spät morgens im Schatten; nur die Spitzen der gegenüberliegenden Bergkette liegen schon in der Sonne, als GS und ich den abschüssigen Weg über die Ackerterrassen zum Bambusdickicht am Pema-Fluß hinabsteigen. Eine sehenswerte Holzbrücke verbindet die Ufer, das Geländer schmückt eine geschnitzte Blumengirlande, die vier Pfosten an den Brückenenden sind grob zugehauene Figuren, zwei Paare von Dhauliyas oder Wächterfiguren, die lokale Gottheiten der alten Religion darstellen. Derartige männliche und weibliche Wächterfiguren findet man auch bei den Indianern der pazifischen Nordwestküste. Die Göttinnen öffnen weit ihre Vulva zum Willkommensgruß im Reich der Berggötter.
Oben im Sonnenschein liegt ein kleines Dorf, von hier kam der Feuerschein der letzten Nacht. Es ist eine der urtümlichen Ansiedlungen, wie man sie in den tiefen Schluchten des Himalaja antrifft. Kaum eine Meile in Luftlinie von Yamarkhar entfernt, scheinen wir in ein anderes Land und in ein anderes Jahrhundert geraten zu sein. Die Steinhäuser von Yamarkhar stehen einzeln wie die Häuser in Tibet, während hier eine Art Pueblo entstanden ist. Das Dach des einen Hauses bildet die Veranda des anderen, die verschiedenen Ebenen sind durch primitive Leitern aus eingekerbten Baumstämmen verbunden. In Yamarkhar sind die Leute wie alle Bauern in Nepal gekleidet, hier tragen die Männer einen Lendenschurz und eine Decke um die Schultern. Die Frauen stecken das Haar zu riesigen Knoten auf. Einige Frauen, aber auch ein Mann, tragen seltsame Halsbänder aus den Eckzähnen des Moschustieres; es gehört zu einer der urtümlichen Tierarten, die man in dieser durch hohe Gebirge vom Rest Eurasiens abgeschiedenen Sackgasse der Evolution noch antrifft; ihre großen, hauerähnlichen Eckzähne wurden bei den neuzeitlichen Hirschrassen durch das Geweih ersetzt. Die kleine Hirschart wird hauptsächlich wegen ihrer Moschusdrüse gejagt, deren Sekret als Grundstoff für Parfüm verwendet wird. Seit für einen solchen Moschusbeutel in Katmandu über fünfhundert Dollar gezahlt werden, ist der Moschushirsch in Nepal vom Aussterben bedroht.
85
Die Bewohner dieser seltsamen Siedlung verhalten sich, als wären wir gar nicht vorhanden. Ein Mann raucht weit hintenübergelehnt seine primitive rohrförmige Pfeife, eine Frau zerstößt Maiskörner in einem Steinmörser, und drei kleine Mädchen knacken die dunklen Walnüsse, die von einem der wenigen stehengelassenen Bäume am Berg stammen. Zwei Kinder tanzen auf einer überdachten Veranda, ein drittes schlägt den Takt dazu auf einer Trommel. Ein uralter Mann mit tief gekrümmtem Rücken schlurft an einem winzigen Tabakfeld am Fuß der Häuser entlang, in den auf dem Rücken verschränkten Händen eine leere Schale.
GS bleibt zurück, während ich eine Weile weiterklettere und dann an einem Bergbach haltmache, um zu trinken und mich zu waschen. Grünfinken hüpfen herbei, ein Falke segelt ins Tal, in den lavendelblauen und weißen Blüten von Astern und Strohblumen das tröstliche Summen einer Hummel. Ich setze mich auf einen warmen Stein und genieße den Ausblick nach Yamarkhar hinunter, das nun auch endlich Sonne abbekommt. Auf den Flachdächern leuchtet in hellen Farben die zum Trocknen ausgebreitete Ernte, der Wintervorrat der Dörfler: gelbe Kürbisse, roter Pfeffer, bronzefarbene Tabakblätter, rötliche Hirse, Maiskolben und Hanf, der Fasern und Speiseöl, aber auch Marihuana liefert.
Ich steige weiter den Berg hinauf, an einem dunklen frischgepflügten Feld vorbei, wo ein Mann lauthals auf die beiden Buckelrinder schimpft, sooft die Pflugschar im steinigen Boden steckenbleibt; Holzpflüge wie dieser werden seit über dreitausend Jahren vor Beginn unserer Zeitrechnung benutzt. Weiter oben kommt uns ein Pferdehirte mit einer Herde magerer Ponys entgegen, die von den Sommerweiden im Hochgebirge heimkehren. Wieder einmal habe ich den Eindruck, daß wir uns auf dem Weg nach Norden gegen den Fluß der Jahreszeit bewegen. Ein Junge läuft neben den Ponys her und hält sie mit gut gezielten Steinwürfen in der Reihe, ein kleines Mädchen mit einem langen Stecken treibt die Nachzügler an. Durch den unerwarteten Anblick eines Fremden erschreckt, macht das Kind einen Bogen um mich, erst als es sich in Sicherheit wähnt, dreht es sich um und ruft mir fragend etwas zu. »Wer bist du?« scheint die sanfte Stimme zu 86fragen. Ich verstehe seine Sprache nicht und kann nicht antworten. Wir lächeln uns an, und das Mädchen legt grüßend die Hände zusammen: »Namas-te!« Ich wiederhole: »Namas-te!« »Ich grüße dich«. Und dann hüpft es weiter hinter der Ponyherde her.
In einem Eichenhain warte ich auf die anderen. Tief unten tauchen Schneetauben wie eine wirbelnde weiße Wolke aus der Sonne in die dunklen Schluchten hinab. Ich höre den Flügelschlag der Tauben, die ich als Junge in New England gezogen habe. Haus- und Wildtauben haben es mir immer angetan, insbesondere die Ringeltauben meiner Heimat.
Etwa 1000 Meter über dem Lauf des Pema wendet sich der Pfad nach Norden und überquert einige Hochtäler. GS hat mich eingeholt, und gleich hungrigen Bären pflücken wir im Vorübergehen die säuerlichen Berberitzenfrüchte und Hagebutten von den Sträuchern. Dann windet sich der Weg durch eine feuchte, schattige Klamm, immer höher an gähnenden Höhlen und freistehenden Felsblöcken vorbei. Wo sich die Felsspalte am oberen Ende gegen den Himmel öffnet, schlagen wir das Biwak auf in der Hoffnung, daß Jang-bu bis zum Abend mit den Ponys eintrifft.
Und wieder der Monsunregen, der schon in der ersten Oktoberwoche hätte aufhören müssen. Alles ist voll Schlamm. Seit gestern abend acht Uhr, als Jang-bu mit den Ponys eintraf, fällt heftiger Regen, der noch jetzt gegen Mittag anhält. Heute morgen haben sich die Ponys im Sturm losgerissen, der Besitzer hat sich aufgemacht, sie wieder einzufangen, vielleicht sind sie auch nach Yamarkhar zurückgelaufen. Eine Schlammpfütze am Zeltende hat mein Lager durchweicht; hoffentlich kommt die Sonne bald durch, damit wir vor dem Weitersteigen unsere Sachen trocknen können, mir ist ohnehin kalt genug. Drei Tagereisen weiter, am Jang-Paß, ist der Regen sicherlich als Schnee heruntergekommen, aber wir sind an unsere Route gebunden, zur Umkehr ist es zu spät. Selbst wenn wir die Genehmigung bekämen, könnten wir nicht mehr einen Versuch über die Jamoson-Tscharka-Route 87wagen oder nach Jumla fliegen. GS ruft durch den Regen aus seinem Zelt herüber: »Wir müssen über den Paß, und wenn es eine Woche dauert, oder wir sind aufgeschmissen!«
Trotzdem ist die Stimmung besser, seit wir Dhorpatan hinter uns haben. Ich habe keine Eile, irgendwohin zu kommen; GS dichtet eifrig Haiku. Obwohl sie nicht darum gebeten wurden, schaufeln Dawa und Gyaltsen Wassergräben um die Zelte – bei meinem Zelt nützt das sowieso nichts mehr –, die anderen haben unter einer Zeltplane ein Feuer gemacht und bereiten trotz des Platzregens heißen Tee. Auf eine Bemerkung Tuktens bricht Phu-Tsering in sein helles, ansteckendes Lachen aus. Schließlich ist Tukten doch ein Sherpa, und so setzt er auch abends seine Trägerlast ab, um den anderen beim Aufschlagen der Zelte und beim Sammeln von Feuerholz zu helfen.
Seit 1960 nimmt Tukten an Expeditionen teil; damals hat er eine britische Bergsteigergruppe zum Annapurna und noch im gleichen Jahr eine britische Botanik-Exkursion als Koch nach Ostnepal begleitet. Dann trat er, wiederum als Koch, in das 6. Gurkha-Regiment der britischen Armee ein und musterte gerade rechtzeitig ab, um an der britischen Expedition zur Besteigung des Südhanges des Annapurna teilzunehmen. Als Sherpa verdingte er sich bei einer japanischen Gruppe, die den Dhaulagiri I bestieg. Als er auf dem Heimweg von einer Expedition nach Ost-Dolpo in der Sherpa-Kolonie von Pokhara einen Besuch abstattete, wurde er von Jang-bu angeheuert.
»Dolpo-Dörfer viel stinken«, sagt Tukten, der als einziger von uns die Gegend kennt. Irgendwie hat man das Gefühl, er sei in diesem oder in seinen vorigen Leben überall auf der Welt herumgekommen. Mit seiner sanften Stimme erzählt er gern Geschichten aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen, denen die anderen Sherpa, auch wenn er nicht zu ihnen gehört, lauschen. Eigentlich wäre sein Platz bei den Trägern, die in einer Höhle unten im Canyon Unterschlupf gefunden haben. Doch Tukten ist erfinderisch und hilfsbereit, und seine beschwörende Stimme, die durch Regen und Wind dringt, scheint die jüngeren Sherpa zu faszinieren, wenn sie ihm auch mißtrauen und einen gewissen Abstand wahren. Offenbar fürchten sie ihn, nicht wegen seiner Gewalttätigkeit – im Rausch, so sagen sie, wird er streitsüchtig –, 88sondern wegen seiner inneren Kräfte. Was immer auch dieser Mann sein mag, Pilger oder böser Mönch, Heiliger oder Magier, jedenfalls scheint er das geschmeckt zu haben, was die Tibeter die »verrückte Weisheit« nennen, er ist unabhängig und frei.
Die jungen Tamang-Träger bleiben meist unter sich, und so ist Tukten für gewöhnlich auf den sanften, etwas stumpfsinnigen Bimbahadur als Gefährten angewiesen, einen etwas untersetzten alten Landstreicher mit krummen Beinen und Plattfüßen, der stolz seinen Schnurrbart und die Fetzen seiner einstigen Uniform spazierenträgt. Aber auch von Bimbahadur ist Tukten nur geduldet, denn Bimbahadur hat mit dem Leben abgeschlossen und geht nur noch unter Menschen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen – er ist in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt, wie die Sufis sagen. So hocken denn die beiden Außenseiter beisammen im Regen und essen Tsampa, ein aus gerösteten Mais- und Gerstenkörnern gemahlenes Mehl, das zu Brei gekocht oder in Tee verrührt wird und eines der Hauptnahrungsmittel in der gesamten Himalajaregion ist. Die Münder in den gegerbten Gesichtern mit weißem Brei verschmiert, kauern sie wie Geister am Feuer über dem rußschwarzen Topf; fast erwartet man, daß sie sich erheben und lautlos den feierlichen Tanz der Sennin beginnen, jener Bergeinsiedler aus früheren Zeiten, die in China und Japan den Menschen nicht durch Worte, sondern durch ihr stilles Vorbild den rechten Weg zeigten und sie durch die Lauterkeit ihrer eigenen Erleuchtung bekehrten und erlösten.
Zwei solcher Sennin waren Han Shan und Shih Te (jap: Kanzan und Jittoku), die immer wieder von den großen Zen-Malern dargestellt wurden. In Japan wird manchmal der Lebenstanz dieser beiden Weisen vor Kopien der Landschaft auf solchen Bildern aufgeführt, wie um darzustellen, daß diese freien Wesen die ganze Natur als Meisterwerk sehen. Zuerst sehen wir Han Shan in eine Schriftrolle vertieft, während Shih Te auf einen Besen gestützt neben ihm steht. Dann kommt Bewegung in das lebende Bild und die Sennin beginnen, mit gravitätischen Schritten zu tanzen.
Im Verlauf des Tanzes entfaltet Han Shan wieder seine Schriftrolle, die beiden beginnen eifrig zu lesen. Der Zuschauer sieht, wie sich ihre Köpfe bewegen, aber er kann nicht sehen, was die 89Schriftrolle enthält; jetzt scheinen die beiden auf einen besonders treffenden Satz gestoßen zu sein, sie halten inne, schauen sich strahlend an, springen auf und beginnen einen Freudentanz. Dabei sieht der Zuschauer zum ersten Mal für einen Moment die Innenseite der Schriftrolle: sie ist weiß, fleckenlose Leere, ohne die Spur eines Schriftzeichens.
Während Han Shan mit großer Sorgfalt die Schriftrolle wieder zusammenrollt, schaut Shih Te, wieder auf seinen Besen gelehnt, die Zuschauer an und schüttet sich aus vor Lachen. Und bevor der Zuschauer weiß, wie ihm geschieht, rauscht der Vorhang herab, und da ist nur noch Stille und der leere Vorhang.[34]
Als am frühen Nachmittag der Regen endlich aufhört und der rauschende Bach wieder zu hören ist, taucht der Besitzer der Ponys wieder auf: er hat sich entschlossen, mit den Tieren nach Yamarkhar umzukehren. Schüchtern stottert er einen Abschiedsgruß, worauf GS ihn wütend aus dem Zelt anfährt: »Gott befohlen, du Scheißkerl, ich kann Schönwetter-Freunde nicht leiden, die ihre Versprechen nicht halten und andere in der Patsche sitzenlassen!« Jang-bu bemüht sich nicht erst mit der Übersetzung, der Sinn des Gesagten geht aus dem Tonfall hervor.
Nach dem Glauben der Tibeter sind Hindernisse auf einer Reise, wie Hagel, Wind oder zu viel Regen, das Werk von Dämonen, die dadurch die ernste Absicht der Pilger auf die Probe stellen und die Kleinmütigen unter ihnen abschrecken. So gesehen, wird GS hart auf die Probe gestellt; drei Tagereisen vor dem Jang-La sitzen wir im Regen fest, ohne Hoffnung auf Hilfe. Zu allem Überfluß läßt Bimbahadur, der den Weg kennt, uns wissen, daß der Pfad ab morgen über die Baumgrenze ansteigt und wir deshalb noch zusätzliche Lasten an Feuerholz mitschleppen müssen. Aber GS scheint nicht zu den Kleinmütigen zu gehören, denn wieder genau zum richtigen Augenblick winkt uns das Glück, wie damals, als ich mir eine Stunde vor dem Angriff der Dogge einen Stock abschnitt. Seit Dhorpatan sind wir keinem einzigen Reisenden begegnet, nun aber stellt sich heraus, daß nicht weit von uns in einer Höhle eine Gruppe Leute auf ihrem Heimweg nach Tarakot übernachtet hat. Ihr Anführer ist der Dorfvorsteher und er bietet uns seine Leute als Träger an.
90
Das Wunder verliert ein wenig an Glanz, als die Leute den dreifachen Trägerlohn fordern und auch bekommen. »Die wissen genau, wie sehr wir auf sie angewiesen sind, und nutzen das aus«, sagt GS und gibt Jang-bu Anweisung, die Zahl der Traglasten um zwei zu verringern und das zusätzliche Gewicht auf die Tragkörbe der Leute aus Tarakot zu verteilen.
Der Wind frischt auf, zwischen den Baumkronen erscheinen die ersten blauen Stellen. Offensichtlich ist der Monsun endlich vorbei, und ab morgen dürfen wir auf besseres Wetter hoffen. So meint jedenfalls GS. Ich mißtraue den Berggöttern immer noch und klopfe auf das Holz einer vom Bergwind verdrehten Eiche. Unter den größten Bäumen hat man Feuer gelegt, damit sie absterben und als Feuerholz dienen können, von den kleineren hat man die meisten Äste für Feuerung und Ziegenfutter abgeschnitten, die verstümmelten Gestalten heben sich anklagend gegen den bewegten Himmel.
In der vergangenen Nacht habe ich zum erstenmal im Leben bewußt im Traum halluziniert. Ich saß in einer schattigen Hütte, draußen vor einem Fels saß die Gestalt eines Freundes mit einem Hund. Plötzlich gewann das Bild eine innere Strahlkraft, die Farben leuchteten und die Formen sprangen mir überdeutlich entgegen, wie in einer psychedelischen Vision. Die Gestalt im Freien wurde von einer furchtbaren Gewalt niedergeworfen, zerquetscht und getötet. Dabei hatte ich die ganze Zeit über das Gefühl, außerhalb der Szene zu stehen, mich selbst im Traum zu beobachten und mich selbst außerhalb meines Körpers stehen zu sehen; ich hätte ihn zurücklassen können, zögerte aber, da ich fürchtete, nicht zu ihm zurückkehren zu können. In dieser Furcht erwachte ich, das heißt, ich entschloß mich aufzuwachen, denn es gab offenbar keinen Unterschied zwischen Traum- und Wachzustand. Nach einer Weile schlief ich wieder ein. Ein Buntmarder mit gelbem Halsfleck von der Art des großen Himalaja-Wiesels, dessen Exkremente wir unterwegs gesehen haben, sprang mit einem Jungen im Maul auf einen Baum und setzte das Junge in 91einer Astgabel ab. Von einem höheren Ast sprang ein Eichhörnchen herab, und der Marder fing es mit einem Satz noch im Flug ab. Er blieb minutenlang schwebend in der Luft hängen, die Zähne in den Körper seiner Beute geschlagen, und starrte mich an. Dann saß er wieder auf dem Ast und fraß das Eichhörnchen, dessen Kopf und Haut zu Boden fielen. Aus dem Kopf blickten die Augen des Eichhörnchens leuchtend und lebendig zu mir auf. Beide Träume waren so intensiv, eher wie Halluzinationen im Wachzustand als wie Traumbilder, so daß mir auch nach dem Erwachen am Morgen noch ein ungutes Gefühl zurückblieb.
Der Eindruck der Träume will nicht weichen – kann ich denn tot sein? Es ist, als wäre ich in jenen Zustand eingetreten, den die Tibeter Bardo nennen – übersetzt etwa »zwischen zwei Existenzen« –, eine traumgleiche Halluzination, die einer Wiedergeburt, nicht unbedingt in menschlicher Gestalt, vorangeht; typisch für die Visionen des Zwischenzustandes ist der Anblick einer Schädelschale voller Blut, das Symbol der Vergänglichkeit aller körperlichen Existenz mit ihrem endlosen Dürsten, Trinken, Gestilltwerden und abermaligem Dürsten.
Die Anweisungen für den Durchgang durch den Bardo sind im tibetischen »Totenbuch« enthalten, das ich für den Bedarfsfall bei mir führte. Es ist auch ein Führer für die Lebenden, denn es lehrt, daß die letzten Gedanken eines Menschen die Art seiner Wiedergeburt bestimmen. Deswegen sollte jeder Augenblick des Lebens gelassen und bewußt erlebt werden, als wäre er der letzte, um so den menschlichen Daseinszustand – der einzige, in dem Erleuchtung möglich ist – so gut wie möglich zu nutzen. Nur die Erleuchteten können sich an frühere Daseinsformen erinnern, für uns andere sind Erinnerungen aus früheren Existenzen nichts als Lichtblitze, eine wehe Sehnsucht oder vorbeihuschende Schatten, die uns merkwürdig bekannt vorkommen, aber bevor wir sie fassen können verschwinden.
Folglich werden wir ermahnt, uns darum zu bemühen, »dieses Leben und das nachfolgende, wie auch das dazwischenliegende Leben im Bardo als Eins zu betrachten«. So lauteten die letzten Worte, die der große tibetische Heilige und Dichter, der Lama Milarepa, an seine Schüler richtete. Milarepa lebte im zehnten Jahrhundert; er wurde Milarepa genannt, weil er als großer Yogi 92und Meister der Praxis der »inneren Hitze« nur einen einfachen weißen Umhang, einen Repa trug, sogar im tiefsten Winter. Seine Gedichte und Lehrverse wurden von seinen Schülern niedergeschrieben und erfreuen sich auch heute noch in Tibet großer Beliebtheit. Wie Shakyamuni soll auch Milarepa in nur einem Leben vollkommene Erleuchtung erlangt haben; die Worte, die er sprach, als er sich auf den Tod vorbereitete, hätte auch der Buddha sprechen können:
Alles weltliche Streben hat nur ein unvermeidbares und unentrinnbares Ende im Leid: Erwerb endet in Verlust, Aufbau in Zerstörung, Begegnung in Trennung, Geburt in Tod. In diesem Bewußtsein sollte man von Anfang an auf Erwerb und Anhäufung von Reichtümern, auf Bauen und Begegnungen verzichten … und nach der Erkenntnis der Wahrheit trachten … Das Leben ist kurz und der Zeitpunkt des Todes ist ungewiß, deshalb widmet euch der Meditation …[35]
Meditation hat nichts zu tun mit der Kontemplation ewiger Wahrheiten, der eigenen Torheit oder gar des eigenen Nabels, obwohl man durch sie eine klarere Sicht all dieser rätselhaften Dinge gewinnen kann. Meditation hat überhaupt nichts mit irgendeinem Denkvorgang zu tun – sie besteht in der Intuition des wahren Wesens der Existenz; aus diesem Grund ist Meditation in irgendeiner Form auch in nahezu allen bekannten Kulturen der Menschheit zu finden. Der entrückte Buschmann starrt ins Feuer, der Eskimo zeichnet mit einem spitzen Stein immer tiefer werdende Kreise auf eine glatte Felsfläche und erreicht dadurch dieselbe Auslöschung des Ego (und dieselbe außerordentliche Kraft) wie der Derwisch oder Pueblo-Indianer bei ihrem heiligen Tanz. Die Hindus und Buddhisten gelangen durch innere Stille zur Erkenntnis, die sie gewöhnlich durch den Samadhi-Zustand des Sitzens in Meditation erreichen.[36] In den tantrischen Praktiken verdrängt der Übende sein Ich, indem er sein ganzes Sein mit dem wirklichen oder vorgestellten Gegenstand seiner Konzentration erfüllt; die Anhänger des Zen bemühen sich darum, den Geist zu entleeren, ihm die klare Stille einer Muschelschale oder eines Blütenblattes wiederzugeben. Wenn Körper und Geist Eins 93geworden sind, öffnet sich das ganze Wesen des Menschen ungehindert von Intellekt, Gefühlen und Sinneswahrnehmungen für die Erfahrung, daß die individuelle Existenz, das Ego, die »Wirklichkeit« aller Dinge und Phänomene nichts weiter ist als vergängliche und illusorische Anhäufungen von Molekülen. Das ermüdende Selbst aus Masken und Schutzmauern, Abwehrmechanismen, Vorurteilen und Meinungen, welches aufrechterhalten von Vorstellungen und Begriffen sich selbst für eine abgetrennte Wesenheit hält (in einer Gesellschaft aus ähnlichen Wesenheiten), mag dann plötzlich wegfallen, sich in einen formlosen Fluß auflösen, in dem solche Begriffe wie »Leben« und »Tod«, »Zeit« und »Raum«, »Vergangenheit« und »Zukunft« keine Bedeutung mehr haben. Da ist dann nur noch eine strahlende, transparente Leere, das Ungeschaffene, das keinen Anfang und deshalb auch kein Ende hat.[37]
Wie die japanischen Bodhidharma-Figuren, Stehaufmännchen, die immer wieder in ihren Mittelpunkt zurückkehren, stellt die Meditation den Angelpunkt des Universums dar, in den alles wiederkehrt wie in der Stille der tiefsten Nacht, der Stille zwischen den Gezeiten und der Stille des Augenblickes vor der Schöpfung. In dieser unverstellten Leere, in diesem dynamischen Ruhezustand, liegt die letzte Wirklichkeit, hier wird der Mensch zu seinem »Wahren-Wesen« wiedergeboren in der Rückkehr aus dem, was die Buddhisten den »großen Tod« nennen. Das ist die Wahrheit, von der Milarepa spricht.
Obwohl die Nacht sternenklar war, klopft bei Tagesanbruch der Regen auf die Zeltleinwand; GS, der sich sonst nicht oft dazu hinreißen läßt, flucht in seinem Zelt vor sich hin. Als der Regen nachläßt, brechen wir das Lager ab. Kaum bin ich losmarschiert, da stoße ich auf einen Wiedehopf, der seltsam zahm ist. Seine Zutraulichkeit erscheint mir als gutes Omen; er marschiert dicht vor meinen Füßen im nassen Gras hin und her, als habe er nur darauf gewartet, uns weiterführen zu können.
Der Weg biegt ab in eine sich verjüngende Schlucht. Den Felsdurchbruch an ihrem oberen Ende erreiche ich gerade, als die Strahlen der aufgehenden Sonne ihn treffen und dieses Portal mit blendendem Licht erfüllen. Durch dieses Tor betrete ich eine 94andere Welt, erstaunt bleibe ich stehen und schaue mich um. Vor mir steigt ein Labyrinth von Tälern zu den Schneehängen empor, der Himalaja ist gewunden und zerklüftet wie ein riesiges Gehirn. Fern im Dunst taucht der Churen Himal einen Augenblick lang auf. Ein paar Fasanenhennen flattern über einen mit Flechten bewachsenen Felsblock, der purpurrote Hahn bleibt verborgen. Weit unter uns zieht ein Weißkopfgeier seine Kreise über düstere Spalten, in die noch kein Sonnenstrahl dringt. Auf dem Grat, dem wir zusteigen, steht ein Wäldchen aus Eichen und Ahornbäumen, die Seiten der Schlucht sind in das durch gelbe Blätter gefilterte Sonnenlicht getaucht; ein goldener Windhauch trägt herbstlichen Humusgeruch heran.
GS schließt zu mir auf, zusammen steigen wir weiter bis auf 4000 Meter Höhe. Die Wege an den Berghängen sind sehr schmal, Fehltritte kann man sich nicht leisten, auch kommt man in dieser Höhe rasch außer Atem. Allmählich habe ich mir eine leichtere Gangart angewöhnt, mit lockeren Knien, fast dahingleitend, was es mir leichter macht, mit schwindelerregenden Situationen fertig zu werden. An manchen Stellen ist der Pfad weniger als zwei Fuß breit (ich habe es nachgemessen), ein schmaler Saum über einem Abgrund. Auch der Rest ist nicht viel besser, denn die mit Gras bewachsenen Hänge sind steil und tragen weder Baum noch Strauch; wer hier ausrutscht, würde keinen Halt finden und Hunderte von Metern hinabgleiten und -rollen, ehe er irgendwo in einem dunklen Schlund verschwände.
Die immer noch nachklingenden Träume der letzten Nacht verstärken mein Angstgefühl. »Der Traum … in dem du Geist und Phänomene als Einheit erfahren hast, war eine Lehre: hast du sie nicht verstanden?« Den Gedanken, daß die Welt des Menschen und seine Träume gleicherweise nur Traumzustände sind, habe ich noch nicht ganz begriffen, aber Milarepa hat mir bereits auf andere Weise geholfen. Als er nach vielen Jahren in sein Geburtsdorf zurückkehrte (etwa achtzig Kilometer nördlich von Katmandu auf der tibetischen Seite der heutigen Grenze), fand Milarepa den verwesten Leichnam seiner Mutter, nur noch einen Haufen Schmutz und Lumpen in ihrer zerfallenen Hütte. Von Schmerz und Entsetzen gepackt, erinnerte er sich an die Lehre seines Guru, sich für alles, was er am meisten fürchtet oder besonders 95abstoßend empfindet, völlig zu öffnen, um sich vor Augen zu halten, daß im Universum alles untrennbar miteinander verbunden und deshalb heilig ist. So legte er sich nieder, die traurigen Überreste seiner Mutter als Kopfkissen benutzend, und ruhte darauf sieben Tage im tiefen, klaren Zustand des Samadhi. Diese tantrische Übung zur Überwindung von Angst und Ekel, die oft auf einem Leichnam sitzend oder in der Nacht auf einem Friedhof durchgeführt wird, wird als Chöd bezeichnet. Da man mit dem Tod Frieden schließen muß, um das Leben bejahen zu können, übe ich eine milde Art des Chöd, indem ich mich zwinge, sooft wie möglich in den Abgrund zu schauen. In den folgenden Wochen wird die Wegstrecke noch schwieriger werden und eine gewisse Abhärtung wird mich die Gefahren des Hochgebirges leichter ertragen lassen. Diese Übung hilft mir auch, meine Aufmerksamkeit den kleinen Dingen am Wegrand zuzuwenden: ein kleiner Splitter Rosenquarz, die Sporensäckchen auf den Farnkrautblättern, ein Haufen Ponydung. Wenn man seine Aufmerksamkeit ganz auf die Gegenwart richtet, beginnt man, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu freuen; mit welchem Genuß habe ich gestern die dünne Fleischsuppe und den altbackenen Zwieback gegessen, die der scheue Dawa mir ins lecke Zelt reichte.
Die Bäume verkümmern allmählich mit zunehmender Höhe, bis ein Felsengarten aus Zwergrhododendron, Birken und feuerroten Eschen entsteht, dazwischen Farnkraut, Edelweiß und eine mir unbekannte Hochgebirgsblüte in metallisch hellem Blau. Auch ein leuchtend grün gefärbter Specht zeigt sich, und obwohl ich weiß, daß ich hellwach bin und dies alles wirklich sehe, erscheinen mir der Specht und die blauen Blüten nicht mehr und nicht minder wirklich als der Buntmarder in meinem Traum.
Die Sonne bricht durch und verschwindet wieder. Der Monsun hat immer noch nicht ganz von uns abgelassen, aus dem Osten ziehen Wind und Wolken auf, aber der Himmel im Süden über Indien ist blau und klar.
»Weißt du, daß wir seit September keinen Motor mehr gehört haben?« fragt GS. Er hat recht. Nicht einmal ein Flugzeug fliegt über diese Berge. Wir haben uns in ein anderes Jahrhundert verlaufen.
Diese Wanderschaft im wechselnden Sonnenlicht stimmt mich 96froh, die trübsinnigen Gedanken des Morgens sind verflogen. Gewiß, ich würde gern das Kristall-Kloster besuchen und mit eigenen Augen einen Schneeleoparden sehen, aber sollte es nicht gelingen, so soll es mir auch recht sein. In diesem Augenblick sind wieder Vögel da, rotschnäblige Dohlen, die kleinen Krähen hochgelegener Orte; am Himmel rüttelt ein Bussard, und ein zwitschernder Finkenschwarm läßt sich vom Wind nach Süden tragen. Eine Lerche, ein Mauersegler, ein Lämmergeier und mehrere Weißkopfgeier, wo kommen sie alle plötzlich her? Die Greifvögel segeln in Augenhöhe mit sausenden Schwingen an uns vorüber.
Auf einem niedrigen Paß ist ein kleiner Steinhaufen aufgeschichtet. Man hat Stöcke, an denen Stoffreste flattern, hineingesteckt; an der Ostseite befindet sich eine Öffnung für Opfergaben. Die Stoffstreifen oder »Wind-Gebete« bringen dem Wanderer Glück, der den Paß zum erstenmal überschreitet. Ist es, weil wir den Steinhaufen nicht beachten, daß uns die Berggötter einen heftigen Hagelschauer entgegenschicken? Das Prasseln der Hagelkörner versiegt langsam, während die Wolken wieder aufreißen. Wir warten. Tukten, der eine Stunde nach uns ankommt, ist den anderen immer noch um eine gute halbe Stunde voraus, wird aber ungerechterweise bei seinem Eintreffen von GS als bleifüßiger Träger beschimpft. Gelassen setzt Tukten seine Last ab, die er siebenhundert Meter den Berg heraufgeschleppt hat, und sieht GS mit dem gelassenen Blick ins Gesicht, mit dem er alles betrachtet, was ihm begegnet. Dann wendet er sich ab und legt als Dank für die sichere Ankunft auf dem Paß einen kleinen Stein auf den Gebetshaufen.
Endlich treffen die Tamang ein, hinter ihnen kommen die Leute aus Tarakot. Wir steigen in eine steile Spalte mit einem Rinnsal hinab, wo die Träger ihre Körbe absetzen und ein Feuer für ihre erste Tagesmahlzeit anzünden. Wir haben zwar Verständnis für eine Rastpause nach der schweren Kletterei, nachdem wir aber bereits anderthalb Stunden gewartet haben, sind wir doch ziemlich sauer darüber. Wie immer schimpfen wir darüber, daß die Träger ihre Hauptmahlzeit nicht vor dem Aufbruch zubereiten, wenn ohnehin noch die Lagerfeuer brennen und genügend kochendes Wasser vorhanden ist; der bis zu zwei Stunden dauernde 97Aufenthalt kostet uns jedesmal wertvolle Tagesstunden und zwingt uns, abends in Dunkelheit, Kälte und Regen das Lager aufzuschlagen.
Das schleppende Tempo bringt GS schier zur Verzweiflung; wenn wir nicht rascher vorwärtskommen, werden wir die Herbstbrunft der Blauschafe verpassen. Aber die Träger haben bereits gesehen, daß am Nordende des Tals Schnee liegt; wir können sie treiben, wie wir wollen, weiter als bis zur Schneegrenze werden sie an diesem Nachmittag nicht gehen.
GS tigert unruhig auf und ab und nörgelt dabei, Phu-Tsering verschwende den Zucker und koche zu viel Reis statt Kartoffeln, die schwerer und außerdem in dieser Gegend noch zu beschaffen sind. Die fröhlich-unbekümmerte Art unseres Kochs bringt ihn manchmal in Rage, obwohl er von seiner früheren Expedition mit Phu-Tsering sehr wohl weiß, daß sein unverwüstlicher Frohsinn schwerer wiegt als alle seine Fehler. Die Sherpa nehmen die gelegentlichen Tadel von GS gutgelaunt hin. Sie wissen, daß er ihre Gefühle achtet und um ihr Wohlergehen besorgt ist, und er läßt sich nur selten von ihrem kindlichen Verhalten provozieren.
Da es von hier ab bis jenseits des Jang-Passes kein Gehölz mehr gibt, sammeln wir Birken- und Rhododendronreisig, dazu trockene Bambusstämme; der Bambus sprießt hier alle zwölf bis dreizehn Jahre und stirbt dann wieder ab. Unter überhängendem Gestein entdecke ich halbverkohlte Holzscheite, die eine andere Reisegesellschaft zurückgelassen hat, und binde sie mir zu den anderen Ästen auf den Rucksack.
Der Pfad folgt jetzt unter überhängenden Felsen einem Sturzbach, der Seng Khola genannt wird. Das Donnern der grauen Wassermassen und das Halbdunkel der Klamm erzeugen eine Stimmung, in der es mich nicht wundern würde, wenn plötzlich das Gesicht eines Berggottes über die scharfe Oberkante der Schlucht lugte. Hinter uns kriechen Wolken die Schlucht herauf, und zur Abwechslung sieht der Himmel in unserer Marschrichtung einmal freundlich aus. Eine breite Sonnenbahn, die den Schnee am Oberlauf des Seng Khola aufleuchten läßt, ist ein vielversprechendes Zeichen. Bald fallen, wie an jedem Spätnachmittag, kalte graue Regentropfen. Es wundert mich, daß ich mich in dieser schaurig düsteren Bachlandschaft mit den ausgefransten 98Wasserfällen und den schäumenden Fluten in einer Wüste von nacktem Fels- und Kieselgeröll so wohlfühle. Fröhlich laufe ich durch den Regen und empfinde dabei noch eine eigenartige Dankbarkeit – wofür eigentlich? Der Schatten meines kurzgeschorenen Kopfes auf dem Pfad vor mir gleicht dem eines Mönches, das Klopfen meines Wanderstabes hallt in den Bergen wider; ich fühle mich inspiriert von Milarepa, der, wie einer seiner Schüler schrieb, »frei wie ein ungezähmter Löwe« durch die Schneeberge streifte.
In einer Kehre der Schlucht wartet der Anführer der Tarakot-Leute auf uns. Er hat indische Gamaschen an den Beinen und trägt kein Gepäck. Er deutet auf den felsigen Hang jenseits des Baches. »Na«, ruft er, »Na!« und geht weiter. Oben springt eine helle Gestalt über ein Rinnsal, sechs weitere folgen rasch nach. Die Tiere laufen auf einen Grünstreifen zwischen Fels und Schnee zu. Nahe der Schneegrenze werden sie von den Wolken verschluckt, die uns inzwischen überholt haben. Diese herrlichen, silber-blaugrauen Geschöpfe sind die Bharal, die Blauschafe des Himalaja, auf tibetisch Na genannt, um derentwillen wir die weite Reise unternommen haben.
Wir lagern auf einem flachen Geländestreifen neben dem Fluß, dicht unterhalb der Schneefelder. Ein Taucher stürzt sich ins kalte Wasser, Rotschwänzchen jagen irgendwelche Insekten auf den schwarzen Felsen. Wir sind jetzt auf einer Höhe von über 4000 Meter, berichtet GS, der mir nachgekommen ist; er hat die Blauschafe ebenfalls gesehen. Nachdem die Zelte aufgeschlagen sind, zieht er nochmal los und sieht tatsächlich noch ein paar weitere Tiere. Erst in der Abenddämmerung kommt er zurück und ruft mir enthusiastisch zu: »Die ersten Ergebnisse seit anderthalb Monaten.« Aber auch ich habe von einem Fund zu berichten. Unterhalb des Weges habe ich heute einen Pfotenabdruck bemerkt, so als hätte ein großer Hund den Weg gekreuzt und nur an einer feuchten Stelle seine Spur im weichen Erdboden hinterlassen. Da der Abdruck frisch und keine Gruppe Reisender in der Nähe war, konnte es kein Hund gewesen sein. Im Glauben, dann könne es sich nur um einen Wolf gehandelt haben, hatte ich versäumt, die Zehen zu zählen. »In einer solchen Umgebung könnten durchaus Schneeleoparden vorkommen«, meint GS. 99Auch der Anführer der Tarakotleute will wissen, daß es noch Schneeleoparden in der Jang-Region gibt, aber Tukten schüttelt den Kopf. »Nur auf Dolpo-Seite«, sagt er, »nicht in Nepal.« Dolpo liegt zwar schon auf der Tibetischen Hochebene, gehört aber politisch zu Nepal, und es wundert mich, daß Tukten es als Ausland betrachtet.
In seiner eckigen Art, mehr aus Begeisterung als aus Grobheit, schmeißt GS mir im Vorübergehen wortlos eine Schneebrille ins Zelt, damit ich mir morgen in Sonne und Eis keine Augenschmerzen hole. Vor Aufregung liege ich lange Zeit wach und stecke den Kopf zur Zeltöffnung hinaus. Die Nacht ist überklar und sehr kalt. Kurz vor dem Morgengrauen färbt sich der Himmel über den Bergen blauschwarz, ehe der erste Lichtschein aufglimmt.
Vor Sonnenaufgang brechen wir auf, überqueren den Sturzbach auf gefährlich eisglatten Felsen und folgen dem Seng Khola weiter nach Norden. In der öden Schneelandschaft weiter oben finden wir Abdrücke nackter Menschenfüße. »Yeti«, sagt GS spöttelnd, obwohl auch ihn der unerwartete Anblick überrascht, beunruhigt. Irgend etwas scheint in der eisstarren Schattenwelt, in die noch kein Sonnenstrahl dringt, auf uns zu warten. Plötzlich kommt diese Welt in Bewegung. Unter den überhängenden Felsen am anderen Flußufer taucht im fahlen Licht eine Gestalt in einer braunen zerrissenen Kutte mit Kapuze auf, in den Händen ein Wanderstab – ein Sennin, ein wilder Bergeinsiedler. Er schwingt seinen Stock, doch wir verstehen nicht, was er uns über das tosende Wasser zuruft.
Dann erkennen wir zu unserem Erstaunen Bimbahadur unter der Kapuze, der uns mit beiden Händen zuwinkt und auf den Weg deutet. Später hören wir, daß er am Vorabend fünf Kilometer weitergegangen ist, um allein in einer ihm bekannten Höhle zu übernachten, jetzt mußte er zurück, um seine Traglast zu holen. Nur um einige Nachtstunden in Einsamkeit verbringen zu können, nimmt der älteste und langsamste unserer Träger eine 100beschwerliche Wegstrecke von zehn Kilometer zusätzlich auf sich.
Wir verlassen den Fluß und steigen nach Nordwesten auf.
Weiter oben, wo der Schnee einige Stellen frei läßt, springt ein Bergfuchs zwischen den Grasbüscheln hervor und läuft zu einer Felsengruppe, wo er sich umdreht und zurückschaut. Der rostrote Pelz mit schwarzen Tupfen geht an der Stirn und an der Brust in Hellgrau über, der außerordentlich lange buschige Schwanz ist braunschwarz mit einer weißen Spitze, die noch lange erkennbar ist, nachdem die dunkleren Körperfarben des Tieres längst mit der steinigen Umgebung verschmolzen sind.
Nur langsam senkt sich das Licht von den oberen Bergwänden herab. Hinter uns liegt noch der Schatten der Nacht. Auf die Sonne wartend setze ich mich auf einen trockenen, mit Flechten überwachsenen Granitklotz, der wie eine Insel in Schnee und Eis aufragt. Drei Schneetauben fliegen vorbei, ihre weißen Flügel knattern in der frostigen Luft. Im Osten schimmert ein Gipfel des Dhaulagiri in einer Aura von Sonnenstrahlen. Nun endlich schiebt sich die Sonne auch für mich sichtbar an den Himmel, weißglühend im wolkenlosen Blau, das sich hell und warm über Indien, über Tibet aber eisig und tiefblau breitet, ein durchsichtiges, klirrendes Blau von unbeschreiblicher Intensität. (Und doch blieb jenes Blau lange Zeit völlig unerwähnt, in den vielen Hunderten Anspielungen auf den Himmel, die im Rigveda, in den griechischen Epen und in der Bibel vorkommen, ist nie von diesem überirdischen Himmelsblau die Rede.)[38]
GS erklärt mir als erfahrener Bergsteiger, daß ich den Stock kurz fassen und auf der Hangseite führen soll, um ihn durch die Firnkruste stoßen zu können, falls ich ausgleiten sollte, denn der Hang ist steil und der Steig glatt. Mitten im Satz hält er inne, läßt sich auf ein Knie nieder und sucht in seinem Rucksack nach dem Fernglas. Auf einem schneebedeckten Grasflecken scharren vier Bharal-Böcke nach Futter. Von dort aus klettern sie auf den Grat, so daß sich ihre Köpfe mit den mächtigen Hörnern scharf gegen den Himmel abzeichnen. Hocherfreut werten wir die Verträglichkeit der Böcke untereinander als Zeichen dafür, daß die Herbstbrunft noch nicht begonnen hat und wir vielleicht noch zur rechten Zeit in Shey Gompa eintreffen.
101
Heute fällt mir das Steigen schwer. Der Pfad ist gefährlich, die Luft dünn, die Helligkeit blendet mich und ich breche manchmal bis zur Hüfte in den verharschten Schnee ein. In der nächsten Stunde entfernt sich GS, der vorangeht, immer weiter von mir, bis seine blaue Parka im weißen Geglitzer schwarz aussieht. Die schemenhafte Gestalt umrundet eine weiß aufragende Pyramide – ich bin allein.
Aus dem Nichts kommt ein leises Flüstern. Wenn der Schnee von den hohen Felsen herunterstäubt, tanzen zarte Eiskristalle im Licht. Ein kleiner weißer Falke fliegt in Richtung Tibet. Schwindelig vor Erschöpfung und vom In-den-Himmel-Starren hole ich tief Atem: im Himalaja gibt es keine weißen Falken. Aber später entdecke ich einen Zwergfalken mit schwarzen Rückenfedern und hellem Bauch, im blendenden Licht über mir kann mir sein Artgenosse wie ein rein weißer Vogel vorgekommen sein.
Die Schneefelder schwingen sich in glitzernden Kurven ins Blau. Die steigende Sonne taut den Schnee an, ich sacke immer häufiger durch die Kruste und bleibe alle paar Schritte stehen, um nach Luft zu schnappen. Spät am Vormittag, nach vierstündigem Aufstieg erreiche ich den Grat und gehe sofort in die Hocke, um mich vor dem schneidend kalten Wind zu schützen. »Geschafft!« rufe ich GS zu, der sich durchs Fernglas umschaut. »Dies ist wohl kaum der Paß«, sagt er, »es geht nicht weiter.« Hinter dem Grat geht es fast senkrecht hinab in eine tiefe Schlucht, tief unten sehen wir die Träger im Gänsemarsch nach Nordwesten durch die Schlucht aufsteigen. Unser vierstündiges Klettern bis in eine Höhe von über 4500 Meter war vergeblich. Jetzt wissen wir, warum Bimbahadur so heftig winkte, wir müssen unseren Fußstapfen wieder nach unten folgen und durch die Schlucht erneut aufsteigen.
Auch der Anblick der strahlenden Gipfel des Churen Himal und des Putha Hiunchuli, die jetzt nicht mehr nördlich, sondern östlich von uns liegen, kann mich nicht trösten. Wir essen schweigend ein Stückchen Hartwurst und eine Handvoll Erdnüsse und suchen dann entlang dem Grat nach einem sicheren kürzeren Abstieg. (Die Ansichten von GS über die Sicherheit eines Abstieges stimmen nicht ganz mit den meinen überein. Sein Schritt 102und sein Gleichgewichtssinn sind durch viele Exkursionen ins Hochgebirge unglaublich sicher, während es mit meinen Fähigkeiten nicht so weit her ist. In einer der ersten Erinnerungen an GS sehe ich ihn 1969 in Ostafrika in böigem Wind seelenruhig auf der äußersten Kante eines turmhohen Felsens stehen, wo er mit demselben Fernglas die Serengeti-Steppe absuchte.)
Wir überraschen eine Herde Blauschafe, die im Schnee dösen. Die Tiere springen auf wie ein Tier, nur wenige Schritte entfernt. Wildschafe sind nicht sonderlich scheu, wenn man sich ihnen von oben nähert, da sie darauf konditioniert sind, Gefahren von unten zu erwarten. Die schönen silberblauen Tiere schauen uns gelassen an, ehe sie davonziehen, so daß GS ihr Alter und Geschlecht bestimmen und sie sogar ausgiebig fotografieren kann. Die Daten kritzelt er gleich in sein Notizbuch. Ein weißgraues Himalaja-Schneehuhn segelt an uns vorüber. Weshalb es wohl so weit in die Schneeregion heraufgeflogen ist?
Eine Stunde später, nach einer Rutsch- und Stolperpartie in die Schlucht hinunter, steigen wir erneut in nordwestlicher Richtung auf. Die Sonne brennt im Windschatten heiß durch die dünne Luft, und in diesem Ineinanderfließen von Weiß und Blau fühle ich mich schwindelig und trotz Schneebrille halbblind. Von meinen Beinen spüre ich nichts mehr, bei jedem Schritt versinken wir bis zu den Knien in den matschigen Schnee. Der einzige Trost ist eine Art grimmiger Erleichterung darüber, daß der Kerl mit den Ponys sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht hat; die Tiere hätten diesen Weg nie bewältigt und wir wären mit sieben zusätzlichen Lasten im nassen Schnee festgesessen.
Wieder auf 4200 Meter Höhe wird der Steig etwas flacher, der Weg führt jetzt quer über die Schneefelder. Nachmittags versinkt die Sonne hinter einem Bergrücken, taucht aber eine Stunde später im tiefen Spalt einer Kluft für wenige Augenblicke wieder auf, um dann endgültig zu verschwinden. Im Halbdunkel überqueren wir den Saure Khola und kampieren auf einem Felsvorsprung. Den ganzen Nachmittag sind wir den Spuren der Träger gefolgt, einer hatte im Schnee eine Blutspur hinterlassen. Wie sich nun herausstellt, hatte Pirim seine Segeltuchschuhe nicht angezogen und sich die Füße an der Eiskruste aufgeschnitten. Die Blutspur gab uns zu denken, ob die Träger sich wohl gegen 103die Schneeblindheit geschützt hätten? Als wir sie endlich überholten, war es zu spät für eine Warnung. Abends klagen zwar drei Leute über leicht brennende Augen, aber sie machen einen durchaus fröhlichen Eindruck und drängen sich um das Fernglas, durch das Blauschafe auf einem hohen Kamm zu sehen sind. Die Tamang bauen sich einen Windschutz in den Resten einer halbzerfallenen Hütte, der Anführer der Tarakot-Leute darf die Nacht im Zelt der Sherpa verbringen, während seine Leute sich in alte Decken gehüllt zwischen den Schneewehen zusammenrollen, ohne Schutz gegen die bitterkalte lange Nacht. Sie bemühen sich auch nicht darum, sich einen Unterschlupf zu bauen, nicht einmal Feuerholz haben sie mitgebracht, und bekommen von unserem Reis eine Portion ab. Übrigens laufen die meisten von ihnen barfuß.
Gestern abend habe ich bei GS im Zelt gespeist – in meinem Zelt haben zwei Leute nicht Platz –, und obwohl mich der Tag im Hochgebirge in beste Stimmung versetzt hatte, machte mir die Höhe zu schaffen; die Welt schien um mich zu kreiseln, ich hatte starke Kopfschmerzen und ein steifes, von Wind und Sonne ausgedörrtes Gesicht. Heute morgen geht es mir besser, aber nun sind die armen Träger übel dran. Alle klagen über Schneeblindheit. Diese recht unangenehme Überreizung der Hornhaut des Auges durch zu starke Sonne kündigt sich vorher kaum an, und es gibt kein anderes Heilmittel dafür als die Zeit. Die Augen fühlen sich dabei an, als hätte einem jemand eine Handvoll Sand hineingeworfen. Die Leute aus Tarakot blasen einander jämmerlich durch ein Tuch in die Augen. Es scheint nicht viel zu nutzen, sie weigern sich, die Lasten aufzunehmen, und stolpern schließlich davon, Richtung Heimat.
Auch unsere Tamang-Träger können kaum sehen und die Sherpa sind ebenfalls betroffen, obwohl sie es hätten besser wissen müssen. Nur Phu-Tsering schaut fröhlich drein wie immer. »Solu«, sagt er, während er auf Dawa und Gyaltsen deutet, und klassifiziert sie damit als Talbewohner; sie sind keine echten Gebirgsleute 104wie er selbst. Phu-Tsering stammt aus Khumbu südwestlich vom Everest, die Heimat vieler Hochgebirgs-Sherpa, er hat eine französische Expedition zum 8475 Meter hohen Makalu (1971) und eine deutsche Gruppe zum Manaslu (1973, 8156 Meter hoch) begleitet und besitzt alle möglichen Zeugnisse. Der Koch besitzt eine eigene Schneebrille, der sonst ziemlich unbedachte Jang-bu hat sich eine von GS geliehen, während Tukten und zwei Tamang-Träger so klug waren, sich Lappen mit eingeschnittenen Schlitzen über die Augen zu binden. Warum haben die anderen nicht auch so viel Vernunft gehabt? Verägert meint GS, daß er sich immer wieder nur darüber wundern kann, wie wenig sich die Völker im Himalaja ihrer Umgebung angepaßt haben.
So sitzen wir wieder einmal einen Tag fest, vielleicht auch länger. Im Gegensatz zu den Leuten aus Tarakot erklären sich unsere tapferen Invaliden bereit, mit einer leichteren Traglast weiterzugehen, wenn sie auch torkeln und stöhnen, sooft wir in ihre Richtung schauen. Sie binden sich nun Lappen übers Gesicht und lassen sich von Jang-bu wie eine Reihe von Blinden durch den Schnee davonführen. Der stets gelassene und unverdrossene Jang-bu hofft, morgen mit anderen Trägern aus Tarakot zurückzukommen. Phu-Tsering bleibt bei uns, um zu kochen und das Lager zu bewachen, und Bimbahadur, der völlig daneben ist, bleibt ebenfalls im Lager. Mit zugeschwollenen Augen und zitternden Knien sieht er aus, als hätte ihn ein Fluch über Nacht in einen Greis verwandelt. Als wir die Träger gestern überholten, war Bimbahadur kurz vorher gestolpert und hingefallen, so daß Phu-Tsering und Jang-bu die aus dem Korb gekippte Last aus einer tiefen Eisspalte heraufholen mußten. Nun legt GS ihm einen Umschlag aus Teeblättern auf die geschwollenen Lider, später gebe ich ihm etwas Salbe für die aufgesprungenen Lippen, und der arme Alte, der nur aus Gefälligkeit mit uns weitergezogen ist, jammert auf seinem harten Strohlager in der zerfallenen Hütte über die Beschwerlichkeit des Lebens.
GS regt sich zwar wegen der verlorenen Zeit und der zusätzlichen Kosten auf, aber immerhin gibt es in der Gegend Blauschafe, und so macht er das Beste aus unserer Situation. Nachdem wir die Zelte erneut aufgeschlagen haben, steigen wir einen steilen Hang hinauf, auf dem es wegen seiner Südlage offene 105Grasflecken gibt. Ein auf Beutefang bedachter Bergfuchs läßt sich durch unsere Gegenwart nicht stören, in acht Minuten schnappt er sechsmal zu, viermal mit Erfolg, obwohl die Beute klein ist: eine Maus, zwei große Heuschrecken und etwas seltsam Langes und Dünnes, das heftig zappelt; wir können es durch unser Fernrohr nicht erkennen. Das Rätsel löst die steigende Sonne: ich entdecke einige glänzende, graugestreifte Eidechsen. Trotz der verfrühten Schneefälle ist der herbstliche Berghang voller Leben; Samenkörner und Myriaden von Insekten in den Schneewehen locken nicht nur eine Schar Rotschwänze an, sondern auch einen gemischten Vogelschwarm aus Piepern, Lerchen, Rosenfinken und einigen anderen Arten. Zwergrhododendron, Edelweiß, Blauer Enzian kommen hie und da noch vor, weiter oben in Höhen über 4500 Meter tragen die aus Eis und Schnee hervorragenden Steine helle Flechten in allen Farbschattierungen. Die weiße Fläche ist mit Spuren von Schneehuhn, Blauschaf, Fuchs und allerhand Kleingetier übersät, nach den Abdrücken eines Schneeleoparden halten wir allerdings vergeblich Ausschau. Ohne ein Wort zu sagen, geraten GS und ich allmählich auseinander, wie auch meist an den Marschtagen; GS geht drei Blauschafen nach, während ich auf eine Stufe an einem hochaufragenden Steinkegel klettere. Ich setze mich in eine mit Flechten ausgekleidete Nische und betrachte so, vor kalten Winden geschützt, die stillen weißen Berge im Süden. Sonne und Licht bestimmen hier so sehr das Kleinklima eines Ortes, daß die Nordhänge, auf die ich blicke, bis hinab zum Fluß mit einer Schneedecke überzogen sind, während hier, auf der nach Süden geneigten Seite, der Boden offen ist. Das jenseitige Ufer des Saure ist von Eis überkrustet, während hüben, nur ein paar Meter weiter, sich Heuschrecken und Eidechsen im warmen Gras tummeln.
Über mir schrauben sich Weißkopfgeier ins Blau. Wie still diese Vögel sind. In meine kleine Aussichtskanzel dringt kein anderer Laut als das ferne Rauschen des Flusses.
Nach einer Weile verlasse ich meinen Sitz und steige quer über den Berg zur Nordkante hinauf, wo ich mir das Tal genau ansehe, das zum Jang-Paß führt, dann kehre ich wieder zurück. Phu-Tsering erwartet mich im Lager mit warmen Tschapatis und heißem 106Wasser, mit dem ich mich in der Sonne wasche. Seine Amulette sind ihm aus dem Hemd gerutscht, als ich danach frage, steckt er sie verlegen fort: die habe er von seinem Lama bekommen, murmelt er. Seine Befangenheit weicht, als ich ihm mein »Amulett« zeige, einen Talisman, den mir der Zen-Meister Soen Roshi, »mein Lama in Japan«, geschenkt hat. Phu-Tsering bewundert den glatten Pflaumenkern, auf dem die zehn Sätze eines vollständigen Sutra mit winzigen Schriftzeichen eingeschnitten sind. Seine Ehrfurcht nimmt zu, als er hört, das Sutra preise einen Bodhisattva, wohl die am meisten verehrte mythische Verkörperung des Buddha, die Phu-Tsering unter dem Namen »Tschenrezigs« kennt, den Schutzpatron Tibets, der mit dem Mantra om mani padme hum angerufen wird. In der japanischen Sutra auf dem Pflaumenkern heißt der Bodhisattva Kanzeon oder Kannon (in China Kuan Yin, in Südostasien Quon-am). Die Hindus nennen ihn Padmapani, in Sanskrit ist er Avalokiteshvara, der »Herr, der (voll Mitgefühl) herabblickt«. Wie alle Bodhisattvas verkörpert Avalokiteshvara das Göttliche im eigenen Inneren, das von den Mystikern aller Religionen gesucht wird und auch »der Herr, der im Innern geschaut wird«, genannt wurde.[39]
Wie die meisten gläubigen Buddhisten rezitiert Phu-Tsering sein om mani padme hum jeden Tag und immer, wenn er in Gefahr oder Schwierigkeiten ist. Er hat Angst vor Dämonen und fürchtet sich im Dunkeln. Als er einmal nachts in Ostnepal unmittelbar hinter GS ging, sang er dieses Mantra so unablässig, daß GS ihn am liebsten über die Felskante hinuntergeworfen hätte. Doch die gläubigen Buddhisten sind davon überzeugt, daß die Anrufung einer Gottheit durch das Mantra den Schutz dieser Gottheit heranzieht, und da das om mani padme hum dem großen erbarmungsvollen Tschenrezigs gewidmet ist, findet man es überall auf Gebetssteinen, Gebetsmühlen und -fahnen und auf vielen Felsen im buddhistischen Teil des Himalaja.
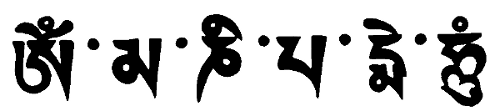
107
Auf tibetisch etwa Aum Ma-ni Päh-me Hung ausgesprochen, kann man es etwa so übersetzen: »Om! Juwel im Herzen des Lotus! Hum!« Das tiefe, vibrierende Om ist aller Klang und alle Stille der Zeiten, das Brausen der Ewigkeit und die große Stille des reinen Seins; angestimmt mit den vorgeschriebenen Schwingungen ruft es das sonst nicht aussprechbare Ganze an. Mani ist der »unzerstörbare Diamant« der Leere, die uranfängliche, reine, unzerstörbare Essenz des Seins, jenseits von Materie und Antimaterie; es ist alle Phänomene, Veränderungen und alles Werden. Padme – im Lotus – ist die Welt der Phänomene, Samsara, die sich durch geistige Vervollkommnung entfaltet, bis unter den Blättern der Verblendung das Mani-Juwel der Erleuchtung sichtbar wird, das nicht außerhalb des Alltagslebens liegt, sondern in seiner Mitte. Hum hat keine besondere Bedeutung und wird unterschiedlich erklärt (wie überhaupt jedes Wort dieses großen Mantra, über das ganze Bücher geschrieben wurden). Vielleicht ist es nur ein rhythmischer Ausruf als Schluß des Mantra, der den Ausrufenden ermahnt und inspiriert; eine Bestätigung des Seins wie die symbolische Geste des Buddha, als er im Augenblick der Erleuchtung die Erde berührte. Es ist! Es existiert! Alles, was war, ist oder sein wird, ist genau hier. Jetzt!
Ich ziehe nochmals los und setze mich an die Kante der Schlucht. Im Norden ragt ein Eiskegel in den Himmel. Schneefelder wogen wie erstarrte Wellen zum Himmelsblau. Wo der Saure in die Schlucht hinunterstürzt, starrt mir eine Wand drohend entgegen, auf die Schnee und Schatten bizarre Zeichen malen. Die Leere und die Stille der Schneeberge führen rasch zu jenem Bewußtseinszustand, der sich sonst in entrückter Meditation einstellt; zweifellos hat die Höhenlage ihre Wirkung auf mich, denn ich kann die Welt, wie es mir gefällt, als fest oder fließend wahrnehmen. Die Erde pulsiert, das Gebirge strahlt, als ob alle Moleküle darin frei tanzten, der blaue Himmel tönt. Ist es die »Sphärenmusik«, die ich höre, das, was die Hindus den »Atem des Schöpfers« nennen und ein Astrophysiker als das »Seufzen der Sonne« bezeichnete?
Meinen Pflaumenkern, auf dem die Anrufung an den »Herrn, der im Innern erschaut wird«, geschrieben steht, lege ich auf einen Stein vor mir:
108
Kanzeon! Verehrung dem Buddha!
Wir sind eins mit Buddha,
In Ursache und Wirkung mit allen Buddhas verbunden,
Wie auch mit Buddha, Dharma, Sangha.
Unser wahres Bodhisattva-Wesen ist ewig,
Freudig, selbstlos, rein,
Laßt uns anrufen jeden Morgen Kanzeon mit Nen!
Jeden Abend Kanzeon mit Nen!
Nen, Nen tritt hervor aus dem Geist,
Nen, Nen ist nicht vom Geist verschieden.[40]
Kanzeon ist Kannon oder Avalokiteshvara. Ursache und Wirkung ist das Karma, Dharma das große Rad der Lehre vom Prinzip des Universums, das von Buddha Shakyamuni in Gang gesetzt wurde, und Sangha ist die Gemeinschaft aller Jünger Buddhas in Vergangenheit und Gegenwart. »Ewig, freudig, selbstlos, rein« sind die Eigenschaften des Nirvana, in dem der Traumzustand, die »Vielheit« des Samsara in die Erleuchtung, das »Eine« verwandelt wird.[41] Nen bedeutet Achtsamkeit, das Erleben eines jeden Augenblickes mit solch intensiver Bewußtheit, als ob er der letzte wäre. Der Geist ist der allumfassende Geist, aus dem das individuelle Bewußtsein hervortritt und mit dem es eins ist, wie die Welle mit dem Wasser. Die Welle ist nicht ein Produkt des Wassers, sie ist Wasser, in seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen, die nicht dasselbe sind und doch nicht geschieden vom Ganzen.
Im November 1971 nahm ich in New York an Meditations-Exerzitien über das Wochenende in einer Zen-Übungshalle teil. Den ganzen Tag in Lotushaltung zu meditieren kann sehr anstrengend sein, und Deborah, die seit Monaten an unerklärlichen Schmerzen litt, kam deshalb nur am Sonntag zum Sitzen. Als ich am Samstag abend heimkehrte, öffnete sie mir lächelnd die Tür und bot in ihrem neuen braunen Kleid einen entzückenden Anblick. In dem Augenblick sah ich mit völlig wachem Geist, daß sie bald sterben würde. Die Gewißheit dieser hellsichtigen Erkenntnis war so erschütternd, daß ich, ein dringendes Bedürfnis vorschützend, an ihr vorbei ins Badezimmer stürzte, um meine Fassung wiederzugewinnen.
109
Bei der Sutrenrezitation am Sonntag noch vor Morgengrauen, bei der sich die Meditierenden in zwei langen Reihen von Buddhagestalten gegenübersitzen, saß Deborah ausnahmsweise mir direkt gegenüber, was mir noch heute nicht als purer Zufall erscheinen will. Bestürzt von meinem Erlebnis am vorigen Abend, voll Mitleid und Besorgnis um Deborah, sang ich das Kannon Sutra mit solcher Inbrunst, daß ich mich »verlor«, mein Selbst vergaß – was das Ziel des auf japanisch gesungenen Sutra ist, das immer wieder, mit zunehmender Intensität wiederholt wird. Der Sprechgesang der Sangha endet mit einem mächtigen Aufschrei, der dem om! entspricht, darauf folgt absolute Stille, als stünde das Universum still, um zu horchen. Im Halbdunkel des Morgens – nur eine Kerze auf dem Altar brannte im Raum –, in der Totenstille, die mich wie die Stille dieser Berge hier anwehte, schwoll die Stille mit einem Atemzug zur »Präsenz« einer unendlichen Güte, von der ich ein Teil war: in meiner Tagebucheintragung jenes Tages nannte ich diese Präsenz nach vergeblichem Ringen um Worte, die diese Erfahrung beschrieben hätten, »das Lächeln«. Das Lächeln wuchs aus mir heraus und erfüllte den ganzen Raum wie der riesige Schatten meiner eigenen Buddhagestalt, die nun winzig und gewichtslos in der erhobenen Handfläche dieses Buddha-Wesens getragen wurde, dieser unendlichen Steigerung meiner selbst. Denn ich war das Wesen, das lächelte, das Lächeln war mein Selbst. Ich hielt den Atem an, ich brauchte nicht danach zu schauen, denn Es war überall. Aber in meiner Ehrfurcht war keine Furcht enthalten, ich fühlte mich vollkommen sicher, so wie ein »braves Kind«. Wunden, Kanten, Hohlräume, alles war fort, alles geheilt, mein Herz pochte im Herzen der Schöpfung. Dann atmete ich aus und überließ mich einem verzückten Aufgehen in diese Gegenwart, einem friedvollen Gefühl der Geborgenheit, welches so überwältigend war, daß mir Tränen der Erleichterung in die Augen schossen. Auch jetzt, während ich immer noch einen besseren Ausdruck für jenes »Lächeln« oder jene »Präsenz« suche, rührt mich die Erinnerung an jene kurze Zeitspanne wieder an, in der ich zum erstenmal seit längst vergessenen Kindheitstagen nicht allein, kein abgetrenntes Ich war.
Und während sich der Schatten des Buddha-Wesens im Raum 110allmählich verflüchtigte, versuchte ich, meine Dankbarkeit auszudrücken und dem »Es« meine Besorgnis über Deborahs Schicksal mitzuteilen, hielt aber sofort damit inne, in der glücklichen Erkenntnis, daß es nicht nötig war. Nichts brauchte gesagt oder getan zu werden, nichts fehlte, alles war bereits von jeher und für alle Zeiten bestimmt; auch Deborahs Sterben, sogar das, war so, wie es sein mußte. Zwei Wochen später, als ich das Erlebnis meinem Lehrer Eido Roshi beschrieb, erstaunte ich mich selber (nicht aber den Roshi, der nur nickte und eine kleine Verbeugung machte), indem ich gleichzeitig in Lachen und Weinen ausbrach, wobei mir die Tränen leicht und ungehindert über die Wangen liefen, wie ein Regenschauer im Sonnenlicht.
Man ahnt die Wahrheit in der Zen-Lehre, auch dort, wo man sie noch kaum verstanden hat; nun waren meine Ahnungen zu Wissen geworden, nicht durch mein Verdienst, sondern – so schien mir – durch Gnade. Und dieser Zustand der Gnade, der an jenem Morgen im Zendo begann, dauerte den ganzen Winter während Deborahs langem Sterben. Es war eine innere Ruhe, die mich stets genau das Richtige sagen und tun ließ, ohne daß ich meine Kräfte durch Unentschlossenheit oder Kummer erschöpft hätte. Und mein sicheres Handeln erregte offenbar nirgends Anstoß, wohl weil kein Ich im Spiel war, denn der so handelte, war nicht mein »Ich«. Als ich dem Roshi von dieser Bereitschaft und inneren Kraft, ja sogar einer Art verrücktem Überschwang erzählte, nickte er verstehend: »You have transcended.« Er meinte damit wohl »dein Ego transzendiert« und damit Kummer, Schrecken und Schuldgefühle. Als wäre ich aus einem Alptraum der Vergangenheit erwacht, empfand ich, daß mir verziehen worden war, nicht nur von Deborah, ich selbst hatte mir verziehen, und das Gefühl der Verzeihung erscheint mir noch immer als die größte Gnade meines Lebens.
In jenen letzten Monaten mit Deborah war es, als sei die Liebe immer dagewesen und habe stets über den aufgewühlten Wellen geschienen, so wie der Mond, von dem die Zen-Lehre spricht; Liebe war es auch, die das grausame und erschreckende Angesicht, das der Krebs dem Tod verleiht, verwandelte. Eines Tages, als Deborah schon über ihren Zustand Bescheid wußte, sagte sie: »Ist das nicht sonderbar? Ich erlebe eine der glücklichsten Zeiten 111meines Lebens.« Ein andermal fragte sie mich schüchtern, was wohl geschähe, wenn sie plötzlich durch ein Wunder wieder gesund würde: würden wir einander dann so weiterlieben und beisammen bleiben, oder würden die alten, häßlichen Zwistigkeiten wieder aufleben? Ich wußte es nicht und sagte ihr das auch. Wir wollten ehrlich sein in diesen Tagen, außerdem hätte Deborah sich nicht täuschen lassen. Ich zuckte unglücklich mit den Schultern, sie schluchzte auf, dann lachten wir beide herzlich. In diesem Augenblick verstanden wir, wie töricht und überflüssig die Frage war, nicht weil Deborah sterben mußte, sondern weil alle Wahrheit, auf die es ankam, hier und jetzt zugegen war.
Nach Deborahs Tod fürchtete ich, daß der Dämon der Reue mich wieder überfallen würde. Aber das geschah nicht. Auch in den dunkelsten Tagen der folgenden leeren Monate blieb mein Herz ruhig und klar, als wäre alles böse Karma der Vergangenheit an jenem Novembermorgen ausgetilgt worden.
Ich war voller Dankbarkeit jener Gegenwart gegenüber, die mich auf den Tod von Deborah vorbereitet hatte; es war eine andere Dankbarkeit als die, die ich gegenüber Deborah, Eido Roshi, meinen Kindern und Freunden empfand. Ich war mir nicht gerade selbst dankbar, und doch, wo konnte jenes machtvolle Lächeln beheimatet sein, wenn nicht in meinem eigenen Inneren? Als ich verzweifelt das Kannon-Sutra sang, rief ich Avalokiteshvara an, ohne jedoch auf die Worte zu achten, ich sah nur Deborah, die mir jenseits des Mittelganges der Zen-Halle gegenübersaß. Es fiel mir schwer, Avalokiteshvara mit jenem Wesen zu identifizieren, wenn Er nicht auch Deborah war und auch ich selbst – also das, was Meister Eckhart meinte, als er sagte: »Das Auge, mit dem ich Gott erschaue, ist auch das Auge, mit dem Gott mich erschaut.« Und Jesus Christus: »Ich und mein Vater sind Eins.«[42] Gewiß sprachen diese christlichen Mystiker von dem »Herrn, der im Inneren erschaut wird«.
In jenem Jahr hatte ich erst mit der Zen-Praxis begonnen und erwartete noch nichts. Fast ein weiteres Jahr verging, ehe mich eine Bemerkung eines fortgeschrittenen Zen-Schülers darauf brachte, was wirklich geschehen sein könnte. Ich fragte Eido Roshi, der es bestätigte. Aber das Erlebnis eines Kensho oder Satori ist noch keine Erleuchtung, da ein solcher Einblick in das 112»wahre Wesen des Selbst« von sehr unterschiedlicher Dauer und Tiefe sein kann. Manche solche Erfahrungen krempeln das ganze Leben eines Menschen um, während andere lediglich ein erschütternder Augenblick sein mögen, der sich »alsbald wie Nebel verflüchtigt«.[43] Es genügt nicht, den Finger durch die Wand zu stoßen – die ganze Wand muß eingerissen werden! Mein Erlebnis hatte zu früh stattgefunden, und seine Kraft versickerte, Monat für Monat. Das stimmte mich traurig, obwohl ich wußte, daß ich noch ganz am Anfang des Pfades stand und daß ich ohne die Sorge um Deborah diese Erfahrung wohl kaum gemacht hätte, denn eine große Erleuchtung geht nur aus tiefstem Samadhi hervor. In dieser Zeit bekam ich die Einladung zu einer Reise in den Himalaja.
Der Wind trägt weiche Wolken aus dem Süden heran. Dicht neben mir pickt ein Rotschwänzchen im Schnee, ein Schwarm fetter Rosenfinken folgt nach. Ich sitze unbeweglich, aber plötzlich stiebt die ganze Schar wie von einer Windbö hochgewirbelt davon. Ich sehe mich nach der Ursache der Störung um. Kaum zehn Meter hinter mir sitzt ein Falke auf einem Felsen, seine Nackenfedern sträuben sich im Wind, ehe er sich aufschwingt und nach einer für mich unsichtbaren Beute in die Schlucht hinuntertaucht. Dann plötzlich ein großer Lämmergeier, goldener Kopf, schwarzer Kragen – wie ein drei Meter langes Schwertblatt saust er aus dem Norden auf mich zu, verschwindet im Schatten zwischen den Felsen. In einer Kehre des Flusses, in einer versteckten Ecke zwischen aufsteilenden Felswänden, liegt eine grüne Wiese im letzten Sonnenlicht, als läge tief dort unten in der unzugänglichen Schlucht eine verlorene Welt. Noch einmal kommt der große Vogel in Sicht, die Sonne glänzt auf seinem Gefieder, dann ist er verschwunden, mit ihm die Sonne, und die Wiese versinkt im Dunkel. Mit dem Schatten der Nacht steigt die Kälte zu mir herauf.
Ich bleibe noch eine Weile sitzen, bis nur die höchsten Gipfel einen Widerschein tragen. Der Felsblock hinter mir erzittert so schwach, daß ich es ein andermal wohl kaum gespürt hätte. Nochmals rührt sich der Berg, als wolle mir die Erde einen Stups geben. Und noch immer sehe ich nicht.
113
Jang-bu wollte heute mittag wieder da sein, aber anscheinend findet er keine Träger. Statt nochmals einen Tag zu warten, wollen GS und ich mit je einer Traglast über den Paß steigen, während Phu-Tsering und Bimbahadur auf die anderen Sachen aufpassen. Das verschneite Hochgebirgstal ist ein denkbar ungeeigneter Ort, um darin ohne Feuerholz und mit kranken Trägern von einem Schneesturm überrascht zu werden, was allerdings wenig wahrscheinlich ist, denn die vergangene Nacht war so klar, daß sich die Milchstraße wie eine Nebelwolke über die Eisgipfel spannte. Der Monsun ist endlich vorbei, wenn auch zwei Wochen später als gewöhnlich.
Ich breche früh auf und steige dem Sonnenlicht entgegen. Bis jetzt haben wir nur unsere Rucksäcke getragen und die Bücher und andere schwere Sachen den anderen überlassen. Heute tragen wir beide eine volle Traglast mit Schlafsack, Zelt und Lebensmitteln. GS hat außerdem sein Fernrohr und die Kamera dabei.
Während der ersten Atempause auf dem Hügelkamm schaue ich noch einmal in die Schlucht des Saure zurück; komischerweise fühle ich Heimweh nach der grünen Wiese am Fuß der Felswände, die ich in diesem Leben doch niemals aus der Nähe sehen werde. Rasch steige ich weiter, um Höhe zu gewinnen, ehe der Schnee antaut. Ich überquere ein Geschiebe aus vereisten Felsblöcken und klettere dann wieder steil aufwärts. Es ist nicht schwer, den von Jang-bu und den Tarakot-Leuten hinterlassenen Spuren zu folgen, meine Stiefel knarren beruhigend auf der Eiskruste. Bald biegt die Spur in ein langes weißes Tal ab, das zum Jang-La hinaufführt. Wie seltsam, daß der blaue Himmel so viel dunkler ist als die Berge. Im Süden steht die Mondsichel zwischen zwei Gebirgszacken. Um drei Wasserlöcher, die sich wie schwarze Spiegel aus dem Schnee abheben, ziehen sich die Fährte eines Fuchses und Spuren von Schneehühnern. Die Tümpel sind die Quellen eines Gebirgsbaches, der unter der Schneedecke verschwindet und dann über eine Felsnase in die Saure-Schlucht fällt.
Das Weiß in dieser Höhe ist dick und still, nur das gedämpfte 114Glucksen der unterm Schnee versteckten Bäche ist zu hören. Der Mond ruht auf einem weißen Grat. Ich gehe wie in einem sonnendurchfluteten Traum, in flimmerndem Schnee, den der Wind von den Felswänden herabweht.
Auf der Höhe, über der ein paar zerzauste Dohlen kreisen, steht ein mannshoher Steinhaufen. Wenn das hier der Jang-La ist, hat man seine Gefährlichkeit gründlich übertrieben. »Jang« heißt grün, und das bedeutet wohl, daß er nur selten schneebedeckt ist; »La« heißt »Paß«, besser gesagt, die Gottheit des Passes, die den Reisenden hinüber ziehen läßt oder auch nicht. Auch hier sind Stöcke und Stoffstreifen in den Haufen gesteckt, obenauf hat irgendein Wanderer zu Ehren der Gottheit zwei Na-Schädel gelegt. Auf dem Nordhang des Passes zieht sich eine ununterbrochene Schneedecke bis zur Baumgrenze hinunter. GS, der mich auf der Paßhöhe überholt, liest 4540 Meter von seinem Höhenmesser ab, der bis auf dreißig Meter genau ist. In Katmandu hatte man uns gewarnt, der Paß sei fast 5200 Meter hoch. Ferner hatte uns der Anführer der Tarakot-Leute gesagt, der Weg von unserem Lager am Saure bis zur Baumgrenze auf der anderen Paßseite betrage sieben Wegstunden; wir werden die Strecke mit einer vollen Traglast bepackt mühelos in vier Stunden bewältigen. Allerdings sind wir früh aufgebrochen und auf dem hartgefrorenen Schnee rasch vorwärtsgekommen, während die Einheimischen sich lieber durch den Matsch quälen, als aufzubrechen, bevor die Sonne ihr Camp erreicht.
GS ist glücklich und hält mir einen Vortrag über die Freiheit, die man gewinnt, wenn man sein gesamtes Gepäck auf dem eigenen Rücken trägt und nicht auf das kindische Volk angewiesen ist, das zeitlebens in den Bergen wohnt, aber nicht so viel Vernunft besitzt, um die Augen vor dem grellen Licht zu schützen. »Ist dir klar, daß wir mit dem, was wir auf unserem Rücken tragen, eine Woche lang auskommen und dabei eine ordentliche Strecke zurücklegen können?« Ja, er hat recht, auch ich bin glücklich, wie ich ihn so den Berg hinabstapfen sehe. Das Bewußtsein, zwar das Lebensnotwendige, aber keinen überflüssigen Kram mit uns herumzuschleppen, verleiht uns einen ungeheuren Auftrieb. Einfachheit ist das ganze Geheimnis des Wohlbefindens. »Ich konnte nicht einfacher leben«, begründet Neschdanov 115seinen Selbstmord.[44] Der Jang-La liegt hinter uns, meinen Lungen scheint die dünne Luft nichts auszumachen, die Stiefel werden allmählich etwas weiter. Entspannt trete ich den Abstieg an und freue mich an der Aussicht bis hinüber zu den fernen Schatten, unter denen der tief in das Gestein gegrabene Bheri-Fluß liegt. Hinter der Bheri-Schlucht türmen sich steile Hänge zu den weiter im Hintergrund sichtbaren Eiszinnen des Kanjiroba Himal auf; jenseits dieser fernen Gipfel liegt der Kristall-Berg.
Freiheit und Unabhängigkeit – dabei fällt mir unwillkürlich eine junge Frau ein, der ich einmal in einem Geschäft begegnete, wo sie Tauwerk einkaufte. Anderntags stieg sie mit ihrem Mann und einem britischen Freund in einem Ballon von einer Wiese in Long Island auf mit dem Ziel, den Atlantik nach England zu überqueren. Von den drei Leuten sah man niemals etwas wieder. Ihren Ballon hatten sie auf den Namen »Freies Leben« getauft. Vielleicht verstanden die Ballonfahrer unter Freiheit dasselbe, was ein Bergsteiger einmal so beschrieb: »Die Berge waren unser natürliches Betätigungsfeld, wo wir, an der Grenze zwischen Tod und Leben spielend, jene Freiheit fanden, die wir so lange gesucht hatten und die wir so notwendig brauchten wie das Atmen.« Aber nachdem er knapp mit dem Leben davongekommen war, schrieb derselbe Bergsteiger: »Ich sah ein, daß es besser war, ehrlich, als stark zu sein … Ich war gerettet und hatte eine Freiheit gewonnen, die ich nie mehr verlieren werde. Diese Freiheit lehrte mich lieben, was ich vorher gering geschätzt hatte. Ein neues, wunderbares Leben tat sich vor mir auf.«[45]
Die letztere Auffassung von Freiheit steht der meinen näher: ein »freies Leben« als Reise mit wenig Gepäck, ohne Festhalten und Zurückweisen, in gelassener Erwartung der Dinge, die da kommen werden, frei von Abwehrmechanismen. Nicht die unbekümmerte Freiheit jugendlichen Überschwangs, sondern eine Freiheit im Sinne der »verrückten Weisheit«, von der der tibetische Buddhismus spricht, von Camus' »Sprung ins Absurde« mitten in einem Leben der Begrenzungen. Die Absurdität eines Lebens, das vielleicht zu Ende geht, bevor wir es verstanden haben, entbindet uns nicht von der Pflicht, es so mutig und vollständig zu leben wie möglich.
116
Ich bin voller Dankbarkeit, hier zu sein, ja, überhaupt zu sein, denn man braucht nicht in die Schneeberge zu entfliehen, um sich frei fühlen zu können. Ich bin nicht hier, um die »verrückte Weisheit« zu suchen, wäre das der Fall, dann würde ich sie niemals finden. Ich bin hier, um hier zu sein, wie der Fels, der Himmel, der Schnee, wie die Hagelkörner, die plötzlich aus heiterem Himmel fallen.
Krack! Mein Stock bohrt ein blaues Loch in den Schnee.
Den gläsern überfrorenen Berghang bläst ein kalter Wind hinab. Festgefroren auf dem Eis ein vertrockneter Falter, eine Raupe – kein Vogel in dieser Eiswüste, der sie fressen würde. Ein schwarzer Buckel, verborgen unter der Schneedecke, läßt meine Schuhe abrutschen. Dann windet sich der Pfad um eine Bergkuppe und steigt aus dem Winter in das Reich des Herbstes hinab, wo braune Mauersegler über goldenem Laub nach Insekten jagen. Wie ein Bharal springe ich den Hang hinab über Schneeflecken und rote Wildblüten.
GS wartet am Wegrand; er betrachtet die hohen Gletscher am Dhaulagiri-Massiv, das wir auf unserem Weg umgangen haben. »Wir hätten noch nicht aufbrechen sollen«, meint er. »Das hier ist keine Gegend für Blauschafe.« Außerdem ist er unruhig, daß wir Jang-bu noch nicht begegnet sind. Schweigend essen wir. Doch kaum sind wir wieder unterwegs, als unter uns Jang-bu auftaucht. Wie gut, daß wir zwei volle Traglasten mitgenommen haben, denn Jang-bu hat keine neuen Träger bei sich. Tukten, Gyaltsen und ein junger Tamang namens Karsung, der gerne singt, sind mit ihm zurückgekehrt, die anderen waren noch nicht wieder in der Verfassung dazu. Müde von den Strapazen des gestrigen Tages haben sie Tarakot erst spät verlassen. Sie haben Feuerholz, dicke Scheiben Buchweizenbrot und eine Flasche Arrak mitgebracht, die wir gebührend würdigen, ehe die fröhlichen Burschen sich zum Weg über den Jang-La aufmachen. Es ist Nachmittag, erst in der Dunkelheit werden sie beim Lager am Saure anlangen.
Beschwingt folgen wir dem Weg zwischen Almen, hinunter zu trockenen, mit Eichen und Kiefern bestandenen Hängen. Unter uns tut sich das Tal des Bheri auf, das sich in dunklen Schründen nach Norden und Osten schlängelt. Wir schlagen unser Lager auf 117einer sonnigen Terrasse in der Nähe eines klaren Wasserlaufes auf; Rottannen, Fichten und Kiefern stehen hier dicht beisammen.
Ehe die Dunkelheit einbricht, machen wir Feuer und kochen Reis, nach dem Essen klettere ich ein Stück den Berg hinauf, setze mich unter eine Tanne und betrachte die Sterne, die über Tibet aufgehen. In hellem Goldorange steigt der Planet Mars über den nächtlichen Schneefeldern im Nordosten empor. Wie klar sein Licht ist, wie eindringlich und fast zum Greifen nah er strahlt.
Irgendwo tief im Nadelwald ruft eine Eule.
Uuuhuu.
Noch vor der Sonne bin ich auf und zünde ein Feuer an, dann frühstücken wir Porridge und heißen Tee. Ein Tannenhäher rätscht in den Bäumen, bald kommen auch Krähen dazu und fallen krächzend in das nach Harz duftende Nadelgehölz ein.
Da Jang-bu nicht vor dem Abend in Tarakot sein kann, lassen wir uns Zeit. Barfuß laufe ich im Gras und breite meine Sachen feierlich in der Sonne aus. Zum erstenmal seit Wochen wird alles trocken, ein bemerkenswertes Ereignis im Laufe einer Expedition. Dann packe ich meine Habe ein und setze mich eine Weile so hin, daß mein Gesicht im Schatten ist, während Arme und Leib von den wärmenden Strahlen getroffen werden.
Tannenzweige schaukeln in der leichten Brise vor dem Hintergrund dreier Schneegipfel im Nordwesten, um mich herum summen Bergbienen. Ein smaragdfarbener Schmetterling sucht sich mein Knie als Rastplatz aus und trocknet die Flügel mit den schwarzen Pünktchen an der Oberseite in der Sonne, die trotz der frostigen Luft herabbrennt.
In der klaren Luft des Himalaja erscheinen die Berge so nah und herrlich, daß mir vor Bewegung Tränen über die sonnenverbrannten Wangen laufen. Nicht einfach aus übergroßer Empfindsamkeit, auch der Höhenrausch hat mich nicht gepackt. In diesen von Post, Telefon und unnützem Geschwätz ungestörten Wochen 118hat sich mein Kopf geklärt, ich reagiere spontan, ohne Abwehr und Hemmung, auf das, was sich mir darbietet. Meine tiefe Gemütsbewegung erstaunt mich selber, noch vor nicht allzu langer Zeit hätte ich wahrheitsgemäß sagen können, ich hätte in den letzten zwanzig Jahren keine Träne vergossen.
Am frühen Nachmittag steigen wir über Bergwiesen nach Tarakot hinab, einer Ansammlung kleiner Dörfer, die auf Terrassen am Oberlauf des Bheri liegen, nicht weit von der Mündung des Tarap und anderen kleinen Gebirgsflüssen, die vom Dhaulagiri herabkommen. Ehe die Gurkhas den nepalesischen Staat gründeten, war Tarakot die Hauptstadt des alten Königreichs Tichu-Rong (Tal der duftenden Wasser); es wird heute noch von seinen Bewohnern Dzong (die Festung) genannt. Von hier oben sieht Tarakot ganz unwirklich aus, das Licht der Sonne fällt zu weich, zu golden; die Schatten sind schwarz wie auf kolorierten Stichen in einem alten Buch.
Auf einem Hügel, ein wenig über Tarakot, erhebt sich ein Gestell aus hohen Balken, das mit den Symbolen von Sonne, Mond und Feuer gekrönt ist. Braune, weiße und graue Tibetponys grasen unter den im Wind flatternden Gebetsfahnen, die ihr om mani padme hum in den Herbstwind knattern. (Ist es die Fahne, die sich bewegt? Ist es der Wind? Keines von beiden, sagte Hui-neng, der Sechste Patriarch des Chan in China, es ist dein Geist. Der Ausspruch des Sechsten Patriarchen wird bis heute von Zen-Roshis und tibetischen Lamas gleichermaßen hochgeschätzt.)
Der Pfad windet sich zwischen Kartoffelfeldern und Terrassen mit rötlichem Buchweizen in die Tiefe. An einem Hüttengiebel ist ein Fresko-Gemälde in Blau, Grün, Rot und Gold, das sieben Buddhafiguren in symbolischer Haltung als idealisierte Lebensabschnitte des Buddha darstellt. Diesen Buddha-Aspekten, den »Himmlischen Buddhas«, den Bodhisattvas und anderen Verkörperungen der Buddhaschaft hat man verschiedene Namen und Attribute zugeschrieben. Außerdem wird in den Himalaja-Ländern die an sich schon komplizierte buddhistische Ikonographie durch die Einbeziehung lokaler Gottheiten noch verwirrter. Schon seit frühester Zeit hat der Buddhismus, statt die alten 119Religionen auszumerzen, sich diese einverleibt, so daß auch ursprünglich böse Dämonen schließlich zu »Beschützern des Dharma« bekehrt und verehrt werden konnten. In den ersten Jahrhunderten nach Shakyamunis Tod wurden dann gewisse Yoga-Lehren vedischen Ursprungs in esoterische Schriften zusammengefaßt, die Tantras genannt wurden (und manchmal auch als der fünfte Veda bezeichnet werden). Der tantrische Einfluß dieser meditativen Praktiken führte zur Schaffung weiblicher Weisheits-Prinzipien, den Prajnas; jeder der ohnehin schon zahlreichen Götter und Dämonen erhielt einen weiblichen Aspekt zugeordnet. Die Gefährtin des Avalokiteshvara wurde Tara, die als erbarmende Erlösergöttin mancherorts den Kult der männlichen Form verdrängte. Kuan Yin zum Beispiel, wie Avalokiteshvara in China genannt wird, ist eindeutig eine weibliche Gottheit, während der japanischen Kannon entweder überhaupt kein Geschlecht oder aber beide Geschlechter zugeschrieben werden; auf vielen Darstellungen hat sie allerdings eher weibliche Züge. Im Hinduismus wie auch im Mahayana-Buddhismus überwog im sechsten nachchristlichen Jahrhundert die tantrisch beeinflußte Verehrung der weiblichen Aspekte. Diese tantrische Form des Buddhismus gelangte auch nach Tibet.
Es ist geschichtlich belegt, daß ein großer Naldjorpa namens Padmasambhava (»der Lotus-Geborene«) im achten Jahrhundert unserer Zeitrechnung den Buddhismus nach Tibet brachte. Schon vor ihm hatten Yogis aus Nordwest-Indien – Kaschmir, Gilgit und Ladakh – indische Lehren nach Tibet gebracht, aber erst Padmasambhava gelang es, die alte Bön-Religion endgültig von ihrem Platz zu verdrängen und den Buddhismus auf breiter Basis einzuführen. Er brachte die okkulten Yoga-Tantras (die etwa dem Kundalini-Yoga entsprechen), von denen einige der Überlieferung nach aus dem verlorenen Reich Shambala, dem »Land im Norden«, stammen sollen. (Von Padmasambhava selbst wird behauptet, er stamme aus dem »nördlichen Land«, Urgyan oder Udyana, das manchmal mit Shambala, häufiger aber mit dem Gebiet im Norden und Westen des Indus, etwa dem heutigen Afghanistan identifiziert wird.) Ihm werden sowohl die Lehren des Bardo-thödol, des tibetischen Totenbuches, als auch die Gründung der Nyingmapa-Sekte, der »Alten Schule« des 120tibetischen Buddhismus zugeschrieben, welche später jene tantrischen Praktiken entwickelte, die nach abendländischen Maßstäben als dekadent und orgiastisch gelten. Obwohl er die Bön-Magier unterwarf, ließ Padmasambhava doch – ganz nach buddhistischer Tradition – zu, daß einige der lokalen Gottheiten und damit auch eine Reihe magischer Praktiken des Bön-Glaubens in die Nyingmapa-Lehre Eingang fanden. Dazu gehören auch die schauerlichen Chöd-Zeremonien, die sich schon in den vorbuddhistischen tibetischen Manuskripten finden, welche als »Herztropfen aus dem großen Raum« bekannt sind.[46] Die Chöd-Riten dürften jedoch noch älter sein als der Bön-Glaube und auf uralte Opferzeremonien und exorzistische Rituale zurückgehen. Auch die höchste Buddha-Verkörperung der Nyingmapa mit dem Namen Samantabhadra hat ihre Wurzeln in einer uralten Gottheit, die vermutlich eng verwandt ist mit den gewaltigen Himmelsgöttern Zeus, Jupiter und dem Dyaus pitar der Arier, die auf eine Urgottheit der asiatischen Kulturen zurückgehen.
Im chinesischen und japanischen Buddhismus werden nur wenige Bodhisattvas und der geschichtliche Buddha, Shakyamuni, dargestellt; insbesondere die Sekte des Chan oder Zen hat entsprechend ihrem einfachen, klaren Stil den größten Teil dieser Ikonographie fallengelassen. Im Bestreben, alle Frömmelei zu meiden und das freie Denken und den Zweifel zu fördern, macht das Zen ausgiebigen Gebrauch von Widersprüchen, Humor und Respektlosigkeit; in einer bekannten Zen-Geschichte lobt es den Mönch, der, als es ihm kalt war, das hölzerne Altarbild Buddhas verheizte. Der tibetische Buddhismus hingegen, der sowohl das hinduistische Pantheon als auch das des Bön-Glaubens aufgenommen hat, muß den mannigfaltigen Buddha-Aspekten und Manifestationen seine Aufmerksamkeit schenken, die je nach Sekte einen unterschiedlichen Rang und Wirkungsbereich erhalten haben. In abgelegenen Winkeln des Himalaja wie hier in Tichu-Rong hängt das Volk der Nyingmapa-Richtung mit den alten Bön-Relikten an; so flattern denn hier auch die buddhistischen Gebetsfahnen in den Himmelsfarben Weiß und Blau der alten Bön-Götter im Wind, und im Stupa von Tarakot sind Samantabhadra und Padmasambhava, der Gründer der Nyingmapa-Sekte, dem Buddha Shakyamuni übergeordnet.
121
Eine Stupa ist ein heiliger Kultbau oder Reliquienschrein, dessen Form auf das Grabmal Buddhas zurückgeht, der aber heute die gesamte Existenz symbolisiert. Über einem viereckigen roten Unterbau (das Symbol der Erde) erhebt sich eine große weiße Kuppel (Wasser) mit einer konischen Spitze (Feuer), darauf sitzt eine Mondsichel (Luft) und eine Sonnenscheibe (Raum). Solche Monumente findet man im Himalaja überall als Schutz an den Einfahrten von Dörfern und Städten. Die größeren Stupas haben im Inneren einen Raum, der als Andachtsstätte dient und der mit Mandalas und Fresko-Gemälden geschmückt ist. So ist zum Beispiel die Westwand in der Stupa von Tarakot mit den Bildnissen von drei Bodhisattvas bemalt, während die Ostwand drei Buddha-Abbildungen trägt: den Buddha des vergangenen Weltzeitalters (Dipankara, der Lichtspendende), den historischen Buddha (Shakyamuni) und als dritten den kommenden Buddha (Maitreya, der in der Gegenwart als Bodhisattva lebt und in einem kommenden Zeitalter als Buddha wiedergeboren wird).
Die Tibetisch sprechenden Einwohner von Tarakot sind keine Bhotyas, sondern Magar, die vor langen Zeiten aus den Ebenen in den Flußtälern aufwärts gewandert sind und den Buddhismus angenommen haben; möglicherweise kamen ihre Ahnen als Flüchtlinge während der Religionskriege im zwölften Jahrhundert, als der Islam sich in Indien verbreitete und dort den Buddhismus auslöschte. Die Häuser von Tarakot sind mehrstöckige Steinbauten mit flachen Dächern, auf denen Gebetsfahnen wehen. Die Frauen tragen sowohl die Messingohrringe der Talbevölkerung wie auch die gestreiften Decken der Bergleute, die ärmeren Männer kleiden sich nach Art tibetischer Hirten, während der Dorfvorsteher, dem wir nördlich von Yamarkhar begegnet sind, wie ein Hindu aus der Stadt angezogen ist.
Dawa und die kranken Tamang erwarten uns in seinem Haus, das abgesehen von seiner Größe typisch für die hiesigen Bauten ist. Das Erdgeschoß dient als Stall für Rinder, Ziegen und Schafe, der einzige Zugang zu den oberen Stockwerken führt über eine schmale Balkentreppe, deren oberes Ende von einem wütenden Kettenhund bewacht wird. Das Lehmdach des Stalles ist der Fußboden des nächsten Geschosses, das sowohl von den Hausleuten 122als auch von Kitzen, Lämmern und Kükenscharen bewohnt wird. Die Küken laufen frei herum, nur während der Nacht werden ihnen Weidenkörbe übergestülpt, die tagsüber als Behälter für Rückenlasten benutzt werden. Das Haus betritt man durch ein Loch in der Wand, das ein ganzes Stück über dem Boden liegt (ähnlich den alten Anasazi-Bauten in Mesa Verde und anderen Ansiedlungen im Südwesten Amerikas). Große runde weiße Flecken schmücken die Wände, in denen unregelmäßig verteilte Fenster für etwas Licht in den äußeren Zimmern sorgen; die Zimmer im Inneren des Hauses sind fast völlig dunkel. In die Enden der Deckenbalken sind Tierköpfe geschnitzt; Schaffelle, Kalebassen und getrocknetes Fleisch hängen davon herab.
Von der Terrasse des Stalldaches gelangt man wiederum über eine Leiter in den zweiten Stock. Hier sind Hühner und Hühnermist nicht geduldet. Auf Strohmatten und selbstgewebten Leinentüchern liegt Buchweizen, Gerste, Mais, Erbsen, Hanf und Hirse zum Trocknen ausgebreitet, ein Mann schichtet große gelbe Kürbisse in einer Ecke auf. In den letzten Herbsttagen vor dem Schneefall sind überall auf den Dächern Leute damit beschäftigt, die Wintervorräte nochmals in der Sonne zu wenden. Heu für die Tiere und Brennholzscheite werden zu Stapeln geschichtet. Nach dem Worfeln des Buchweizens wird auch die Spreu als Winterfutter gelagert, ebenso die Rückstände des Chang, eines Bieres, das in großen Holzfässern aus Gerste vergoren wird, denn in dieser alten Wirtschaftsform darf nichts verkommen.
Verlegen reicht Dawa uns bei der Ankunft Tee, seine Augen sind immer noch geschwollen. Die Tamang springen von ihren Schlafmatten auf, und Pirim (Pirimbahadur Lama; die Tamang nennen sich selbst »Lama«) stürzt sich unaufgefordert auf mein Gepäck, um meine am Morgen schon längst getrockneten Sachen nochmals in der Sonne auszubreiten, wofür ich ihm herzlich danke. Es schmeichelt ihm, daß ich ihn mit etwas spöttischer Ehrfucht als »Lama« anrede, als ob er mein Guru wäre. Aber auch die anderen, noch halbblinden Tamang stolpern diensteifrig herum. Am späten Nachmittag treffen die Sherpa mit Bimbahadur ein, der den Sahibs in altgewohnter Weise salutiert und sich gleich darauf aufs Ohr haut.
123
Schon früh am Nachmittag liegt Tarakot im Bergschatten, während die Berghänge an der anderen Seite des Bheri noch in der vollen Sonne liegen. Bei einfallender Dämmerung sammeln Frauen die Vorräte von den Dächern in grob gewebten Säcken ein. Die Bergspitzen röten sich schon, als Hütejungen die Kuh-, Schaf- und Ziegenherden von den Bergweiden herabtreiben. Hähne krähen, Hunde bellen, dazwischen das Rufen und Pfeifen der Dörfler: es sind vertraute Laute, wie sie überall und zu allen Zeiten in Bergdörfern zu hören sind. Nur das Plärren eines Transistorradios, das aus dem Haus des Polizeipostens schallt, zeigt an, daß Tarakot die Hauptstadt von Tichu-Rong ist. Seit September haben wir diese Art Geräusch nicht mehr gehört. »Ein Hauch des zwanzigsten Jahrhunderts im siebzehnten«, seufzt GS, der sich genau so wie ich über den unpassenden Lärm ärgert.
Gegen sieben Uhr verstummt endlich das Gerät, auch im übrigen Dorf wird es still. Da es nicht regnet, legen wir uns auf das offene Dach schlafen. Wir müssen mit dem kostbaren Kerosin und den ebenso kostbaren Taschenlampenbatterien sparen, und so bleibt uns nichts anderes übrig, als mit der hiesigen Bevölkerung früh zu Bett zu gehen und bei Tagesanbruch aufzustehen.
Eine Weile horche ich in die Nacht hinaus. Eine Fledermaus huscht vorüber, die Sterne glänzen auf. Bald geht der Mars über den Bergen im Norden auf, wo der Fluß Tarap aus dem Dolpo-Gebiet herunterfließt. In der molligen Wärme meines Schlafsackes geborgen, schwebe ich unter der runden Kuppel des Himmels. Über mir die glitzernde Milchstraße, wie ich sie aus meiner Kindheit kenne; in der westlichen Welt wird sie inzwischen von der Luftverschmutzung und dem Widerschein der künstlichen Beleuchtung verschleiert. Ob meine Enkel noch die Macht, den Frieden und die heilende Kraft der Nacht kennen werden?
Immer wieder wache ich kurz auf und sehe dem Karussell der Sterne zu. Orion steigt auf, die Plejaden. Sternschnuppen ziehen helle Streifen am dunklen Himmel, und gegen vier Uhr morgens wandert sogar ein Satellit über das Firmament, wie eine Sonde aus einer anderen Welt.
Ein Pferd wiehert.
Der Mars senkt sich zum Jang-La hin, und über Tibet steigt der Mond auf. Was hat er doch an Würde und Geheimnis verloren, 124seit der Mensch seine Spuren auf ihm zurückgelassen hat! Aber für die Hunde von Tichu-Rong ist sein Zauber ungebrochen, und sie heulen abwechselnd ihr Klagelied zu ihm empor. Die großen Doggen schlafen tagsüber und werden in der Nacht freigelassen, damit sie die Dörfer und Gehöfte gegen Wölfe und Räuber verteidigen; in deren Abwesenheit nehmen sie jedoch auch mit fremden Reisenden vorlieb. Da ich mich nicht auf die Straße hinuntertraue, folge ich der örtlichen Gepflogenheit und uriniere bei Tagesanbruch über die Dachkante.
Bei Sonnenaufgang liegen wir noch in den Schlafsäcken. Phu-Tsering bringt Hafergrütze. Später kaufe ich von einem Freund Tuktens, der überall leicht Freundschaft schließt, eine handgewebte, gestreifte Decke aus schwerer Wolle. Unterdessen hat Jang-bu sieben Träger gemietet, so daß wir an diesem Morgen das berühmte Dzong verlassen können.
Bimbahadur wird uns nicht weiter begleiten. Mit Tränen in den Augen salutiert er ein letztes Mal und schluchzt dabei: »Sahib!« Er hat von GS neue weiße Turnschuhe und weiße Skisocken geschenkt bekommen, von denen seine wurzelartigen Beine sonderbar abstechen; sie geben ihm einen seltsamen Anstrich von Festlichkeit, aber oberhalb der Knie ist er wie immer in seine braunen Lumpen und seine schmierige Decke gehüllt. Nun beginnt er, schwer auf seinen Stock gestützt, den Aufstieg über den Jang-La, über die Schneefelder zu seiner Höhle am Seng Khola und von da aus weiter über Yamarkhar und Dhorpatan in seine Heimat am Kali Gandaki.
Der Polizeibeamte von Tarakot hat uns mit betont gelangweilter Herablassung empfangen und verweist uns weiter an seinen Vorgesetzten in Dunahi; offensichtlich besitzt er selbst nicht die Befugnis, uns Schwierigkeiten zu machen. Ehe ihm noch etwas einfällt, sind wir schon auf dem Pfad, der steil zum Bheri abfällt, unterwegs. Auf den Terrassen der Talsenke werden vier verschiedene Sorten eines hirseartigen Getreides angebaut, die vor Jahrtausenden von den Völkern des mittleren Ostens aus Wildgräsern 125gezüchtet wurden. Kürbisse und Bohnen gibt es massenhaft, und in meiner Gier nach frischem Gemüse pflücke ich Feuerbohnen aus ihren Schoten und esse sie roh.
In der Nähe des Flusses ist eine Horde von Himalaja-Languren in ein rotes Hirsefeld eingebrochen. Es dürften etwa insgesamt vierzig Affen sein, die sechs Jungen mitgerechnet, die spielerisch im Getreide wüten. »Ho, Diddi!« (Hallo, Schwester!) ruft Tukten fröhlich. Eine Frau kommt gelaufen, die mit Steinen nach den Affen wirft. Sie trollen sich in die Felsen davon, nicht allzu schnell, und dort drehen sie sich um und beobachten gelassen die Menschen. Die großen silberbraunen Affen gehören zu den schönsten Primaten mit ihren silbern umrahmten Gesichtern und der hochmütigen, ja verächtlichen Miene, die besonders gut zu den Paschas, den ranghöchsten Männchen, paßt. Bei der Übernahme einer Horde als Leittier töten diese sämtliche Jungen; dadurch bringen sie die Weibchen rasch in den Östrus und sichern so den Fortbestand ihrer Gene in der Nachkommenschaft.
Von den Hindus werden die Languren als Manifestation des Affengottes Hanuman verehrt. Sie werden am häufigsten als die Verursacher der Fußspuren des »fürchterlichen Schneemenschen« angeführt, aber auch Bären, Schneeleoparden, große Vögel und eingesackter, schmelzender Schnee sind beliebte Erklärungen. In dem halben Jahrhundert, seit eine britische Bergsteigergruppe auf der Nordseite des Mount Everest erstmals große, aufrechte Wesen sichtete, die Hunderte von Spuren in einem Schneefeld hinterließen, hat der Ye-teh oder Yeti in wissenschaftlichen Kreisen einen Sturm von Entrüstung und Ablehnung entfacht. Aber wie im Fall des Sasquatch, der in den unzugänglichen Regenwäldern der pazifischen Nordwestküste hausen soll, sind die Argumente, die gegen die Existenz des Yeti vorgebracht werden, noch weniger wissenschaftlich als die Beweise, die für sein Vorkommen angeführt werden. Diese Gegenargumente sind völlig spekulativ und basieren notwendigerweise auf der Annahme, all die zum Teil hochangesehenen Menschen, die diese Wesen zu Gesicht bekommen haben, hätten sich getäuscht oder seien schwachsinnig. Außerdem sind die Fotografien und Abgüsse der Yeti-Spuren stets ganz ähnlich; sie zeigen einen seltsamen, 126breiten Primatenfuß, und auch die Augenzeugenberichte, die meist aus den Sherpa-Gegenden Ostnepals stammen, stimmen weitgehend überein.
Der Yeti wird meist als ein behaartes, rötlichbraunes Geschöpf mit hochgewölbtem Sagittalkamm beschrieben, in der Körpergröße etwa einem nicht ganz ausgewachsenen Jugendlichen entsprechend, mit Ausnahme der sehr großen Füße (die überhaupt nicht einem Bärenfuß mit seinen symmetrisch angeordneten Zehen ähneln), doch auch von größeren Exemplaren wird berichtet. An der Südseite des Himalaja leben keine Braunbären (Ursus arctos), während Schwarzbären und Languren allseits gut bekannt und unverwechselbar sind. Bären halten einen Winterschlaf, wogegen die Yetis gerade in strengen Wintern auftauchen (offenbar, um in der Nähe von Klöstern und Dörfern nach Nahrung zu suchen). Außerdem sind die meisten Yeti-Spuren viel zu groß, als daß sie von Affen stammen könnten, selbst wenn man die vergrößernde Wirkung der Schneeschmelze in Rechnung zieht. Übrigens halten sich Languren nur selten im Schnee auf, was allerdings auch auf die Yetis zutrifft – sie dürften lediglich auf der Suche nach neuen Futterplätzen die Schneeregionen überqueren, da ihre eigentliche Heimat die wolkenverhangenen Wälder in den zahllosen, für Menschen unzugänglichen Schluchten des Himalaja sein müßten. Vom Standpunkt des Biologen ist der Himalaja tatsächlich noch größtenteils terra incognita. Wie GS erläutert, weiß man so gut wie gar nichts über die Lebensumstände und Gewohnheiten des Schneeleoparden. Und tatsächlich müssen wir einen langen Fußmarsch unternehmen, um ein paar Daten über das Blauschaf des Himalaja sammeln zu können.
In Katmandu stellte eines Abends ein junger Biologe den Abguß eines großen Primaten-Fußabdrucks vor uns auf den Tisch: den Abdruck habe er vor sechs Monaten im Schnee nahe seinem Zelt im Arun-Tal in Ostnepal gefunden.[47] Von da aus habe die Spur quer über einen Schneehang in einen undurchdringlichen Wald geführt. Offenbar hielt er das unbekannte Wesen für einen Yeti, und ich wartete nur auf eine spöttische Bemerkung von GS. Aber er nickte bloß und sah sich den Abguß von allen Seiten an. Am meisten interessierte ihn, erklärte GS, die Ähnlichkeit dieses Abdrucks mit den Spuren der Berggorillas. 127Später versicherte er mir, er sei keineswegs nur höflich gewesen, sondern er sei überzeugt, daß die Spuren von einem wissenschaftlich noch nicht identifizierten, unbekannten Wesen stammten. Trotz der Hänseleien, die er deswegen einstecken mußte, hatte GS an die Existenz einer solchen Kreatur geglaubt, seit der Bergsteiger Eric Shipton die ersten deutlichen Aufnahmen eines Yeti-Abdruckes 1951 am Mount Everest gemacht hatte. »Mindestens fünfundneunzig Prozent der Yeti-Berichte sind Ammenmärchen«, sagte GS. »Aber aufgrund der Fotos von Shipton und einiger anderer Beweise muß man annehmen, daß eine bislang dem Menschen unbekannte große Tierart in diesen Gebieten vorkommt.« (Über den Sasquatch hingegen hegt GS seine Zweifel, obwohl dieser von einem führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Primatenforschung, Dr. John Napier von der Universität London, anerkannt wurde; Napier dagegen glaubt nicht an den Yeti, wenn ihm die Aufnahmen Shiptons auch zu denken gaben.)[48] Der Theorie, der Yeti gehöre zu einer frühen Menschenrasse, die von dem überlegenen Homo sapiens in das Dickicht der Wälder vertrieben wurde, widerspricht der große, tierhafte Fußabdruck; eher schon könnte er mit einem Sub-Hominiden, dem Gigantopithecus, oder gar mit den Menschenaffen verwandt sein. Hingegen zeigen die Fotografien und Abgüsse von Sasquatch-Spuren einen menschenähnlichen Fußabdruck, bei dem der große Zeh nah an den übrigen liegt und nicht abgespreizt ist wie bei den anderen Primaten – ein Fußabdruck, der auch von einer großen Art des Australopithecus, einem Urmenschen, stammen könnte. (Daraus ergibt sich die interessante Möglichkeit, daß der Sasquatch gar nicht »wissenschaftlich unbekannt« ist, sondern gleich dem Quastenflosser voreilig als »ausgestorbene Art« qualifiziert wurde.)
Ein gewichtiges Argument gegen die Existenz des Sasquatch und des Yeti (und dem weltweit auftretenden Phänomen des »Großfußes«) ist die Tatsache, daß bislang alle Expeditionen zur Erforschung dieser rätselhaften Geschöpfe gescheitert sind, was allerdings auch bedeuten kann, daß ihre Territorien für Menschen unzugänglich und diese seltenen Wesen außerordentlich wachsam sind, nachdem sie sich viele Jahrhunderte in den Wäldern verbergen mußten. Vielleicht wäre die beste Methode, einem 128»Großfuß« zu begegnen, ein Lager in der Nähe ihres vermuteten Vorkommens aufzuschlagen und dort so lange ruhig zu leben, bis die Neugier der Primaten sie ihrerseits zu Erkundungsgängen bewegt.
Die nepalesische Regierung nimmt jedenfalls den Yeti ernst und hat ein striktes Verbot erlassen, ihn zu töten. Nur einer der Wissenschaftler im Arun-Tal besitzt die Erlaubnis, als Untersuchungsobjekt für die Wissenschaft, einen Yeti zu erlegen. Ich fragte ihn, was er zu tun gedenke, wenn ihm eines schönen Morgens ein Yeti über den Weg liefe, denn ich fand, diese Entscheidung müsse er wohl treffen, bevor es dazu käme. Er wich dieser Frage aus; entweder hatte er die schwere Entscheidung noch nicht getroffen oder es war ihm – wenn er sie getroffen hatte – nicht wohl dabei.
Aber nun setzte er seinerseits mich in Verlegenheit. Daß GS als Biologe Hunderte von Meilen über das Hochgebirge wandere, um eine seltene Tierart zu erkunden, könne er verstehen, aber warum begleitete ich ihn? Was hoffte ich zu finden?
Ich zuckte die Achseln. Zu behaupten, ich sei ebenfalls an Blauschafen, Schneeleoparden oder meinetwegen abgelegenen Lamaklöstern interessiert, träfe wohl mehr oder weniger zu, war aber keine Antwort auf seine Frage. Zu sagen, ich wolle eine Pilgerfahrt unternehmen, erschien mir albern und nichtssagend, obwohl auch das stimmte. So gab ich zu, ich wüßte es nicht. Hätte ich ihm sagen sollen, daß ich das Geheimnis der Berge zu lüften hoffe, auf der Suche nach etwas noch Unbekanntem, das sich wie der Yeti vielleicht gerade dann entzieht, wenn man danach sucht?
Wir überschreiten den Fluß auf einer alten Holzbrücke und wandern die Bheri-Schlucht hinab. Ich fühle mich bedrückt, außerdem ist mir leicht übel. GS schreibt es dem Höhenunterschied zu; wir sind hier über 2000 Meter tiefer als am Jang-Paß. Ich bereue es, so viel rohe Bohnen gegessen zu haben, jedenfalls drücken mich die Gedärme nicht weniger als meine Laune, die in den Schneebergen solche Höhenflüge machte.
Nur das Tagebuch erinnert mich an das Datum, welcher Wochentag ist, habe ich längst vergessen. Die großen Ereignisse, die sich während der Dauer unserer Reise in der Welt zutragen mögen, 129sind für uns so unwirklich wie die eines künftigen Jahrhunderts. Ich habe nicht so sehr das Gefühl, in der Zeit rückwärts gegangen zu sein, sondern daß die Zeit zyklisch ist; Vergangenheit und Zukunft haben ihre Bedeutung verloren. Jetzt verstehe ich Einstein viel besser, wenn er sagt, die einzig wirkliche Zeit sei die des Beobachters, der seine eigene Zeit und seinen Raum mit sich führt. In diesen Bergen fällt man aus der Geschichte heraus.
Ich sehne mich danach loszulassen, unbeschwert dahinzutreiben, weniger anzusammeln, mit weniger auszukommen, einfacher zu leben. Nachdem ich die Decke gekauft hatte, fühlte ich mich plötzlich völlig daneben – noch ein Ding, das ich mit mir herumtragen muß. Der Weber verlangte einen schon sehr günstigen Preis für eine schwere Decke in schönen Farben. Aber von Tukten dazu ermuntert, handelte ich den Preis herunter – das wurde zwar nicht anders erwartet, aber es deprimierte mich trotzdem, vor allem da Tukten und Pirim als fröhliche Übersetzer bei der Transaktion zugegen waren und der Preis für die Decke, achtzehn Dollar, zwölfmal höher war als ihr Trägerlohn für einen Tag. Auch die Sherpa verdienen nicht viel besser; auf Gipfelbesteigungen, wo sie ihr Leben aufs Spiel setzen, erhalten sie rund vier Dollar pro Tag, bei Unternehmen wie dem unsrigen nicht mehr als zwei Dollar täglich.
Am Steilhang der Bheri-Schlucht sehen wir die Spuren einer versuchten Brandrodung, denn das gute Ackerland ist hier am Bheri, wie im größten Teil von Nepal, bereits weggespült worden. An unzugänglichen Stellen steht hie und da noch eine große Kiefer, als Denkmal für eine verwüstete Urlandschaft. Bald werden auch die letzten Bäume, deren Wurzeln diesen Hang zusammenhalten, verschwunden sein. Die Fluten schleppen erodiertes Gestein von den Gletschern herab, und tief in der Schlucht mit ihren ungewöhnlichen Felsformationen aus geschichtetem Gestein ist es erstaunlich heiß und trocken. Verglichen mit den gleich hoch gelegenen Flußtälern an der Südseite des Jang-La herrscht hier fast ein Wüstenklima. Auch fällt uns auf, daß die Wolken, die drüben jeden Nachmittag aufziehen, hier fehlen. Die Tibetische Hochebene, der wir uns nähern, ist vom Monsunregen durch die Himalaja-Kette abgeschnitten. Die Sonne brennt zwar heiß, aber der Wind, der den Canyon heraufweht, ist kühl und 130macht das Gehen angenehm. Auf einem Felsbuckel erspähe ich eine Goral, eine zierliche braune Ziegenantilope, die dem Serau und der Nordamerikanischen Bergziege verwandt ist, sonst sind ein Wiedehopf und ein paar weiße Schmetterlinge die einzigen Vertreter tierischen Lebens.
Sprühend fällt ein Nebenfluß, der Jairi Khola, von den Schneehängen des Dwari-Lekh-Gipfels in Kaskaden herab. Ein Stück weiter schlagen wir unser Lager auf, und Phu-Tsering besorgt in einem nahen Weiler Maiskolben und kleine Tomaten für unser Abendessen.
Die Handelsroute nach Jumla führt bis Tibrikot am Bheri entlang, wir werden sie jetzt verlassen und über eine Brücke nach Norden abbiegen, wo wir dann im Tal des Suli-Flusses weiterziehen. Verwaltungsmäßig betreten wir Dolpo mit dem Überschreiten des Bheri, aber das »Land Dolpo« meiner Träume beginnt erst an der Nordseite der Kanjiroba-Berge.
In Dhorpatan hatte man uns gewarnt, daß die Polizeiposten in Tarakot und Dunahi möglicherweise unsere Reisegenehmigung nicht anerkennen und unsere Weiterreise verhindern könnten. Schon seit Tagen diskutieren wir mögliche Strategien für diesen Fall. Ein Hindernis für unser ganzes bisheriges Unternehmen war immer wieder die Sprachbarriere – die regionalen Beamten (sowieso schon mißtrauisch wegen unseres vorgeblichen Interesses an irgendwelchen Tieren) werden dadurch oft verunsichert und reagieren, um ihr Gesicht zu wahren, störrisch. Die Sherpa, die als Buddhisten sowieso nicht zählen, werden als Vermittler nicht akzeptiert, und so besteht die Gefahr, daß wir nach dreiwöchigem Fußmarsch, nur eine Woche – wie wir glauben – von unserem Ziel entfernt, für nichts und wieder nichts zur Umkehr gezwungen werden.
Der Polizeibeamte von Dunahi ist verreist, statt seiner empfängt uns der lokale Abgeordnete des Nepalesischen Panchayat oder Parlaments, ein gebildeter Mann, der gut Englisch spricht, für unsere Anliegen Verständnis hat und uns Tee anbietet; die Hilfspolizisten 131machen keine Anstalten, diesem Mann zu widersprechen. Erleichtert machen wir uns so rasch wie möglich auf den Weg, bevor noch irgend etwas schiefgehen kann. Der Kang-Paß im Kanjiroba-Gebirge ist jetzt das letzte schwere Hindernis auf unserem Weg zum Kristall-Berg.
Hinter der Brücke über den Bheri steigt der Pfad steil an den trockenen Berghängen empor, unter den silberblättrigen wilden Olivenbäumen wachsen verschiedene Steppengräser. Unterhalb der Brücke eilt der Bheri in einer mächtigen Biegung dem Zusammenfluß mit dem Suli Gad entgegen, der vom Phoksumdo-See herabkommt und seine blaugrüne Farbe noch einige Zeit am Nordufer des Bheri beibehält, ehe sie in den grauen Fluten des Gletscherflusses untergeht. Die Schlucht des Suli Gad ist so eng und steil, daß der Weg hoch oben am Berg entlangführt und auch hier, in mehr als dreihundert Meter über dem Flußbett, kaum zwei Fuß breit ist. Wo die Wegkante abgerutscht oder der Pfad durch Geröll versperrt ist, rutschen und stolpern wir hastig über die losen Felsblöcke.
GS läßt sich vom Abgrund nicht beirren, ich kann kaum hinsehen vor Angst, daß sich das quer über seinen Rucksack gebundene lange Fernrohr irgendwo in den Felsen verfangen und ihn stürzen lassen könnte. Allerdings werde auch ich langsam abgehärteter: mein Schritt wird leichter und sicherer, Lungen und Beine haben mehr Ausdauer, und ich versuche meinen Schwerpunkt im Unterbauch zu halten und dieses Zentrum »sehen« zu lassen. Wenn mir das gelingt, dann bin ich auch an gefährlichen Stellen schwindelfrei; meine Füße finden ganz von selbst einen festen Halt und ich fließe dahin. Aber manchmal verliere ich dieses Gefühl für den Weg, atme hoch oben in der Brust und halte mich an den Felsen fest, als klammerte ich mich ans Leben selbst. Und dieses Anklammern, die ängstliche Verkrampfung ist es, was besonders gefährlich ist. »Festklammern« auf altägyptisch, »sich am Berg festklammern« auf assyrisch waren Euphemismen für »sterben«.[49]
Beim Abschied von Eido Roshi hatte ich ihm auch von den seltsamen Todesahnungen erzählt, die mich vor einigen Monaten befallen hatten. Er nickte; vielleicht meinte er, solche Ahnungen seien Vorzeichen des geistigen »großen Todes« und einer »Wiedergeburt«. – 132»Vielleicht bringt der Schnee dir Auslöschung und Erneuerung«, murmelte er. Und dann, nach einer Weile, warnte er: »Aber erwarte nichts!« Es gefiel dem Roshi, daß wir zu zweit reisen wollten, das schien ihm eine Vorbedingung für eine echte Pilgerfahrt. Er wies mich an, auf meiner Wanderschaft über die Berge das Kannon Sutra zu rezitieren, und gab mir ein Koan (in der Zen-Praxis eine paradoxe Frage oder Äußerung, die nicht durch Logik oder Vernunft gelöst werden kann). Die Versenkung in dieses Koan kann zu einer plötzlichen Auflösung des logischen Denkens führen und damit das Bewußtsein für einen unmittelbaren Einblick in die Tiefen des Seins öffnen.
Das Koan lautete:
Alle Gipfel sind schneebedeckt – warum ist dieser eine nackt?
Der Roshi erhob sich von seinem schwarzen Sitzkissen, faßte mich an den Schultern und berührte dreimal meine Stirn mit der seinen. Dann schlug er mir kräftig auf den Rücken und schickte mich mit einem Schrei auf den Weg.
»Erwarte nichts!« Immer wieder erinnere ich mich an seinen Rat. Ich muß meinen Weg unbeschwert gehen, ohne daran zu denken, daß ich irgend etwas erreichen will. Statt das Kannon Sutra zu rezitieren, stimme ich das om mani padme hum an, das denselben großen Bodhisattva anruft. Wenn man zu jedem Schritt ein Wort dieses Mantra ausspricht, paßt sein vibrierender Klang besser zu dem Rhythmus des Kletterns.
Aum … Ma-ni … Päh-me … Hung!
Eine große, kupferfarbene Heuschrecke auf dem Pfad glänzt wie Bernstein in der Sonne, sie ist so groß und scheint so von innen her zu leuchten, daß ich mich frage, ob sie nicht irgendein alter Naldjorpa ist, fortgeschritten in der Kunst, eine andere Form anzunehmen. Aber ehe sich solch ein »Vervollkommneter« offenbaren kann, macht der Grashüpfer einen unvorsichtigen Satz über die Abgrundkante, um mehrere hundert Meter tiefer ein neues Leben zu beginnen. Ich entscheide mich, dies als ein Zeichen dafür zu nehmen, daß ich mich dem Leben anvertrauen muß, und mit stillem Dank an den Grashüpfer setze ich beschwingt meinen Weg fort.
133
Das leere Dorf, zu dem uns der Weg über dem Suli Gad führt, wird im Winter von Yak-Hirten aus dem inneren Dolpo-Gebiet bewohnt, wenn die Tiere in diesem tiefer gelegenen Gebiet ihr Futter suchen. Jetzt im hellen Licht der Herbstsonne starren die Tür- und Fensteröffnungen wie dunkle Augenhöhlen in einem Totenschädel, eine im Wind flatternde Fahne unterstreicht noch den Eindruck der Verlassenheit. Unterhalb des Dorfes kommt ein Sturzbach aus den Bergen, und während GS ein Stück am Bach emporsteigt, um eine Gruppe Languren zu fotografieren, wasche ich mich in der warmen Sonne an einer Stelle, wo das Wasser kalt und klar auf flachen Steinen glitzert. Nachdem sich auch die Sherpa eingefunden haben, essen wir im Schatten der Weiden und Espen am Bachufer und würzen unsere Tschapatis mit dem Samen des kleinen wilden Hanfes, den wir den Goldfinken streitig machen.
Hinter dem Dorf geht es eine Stunde lang sehr steil bergauf. Die Träger aus Tarakot murren, und sogar die Tamang schnaufen, alle außer Karsung, der sogar noch im Steigen singt. Eine Bhotyafamilie kommt uns entgegen, mit einem scheu genickten Gruß gehen sie an uns vorbei. In fast 3000 Meter Höhe erreichen wir die Oberkante des Felshanges, wo sich der Pfad um eine Bergkuppe herumwindet und wieder flacher wird. Der Bheri liegt jetzt weit hinter und unter uns, vor uns erhebt sich ein Schneegipfel des Kanjiroba wie eine stille Wolke in das Himmelsblau. Ein zeternder Dohlenschwarm löst meine Heiterkeit aus, und da mir kein neues Thema einfällt, um meiner guten Laune Ausdruck zu geben, berichte ich GS atemlos von meinen Stiefeln, die endlich weit genug geworden sind und mir das Leben dadurch unendlich versüßen. Leicht erschreckt durch meine Euphorie macht GS sich raschen Schrittes aus dem Staub, ich bleibe zurück und lausche zufrieden dem Knarren meiner geliebten Bergstiefel und dem dumpfen Aufschlag meines Stockes auf dem Fels, wobei ich mich unbezwingbar fühle wie Padmasambhava, der den Dharma von Indien nach Tibet brachte.
Auf den Steinen aus Glimmerschiefer liegt die gelb-blaue Feder eines unbekannten Vogels. Und mich überkommt die bohrende Ahnung, wenn auch kein klares Begreifen, daß in dieser Feder auf dem silbernen Pfad, im Rhythmus des Klanges von 134Holz und Leder, in Atem, Wind und Sonne sowie in den rauschenden Bächen einer Landschaft ohne Vergangenheit und Zukunft – daß in diesem Augenblick und in allen Augenblicken Vergänglichkeit und Ewigkeit, Tod und Leben Eins sind.
Ein Stück weiter oben öffnet sich eine Höhle im Berghang. Hier haben die Reisenden, beeindruckt vom Wind, dem Abgrund und dem Brausen des schäumenden Flusses tief unten, gleich eine ganze Reihe von Steinhaufen, jeder mit einer Opfernische an der Ostseite, errichtet. Ein Haufen ist mit frischen Ringelblumen geschmückt, zweifellos von den Leuten, die uns vorhin begegneten. Tukten, der in nicht ganz ernsthafter Verehrung die Hände zusammenlegt, erklärt, die Haufen seien einem alten Berggott namens Masta gewidmet.
Hoch oben am Berg kommt ein Dorf in Sicht, es ist Rohagaon. Wir ziehen an wilden Walnußbäumen vorbei, die letzten gelben Blätter hängen steif an den Zweigen, zerbrochene Nußschalen liegen auf flachen Steinen am Wegrand, dazwischen die Federn eines Wiedehopfes, gerissen vielleicht von demselben Sperber, der aus einem Busch aufgestört in die Schlucht des Suli Gad hinabtaucht. In einem Gestrüpp unterhalb Rohagaon rufen Ahornbäume, Sumac, Robinien und wilder Wein die Erinnerung an heimatliche Wälder wach, aber sie unterscheiden sich doch so von den altbekannten Bäumen, daß sie wie im Traum verfremdet erscheinen; der verzauberte Wald aus einem Kindermärchen liegt hier im herbstduftenden Nachmittag vor mir. Sein Anblick bringt eine leichte Nostalgie mit sich, sehnsüchtige Erinnerung nicht an zu Hause oder irgendeinen anderen Ort, sondern an eine verlorene Unschuld – das verlorene Paradies, das, wie Proust sagt, das einzige Paradies ist. Die Kindheit ist voller Geheimnisse und Verheißungen; vielleicht kommt die Lebensangst in dem Moment, wo alle Geheimnisse erklärt sind und wir all das erlangt haben, was wir zu brauchen glaubten. Es ist just der Augenblick der scheinbaren Erfüllung, in dem wir die herbste Enttäuschung erfahren und uns betrogen fühlen, ein Gefühl, das wie eine riesige drohende Welle hinter uns aufsteigt. In solchen Momenten wird uns plötzlich klar, was Milarepa meinte: »Alles weltliche Streben hat nur ein unvermeidliches Ende, das Leid: Ansammlung 135endet in Zerstreuung, Aufbau in Zerstörung, Zusammentreffen in Trennung, Geburt in Tod …« Mit dem unbeschönigten Schreckgespenst von Alter, Krankheit und Tod konfrontiert, werden wir auf die Gegenwart zurückgeworfen, auf diesen Augenblick, hier, gerade jetzt, denn das ist alles, was es gibt. Und zweifellos macht das das Paradies der Kinder aus, daß sie ganz in der Gegenwart ruhen, wie Frösche oder Kaninchen.
Irgendwo murmelt ein Bach, die kühle Nachmittagsbrise bringt Humusgeruch mit. GS und ich setzen unser Gepäck ab und sammeln Walnüsse, die Sherpa und Träger folgen unserem Beispiel, und so laufen wir eine Weile wie vergnügte Kinder im Wald herum und knacken die kleinen Nüsse, ehe wir schon in der Abenddämmerung das letzte steile Wegstück nach Rohagaon hinaufsteigen.
Wenn Tarakot etwas Mittelalterliches hatte, so betreten wir in Rohagaon die graue Vorzeit. Die Wege in das Dorf werden von Dhauliyas, Schutzgöttern, bewacht, deren Gestalten grob in flache Steine geritzt sind, vor der primitiven Stupa am Dorfeingang liegt eine Portion Marihuana als Opfergabe. Weder der Buddhismus noch der Hinduismus haben den alten Glauben des hier ansässigen Thakuri-Volkes verdrängen können, das noch heute in einem schmucklosen Tempel Ziegenschädel als Opfer für den Gott Masta aufschichtet. Grob aus Holz gehauene Fratzen schützen die niedrigen Steinhütten, von deren Dächern halbwilde Köter die Fremden ankläffen, und über den Rübenfeldern hängen an langen Stangen tote Krähen als Scheuchen für ihre lebenden Artgenossen.
Im Dorf schauen uns die Männer mit starrem Blick nach, während die Frauen mit ihrer Arbeit fortfahren; eine Frau zerstößt Hirse mit einem uralten hölzernen Stößel, eine andere geht unter einem Holzfaß gebeugt, das sogar in Tarakot längst durch Wasserkannen aus Messing ersetzt wurde. Die Frauen tragen schwarze, die Männer bunte, aber rußgeschwärzte Kleidung, die Kinder Lumpen. Alle Gesichter sind schwarz vor Ruß, nur liegt auf denen der Kinder noch nicht die abweisende Härte der Erwachsenen. Während wir unsere Zelte aufschlagen, spielen sie in unserer Nähe und genießen diesen Augenblick ihres Lebens.
136
Von Rohagaon aus hat man eine großartige Aussicht über das ganze Tal des Suli Gad bis zu den schneebedeckten westlichen Ausläufern des Dhaulagiri. Sterne füllen die Himmelsweite, und als auch der Mond aufgeht, beginnen die Hunde auf den Dächern zu wüten. Der Oktobermond erinnert mich daran, daß zuhause jetzt bald das Halloween-Fest gefeiert wird. Ob mein Sohn sich wohl eine Kürbismaske schnitzt? Er hat ein Kostüm aus schwarzem Stoff, auf den ein weißes Gerippe aufgemalt ist. Dieses Jahr ist es ihm sicher zu kurz geworden und seine staksigen Beine sehen darunter hervor. Welche Maske wird mein Sohn an Halloween tragen, wenn er das Fest des Feuers und des Todes feiert? Ich liege schlaflos, schimpfe vergeblich auf den wutschnaubenden Köter auf dem Hausdach über uns, der vom ungewohnten Anblick der im Mondlicht leuchtenden Zelte angestachelt von Mitternacht bis Morgengrauen mit unverminderter Lautstärke bellt und bellt.
Wir verlassen Rohagaon, als die ersten Lichtstrahlen die Eisgipfel im Süden aufglühen lassen.
Zwei kleine Mädchen, Holzperlen um den Hals und Filzstiefel an den Füßen, halten mit ihren Wassergefäßen in einer Wegkehre an, um uns vorbeizulassen. Als ich mich Minuten später nach ihnen umsehe, stehen sie immer noch unbeweglich dort, kleine zerlumpte Gestalten vor dem aufklarenden Himmel.
Die Gipfel ringsum strahlen schon längst in der Sonne, aber diese steilen Himalaja-Täler sind so von der Sonne abgeschirmt, daß wir auf dem Pfad über dem Suli Gad noch zwei Stunden lang im grauen Dämmerlicht wandern. Hie und da setzen wilde Rosenbüsche hellgelbe Blütentupfen ins Dunkel, ein Schwarm Schneetauben kreist auf und ab, jedoch halten wir vergeblich Ausschau nach größeren Tieren, wie etwa einem Tahr. Überhaupt haben wir unterwegs wenig Wild getroffen und schon gar nicht so exotische Tiere wie den Mondbären oder den roten Panda.
Hoch oben im Tal treffen wir wieder auf den Suli Gad, ein 137reißendes Wasser zwischen flechtenbewachsenen Felsenklippen, im Schatten von Tannen und Walnußbäumen, darunter dichtes Farngestrüpp. Über felsige Stufen donnert uns der Fluß unter den herbstbunten Blättern und stillen, dunklen Tannen entgegen, eine Reihe von Wasserfällen, türkisfarben und weiß, zwischen gischtglänzenden Felsblöcken. Im kalten Atem der Fälle ist die trockene Bergluft durch aufsteigenden Dunst gemildert. Unter den Sternen der vergangenen Nacht gluckste dieses Wasser noch in kleinen Rinnsalen durch die Schneefelder. An der letzten Stufe des Wasserfalls, stromab, springt es funkelnd in die Luft, der Sonne entgegen, deren Strahlen auf den Wellen tanzen, vor dem weißen Hintergrund ferner Schneeberge.
Stromauf, im inneren Canyon, wird die düstere Stille durch das Poltern von Felsstürzen noch vertieft. Irgend etwas lauscht, und ich lausche auch: wer wagt es, hier einzudringen? Wer atmet da? Ich reiße einen Farnwedel ab, um mir die Sporen zu besehen, werfe ihn wieder weg und werde im gleichen Augenblick von Reue gepackt: zu den großen Sünden, so sagen die Sherpa, gehört es, wilde Blumen zu pflücken und Kinder zu erschrecken. Meine Stimme murmelt eine Entschuldigung, ein seltsames Geräusch, das in dieser Stille fehl am Platz erscheint. Ich schaue mich um – wer hat da gesprochen? Und wer hört? Wer ist dieses immer-gegenwärtige »Ich«, das nicht ich selbst bin?
Eine einsame Vogelstimme stellt dieselbe Frage.
Hier im Geheimnis der Berge, im Brausen des Flusses, berühre ich meine Haut, um zu sehen, ob ich wirklich bin; laut rufe ich meinen Namen und gebe keine Antwort.
Vor einer dunklen Felswand schwirrt und glitzert eine schwarz-goldene Libelle. Nüsse fallen auf Teppiche aus gelben Blättern am Boden. Ob es wohl irgendwo auf der Welt noch einen schöneren Fluß gibt als den Suli Gad im Herbst? Im Nebel ragt ein Wassergeist aus monumentalem grauen Fels empor, eingehüllt in einen Mantel aus weißem Wasser. Weiter oben hängt das lange Band eines Wasserfalls von einer Klippe im Osten in den Wind, der die Schlucht aufwärts weht. Noch ehe es den Boden berührt, zersprüht es, der Wind trägt den Dunst wieder hinauf, wo er zwischen den Tannen in der Sonne leuchtet.
Der Pfad verläßt nun die Talsohle und steigt steil zwischen den 138Bäumen empor, dann wieder hinab unter einen tropfenden Felsüberhang, eine riesige zugige Höhle. Jenseits des Flusses ein grasbewachsener Hügel, Mispelsträucher mit hellroten Beeren und gelbe, weiße und hellblaue Hochgebirgsblüten. Hinter dem Hügel türmt sich der Kanjiroba wie eine Festung aus Eis auf dem Gipfel eines näher gelegenen Berges auf. In der Dämmerung geht der Pfad wieder bergab zum Suli Gad, wo wir nahe am tosenden Wasser unser Lager aufbauen. Wir schreien uns gegenseitig an und verstehen doch kaum ein Wort; wie Schatten bewegen wir uns in der Tiefe der dunklen Schlucht.
Bei Tagesanbruch ist der Boden auf dieser Seite des Canyon hart gefroren, und auf den Bächen, die in den reißenden Fluß münden, schimmert Eis. Noch im Halbdunkel des frühen Morgens stoßen wir auf das Lager eines Bären in einem Mehlbeerbaum – unsere erste Spur eines asiatischen Schwarzbären, auch »Mondbär« genannt. Beim Pflücken der Früchte reißt der Bär die Äste herunter, die ihm dann oft als Nachtlager dienen. In einer Ecke des alten Lagers hat eine blaue Felsentaube, die wilde Urform unserer Stadttauben, sich ein Nest gebaut, die Jungen darin sind spät dran und noch nicht ganz flügge. Wir folgen dem Beispiel des Bären und pflücken von den nach dem Frost genießbaren Früchten.
Ein Wald aus abgestorbenen Kiefern, feuchte Höhlen in der Bergflanke, die Feuerstellen früherer Reisender: in zwei Höhlen grobe hölzerne Regale, als hätten sie Einsiedlern als Wohnstätte gedient. Auf die Bretter ist das Swastika-Zeichen eingeschnitzt, jenes uralte Schöpfungssymbol, das außer südlich der Sahara und in Australien überall in der Welt bekannt ist. Die Urahnen der amerikanischen Eingeborenen haben es nach Nordamerika mitgebracht, in den germanischen Kulturen war es das Zeichen des Thor, man findet es in Troja ebenso wie in den altindischen Kulturen, von denen es durch die Hindus und später durch die Buddhisten übernommen wurde. Auch die umgekehrte Swastika 卍 finden wir; sie ist das Symbol der Bön-Religion, die in den 139abgelegenen Winkeln dieser Berge erhalten ist. Da sie den Lauf der Zeit umkehrt, glaubt man, sie übe eine zerstörerische Wirkung auf das Universum aus, und deshalb wird sie oft mit schwarzer Magie in Verbindung gebracht.
Ein schwacher musikalischer Ruf übertönt das Brausen des Wassers. Ich halte Ausschau, sehe den Rufer im Halbdunkel der Schlucht jedoch nicht und gehe weiter; erst als er ein zweites Mal ruft, mache ich ihn auf einer kleinen Lichtung jenseits des Flusses aus. Es ist ein Siedler, der das Wildgras als Heu für seine Tiere einbringt. Ich freue mich, ihn zu sehen, bin aber gleichzeitig traurig, ihn hier zu sehen; so wird es mit der Wildnis am oberen Suli Gad also auch bald ein Ende haben. Da wir uns über den Fluß hinweg nicht verständigen können, lächeln wir bloß. Er legt seine Sichel nieder und hebt die grüßend zusammengelegten Hände; ich tue dasselbe, wir verbeugen uns beide und wenden uns ab.
Nahe der Einmündung eines Nebenflusses, der von der Bön-Siedlung Pung-mo herabfließt, hat eine Lawine eine Schneise in den dichten Wald jenseits des Wassers gepflügt. Auf dem mit Büschen bewachsenen Abhang sehe ich eine dunkle Gestalt hinter einen Felsblock huschen. Die Schneise liegt in der prallen Morgensonne, aber die Gestalt ist nur einen Augenblick sichtbar. Sie ist zu groß für einen roten Panda, zu scheu für ein Moschustier, zu dunkel für einen Wolf oder Leoparden und viel schneller als ein Bär. Mit meinem Fernglas suche ich lange den stillen Berghang ab und betrachte den Felsblock genau, aber nichts rührt sich auf dem sonnenbeschienenen Hang.
Den ganzen Tag hindurch denke ich über die flinke dunkle Gestalt nach, die auf die kleinste Bewegung jenseits des brausenden Wassers so wachsam reagierte. Ich war allein, sie konnte mich nicht gehört und im Schatten des Waldes auch kaum gesehen haben. Von den Säugetieren der Himalaja-Region kämen am ehesten der Schwarzbär und der Leopard in Frage; aber ein Bär bewegt sich anders, und Leoparden sind hier nicht einförmig dunkelrot oder braun gefärbt.
Und obwohl ich annehme, daß es aller Wahrscheinlichkeit nach doch ein Moschushirsch gewesen ist, kann ich den Gedanken an einen Yeti nicht völlig verbannen. Die dicht bewaldete Schlucht am Oberlauf des Suli Gad ähnelt sehr dem Urwald Ostnepals, 140der dem »menschenähnlichen Schneewesen« Unterschlupf gewähren soll. Soweit mir bekannt ist, wurden westlich des Kali Gandaki nie Yeti-Spuren gefunden, was aber auch einfach darauf zurückzuführen sein mag, daß der nordwestliche Himalaja weniger gut erforscht ist.
In 3300 Meter Höhe öffnet sich die Schlucht zu einem Hochtal mit vielen Seitentälern. Ein Zug dunkler, zottiger Rinder, Yaks genannt, kommt uns über Stoppelfelder auf einem Hügel vor uns entgegen. Der dünne Klang von Messingglocken geht ihnen voraus; in diesen Bergen ist Glockengeläut oft das erste Anzeichen für die Gegenwart von Menschen. Die bepackten Leittiere sind mit roten Halsbändern und bunten Quasten geschmückt, gleich hinter ihnen sehen wir einen Mann und eine Frau in tibetischer Kleidung den Weg herabkommen. Der Mann trägt eine Decke über der gegürteten Jacke, die pludrigen Hosen stecken in roten Filzstiefeln, die Frau hat über ihre schwarze Kleidung eine buntgestreifte Schürze gebunden.
Auf einem langgezogenen Hang inmitten von Buchweizenfeldern liegt der Weiler Murwa mit ordentlichen Steinhäusern und Höfen. Die Bewohner von Murwa sind wesentlich sauberer als die Leute von Rohagaon, ihr Vieh ist gut genährt, die Felder sind offenbar ertragreich. Phu-Tsering kauft Eier und Kartoffeln ein. Der sonnige Berghang ist ringsumher durch Schneegipfel abgeschirmt, im Westen rauscht über eine hohe Felswand ein mächtiger Wasserfall vom Phoksumdo-See herab, der zusammen mit dem Murwa-Fluß den Suli Gad bildet. Leider können wir uns an diesem friedlichen Ort nicht lange aufhalten, wenn wir den Phoksumdo-See bis zum Abend erreichen wollen.
Über den reißenden Murwa führt keine Brücke; im kalten Wind ziehen wir Schuhe, Strümpfe und Hosen aus und waten durch die eisigen Fluten. Diagonal gegen die Strömung ankämpfend, beeile ich mich hinüberzukommen, denn meine tauben Füße spüren bald den Grund nicht mehr. Einige Male rutsche ich von glitschigen Steinen ab und bin einem unfreiwilligen Bad nahe. Nach ein paar kitzligen Augenblicken habe ich es dann doch sicher geschafft und lasse mich an einer windgeschützten Stelle auf den Uferfelsen von der Sonne trocknen.
141
Hinter Murwa geht es steil zwischen Wacholdergebüsch und Himalaja-Zedern zu dem Felsriegel hinauf, der als natürlicher Damm in 3800 Meter Höhe den Phoksumdo-See zurückhält. Ich gehe ein Stück voraus, als ein Reiter auf dem Bergkamm auftaucht und mich nach dem Wegziel fragt. »Shey Gompa«, erkläre ich. »Shey?« wiederholt er zögernd und sieht sich zweifelnd nach den Bergspitzen im Nordwesten um. Mit der Hand zeigt er nach Süden und dann auf mich. »Tarakot«, sage ich, »Dhorpatan.« »Dhorpatan«, wiederholt er und nickt zufrieden. Offenbar ist er auf dem Weg dorthin und freut sich, daß wir den Jang-La noch überqueren konnten. Ich versäume, ihn zu warnen, daß sein Pony dort nicht durchkommen wird.
Ein Junge und ein Mädchen kommen aus dem Zedernwald. Das Mädchen hat einen Klumpen Ziegenkäse in ihrem Korb, sauber in Birkenrinde gewickelt. Sie schenkt mir ein kleines Stück, und ich kaufe ihr dazu noch etwas ab. Im Windschatten eines Kiefernwäldchens sitze ich auf warmen Kiefernnadeln und esse meinen Käse mit einem Rettich aus Rohagaon.
Aus dem Wald tönt ein Glöckchen, dann höre ich Hufschlag auf den Granitfelsen. Ein zweiter Reiter, in sauberer Jacke und neuen Filzstiefeln, erscheint auf einem Pony mit silberbeschlagenem Zaumzeug. Auch er möchte wissen, wohin ich gehe, und runzelt die Stirn, als er Shey Gompa hört. Mit der flachen Hand deutet er in Brusthöhe an, wie hoch der Schnee liegt, schüttelt den Kopf und reitet mit Geklingel davon.
Wolken steigen von Süden her auf, der kalte Wind läßt mich erschauern. GS, der mich bald darauf einholt, hat ähnliche Informationen ausgetauscht und befürchtet, wir könnten Schwierigkeiten haben, ins innere Dolpo-Gebiet hineinzukommen. Ich nicke, allerdings mache ich mir mehr Gedanken darüber, wie wir wieder herauskommen sollen. Der Schnee auf dem Kang-Paß kann nur noch höher werden. Und es wäre verhängnisvoll, wenn uns ein Schneesturm auf der Nordseite des Kang-La einschließen würde, denn unsere Vorräte reichen höchstens für zwei Monate.
Eine Yakherde auf einer Bergwiese. Wie Granitblöcke liegen die dunklen Leiber in der Sonne. Das Yak ist ein halbwegs gezähmtes Rind, das in einzelnen, wildlebenden Herden noch heute in entlegenen Gebieten Tibets vorkommt. Das weibliche Yak 142wird »Bri« genannt. Die Kälber sehen mit ihren kurzen Köpfen, dem wolligen Pelz und buschigen Schwanz wie riesige Kuscheltiere aus. Darunter gibt es auch Kreuzungen zwischen Hausrind und Yak, die Dzo heißen. Die vom Wind aufgerichteten langen Haare auf ihrem zottigen Rücken glänzen in der Sonne; es riecht scharf nach Dung. Finken zwitschern, im Hintergrund Schnee und blauer Himmel. Wiederkäuend stehen die Tiere in Richtung des von Süden wehenden kalten Windes und schauen hinüber auf die Felskante, von der der schmale, reißende Lauf des Bauli Gad, der von Phoksumdo herunterkommt, in zwei, drei breiten Wasserfällen in den Murwa hinunterstürzt. Zwischen Granit und Nadelgehölz schimmert hinter den Yaks ein türkisfarbener See unter den Schneegipfeln des Kanjiroba-Massivs.
Ein Geologe würde die Entstehung des rund fünf Kilometer langen, knapp einen Kilometer breiten und angeblich ebenso tiefen Phoksumdo Tal damit erklären, daß ein gewaltiger Erdrutsch am Talende niederging und es versperrte und dadurch die vom Kanjiroba herunterfließenden Wassermassen aufstaute. Aber die örtliche Überlieferung weiß es anders:
Als die Gegend noch zum Lande Bhot gehörte und ihre Bewohner dem alten Bön-Glauben anhingen, lag da, wo jetzt der See ist, ein kleines Dorf. Im achten Jahrhundert gelangte der große buddhistische Heilige Padmasambhava, »der Lotus-Geborene«, nach Phoksumdo, um die Bergdämonen zu unterwerfen. Eine Dämonin gab den Dorfleuten einen Türkis von unvorstellbarem Wert, damit sie ihr Versteck nicht verrieten. Aber Padmasambhava verwandelte den Türkis in einen Haufen Dung, worauf die Leute sich von der Dämonin betrogen fühlten und ihr Geheimnis preisgaben. Aus Rache schickte sie ihnen eine gewaltige Flutwelle, in der das ganze Dorf versank.[50]
Wie dem auch sei, jedenfalls ist der Bön-Glaube in dieser Gegend noch heute lebendig, und in der Nähe von Ringmo, einem Dorf am Ostufer des Sees, befindet sich ein Bön-Kloster. Ringmo unterscheidet sich vermutlich kaum von jenem Dorf, das angeblich im achten Jahrhundert in den Fluten unterging. Von weitem sieht es wie eine Märchenfestung aus, denn vor den Wänden liegen wie Brustwehre aufgeschichtet Stapel von Reisigholz, die bis über das Dach reichen. Himmelblaue und wolkenweiße Gebetsfahnen 143flattern wie Banner im Wind, und von den Gipfeln aufgespaltene breite Sonnenbahnen über dem Dorf verstärken den unwirklichen Eindruck der Szene.
Aus dem Kiefernwald kommt ein Holzfäller in handgewebter Kleidung und dicken Stiefeln; er stößt hin und wieder einen barbarischen Schrei aus, der ohne Antwort im Herbstabend verhallt. Ich folge dem seltsamen Burschen bis zu den zwei weißen Stupas vor dem Dorfeingang, die mit roten Ringen und Figuren bemalt sind. Die Stupas sind klobig und windschief, und dazu paßt ausgezeichnet eine große Höhle gleich nebenan in der Felswand, die mit einem Holzgitter versperrt ist. Überall Sträucher mit rotgoldenem Laub, Berberitzen, Stachelbeeren und Rosen, dazwischen ein paar verspätete Kapernblüten. Hinter den Stupas fließt der Bauli-Fluß wie ein Burggraben vor der Stadt. Eine beflaggte Brücke schwingt sich über eine schmale Stelle, kurz bevor der Fluß in die Schnellen übergeht, die sich von hier bis zu der Felskante über den Wasserfällen erstrecken. Oberhalb der Brücke liegt mitten in den schäumenden Fluten ein großer Felsblock, auf den irgend jemand das Mantra om mani padme hum eingeritzt hat, als wolle er es mit den Wellen aus dem Himalaja zu der umnachteten Menschenherde in der Gangesebene hinabschicken.
Hinter der Brücke schwingt sich eine dritte Eingangs-Stupa bogenförmig über den Weg zum Dorf. An den Nordwänden liegen Schneewehen, von denen das schwarze Fell einiger unbeweglich dastehender Yaks absticht. Dahinter kleine Gersten- und Buchweizenfelder, auch Kartoffeln werden angebaut, die erst im neunzehnten Jahrhundert hierher gelangt sind. Ein kleiner Junge treibt ein Paar vor eine Egge gespannte Dzo an, andere Kinder stehen auf der hölzernen Egge, damit sie tiefer in den mit Steinen durchsetzten Boden einsinkt. Ein Mann, so alt, daß er sich kaum noch auf den Beinen halten kann, gräbt mit einer Hacke die letzten verbliebenen Kartoffeln aus; scheu lächelnd sieht er zu den vorbeiziehenden Fremden auf, als wolle er wegen seiner Hinfälligkeit um Verzeihung bitten.
Mitten auf der Dorfstraße erwartet uns ein Kerl von einem Mann mit einer roten Decke über der schmutzigen Schaffellweste; ein lavendelfarbener Turban mit Troddeln, erdfarbene Hosen 144und ehemals bunte Filzstiefel vervollständigen den Anzug dieses Banditen, der uns mit einem hinterhältig gierigen Grinsen begrüßt. Kinder kommen aus den Häusern gelaufen, eine Dogge hinterher, die den Ruck an ihrer Kette mit einem Aufjaulen quittiert. Jedermann lächelt in Ringmo, ich lächle zurück, bleibe aber auf der Hut.
Die braunen Häuser haben hölzerne Türen und Türstöcke, aus den Fenstern lachen uns rußige Mongolengesichter mit flachen Nasen an. Hinter einem der einfachen Häuser erschallt ein rhythmisches Stampfen: zwei Mädchen zerstoßen Korn mit schweren Holzstößeln in einem Steinmörser; mit einem Wechselgesang aus sanften Grunzlauten halten sie den Takt. Ein paar Schritte weiter bearbeitet ein Zimmermann einen Kiefernstamm mit seiner groben Axt. Das ziemlich ungehobelte Volk von Ringmo trägt den Schmutz wie eine zweite Haut, die Kindergesichter verschwinden fast unter einer Kruste von Schmutz und Geschwüren. Beide Geschlechter tragen das Haar in Zöpfen geflochten, um den Hals meist Ketten aus Holz-, Silber- und Türkisperlen, manchmal auch mit Knochenstückchen, oder Amulette in kleinen Lederbeuteln an einer Schnur. Die Kleidung hat überwiegend tibetischen Charakter: Schulterdecken, gegürtete Jacken, Schürzen und rotgestreifte Filzstiefel mit Yakledersohlen.
Wir lassen Jang-bu nach den Schneehöhen am Kang-La-Paß und bei Shey Gompa fragen. Die Leute riechen, wie alle primitiven Völker der Welt, nach Schweiß, Rauchfeuer und ungewaschener Haut. Männer wie Frauen zwirbeln Wollgarn auf ihren Handspindeln. Sie sagen, Schneestürme hätten den Kang-La für diesen Winter zugeweht und unpassierbar gemacht. Auf den Dächern glänzt bronzefarben die zum Trocknen ausgebreitete Buchweizenspreu, die als Winterfutter dient, und in einer sonnigen, windstillen Ecke dreht eine alte Frau mit sauber gewaschenen Haaren ihre Gebetsmühle und summt leise das Mantra dazu.
Die Tamang wollen hier in Ringmo umkehren, für den Kang-Paß sind sie nicht genügend ausgerüstet. Eine Ziege wird gekauft, ein 145paar Holzfäßchen mit Chang finden sich ebenfalls, um unseren Abschied gebührend zu feiern; immerhin haben sie uns mehrere Wochen lang begleitet. Fröhlich schlachten die Tamang die Ziege. Beim Töten halten sich die Sherpa fern, finden aber nichts dabei, den Braten zu verzehren.
Am frühen Nachmittag nehmen Pirim und seine Gefährten an der Brücke Abschied von uns. Wir haben ihnen den Kopf und die Vorderläufe der Ziege überlassen. Mit einem Bauch voller Chang und ohne schwere Last steigen sie schier tänzelnd die Anhöhe hinauf. Und obwohl ich ihnen lächelnd nachsehe, ist mir dabei doch ganz sonderbar zumute.
Tukten, der als einziger Träger weiter bei uns bleibt, soll von nun an wie ein Sherpa bezahlt werden; seine Dienste sind zu wertvoll, als daß wir ihn verlieren wollen. Ich hatte mich dafür ausgesprochen, daß er auch weiter mit uns kommt, denn trotz seines nicht ganz astreinen Rufes halte ich ihn für den intelligentesten und hilfreichsten Mann unserer Leute; außerdem scheint er mir irgendwie Glück zu bringen. Falls ich vor GS von Shey Gompa aufbrechen sollte, wird Tukten mit mir kommen, denn Dawa und Gyaltsen sprechen kein Wort Englisch und auf Jang-bu und Phu-Tsering kann GS nicht verzichten.
Von Norden fällt kalter Wind herab, aber hinter den hohen Steinmauern eines umzäunten Grundstücks, wo wir unsere Zelte aufgeschlagen haben, scheint warm die Sonne. Trotz aller Berichte über den hohen Schnee am Paß haben wir uns gegen die Mitnahme von Yaks entschieden; sie können sich zwar den Weg durch Neuschnee bahnen, der ihnen bis zum Bauch reicht, aber in Eis und Harsch sind sie kaum zu gebrauchen. Jang-bu heuert deshalb eine Schar neuer Träger an, die pro Tag fünfundzwanzig Rupien verlangen. Noch bevor wir losmarschiert sind, scheinen sie schon daran zu denken, uns Schwierigkeiten zu machen. »Was bekommen wir bezahlt, wenn wir umkehren müssen?« fragen sie sofort. Angeblich brauchen sie zunächst einmal zwei Tage, um ihre Kleider und Stiefel zu flicken und Vorräte zu beschaffen. Ein Mann hat sich in unserer Nähe niedergelassen und bestickt seine Filzstiefel mit harter grauer Wolle, während er über den Inhalt unseres Gepäcks meditiert.
Alle anderen außer den Trägern haben rasch ihr Interesse an 146uns verloren, nachdem einmal geregelt ist, was es an uns zu verdienen gibt. Was ihre Kleidung, Sitte und den Schmutz angeht, so unterscheiden sich diese Ringmos wohl kaum von den Dörflern des 8. Jahrhunderts, die die Dämonin verrieten. Zu dieser Jahreszeit ernähren sie sich hauptsächlich von Kartoffeln; die um das Dorf herum in Fülle vorhandenen Wildfrüchte rühren sie nicht an. Unten am Fluß überrede ich zwei kleine Mädchen, ein paar von den dort wachsenden Stachelbeeren zu versuchen. Die Kinder sind zuerst mißtrauisch, greifen dann aber erstaunt zu, in ihrer Freude über die wohlschmeckenden Beeren schauen sie einander lachend an.
Während GS in die Berge auf Suche nach Blauschafen geht, sehe ich mir die Stupas und die Ortschaft genauer an. Selbst für meine ungeschulten Augen erscheinen die alten Fresko-Gemälde an den Wänden der Stupas und ganz besonders die Mandalas an der Decke sehr kunstvoll und sorgfältig ausgeführt; zu früheren Zeiten war die Kultur in dieser Gegend offenbar noch nicht so heruntergekommen, wie sie jetzt ist. Roter Ocker, Blau und Weiß herrschen vor, doch wurde für gewisse Buddha-Aspekte und -Verkörperungen auch Gelb und Grün verwendet. Allerdings sind dem Maler bei der symbolischen Darstellung der Buddhafiguren einige Fehler unterlaufen, vermutlich ist das dem Einfluß des hier immer noch mächtigen Bön-Glaubens zuzuschreiben. In Ringmo trägt Shakyamuni den Namen Shen-rap, die Gläubigen drehen die Gebetsmühlen linksherum statt nach rechts und wenden beim feierlichen Umwandeln der Gebetswände und Stupas die linke Schulter dem Heiligtum zu anstatt der rechten. Auch die Swastikasymbole in der größten Stupa sind umgekehrt, also nach links gerichtet, und auf den Gebetssteinen stehen Bön-Sprüche wie das om matri muye sa le du (»Vereinigt euch in Reinheit«),[51] die angeblich aus der Sprache von Sh'ang Sh'ung stammen, einem legendären Reich in Westtibet, wo nach der Überlieferung der Bön-pos die großen Lehren des Bön ihren Ursprung haben, die sich der tibetische Buddhismus einverleibte.
»Im Tibetischen gibt es keinen Ausdruck für Buddhismus. Die Tibeter nennen sich entweder Chos-po (Anhänger des Chos, des Dharma oder Prinzips des Universums, wie Buddha es gelehrt 147hat) oder Bön-po (Anhänger der Bön-Religion).«[52] In der Praxis hat jedoch der Bön-Glaube fast ebensoviel vom Buddhismus übernommen wie umgekehrt, so daß sich die beiden Lehren wenigstens oberflächlich nur unwesentlich unterscheiden.
Auf jeden Fall steht in Ringmo auch das Mantra om mani padme hum in den Felsen über dem Fluß gemeißelt, und eine blaue Buddha-Manifestation in den Wandgemälden stellt Padmasambhava, den Verfolger der Bön-Lehre dar. Einzelne Abbildungen an der Innen- und Außenwand der Stupas zeigen die traditionellen Symbole des tibetischen Buddhismus, wie die Muschelhörner des Sieges, die verflochtenen Schlangen, die viergeteilten Yin-Yang-Zeichen und die vier- oder achtblättrigen Lotusblüten. Die Bön-Lehre ist zu einer etwas rückständigen Sekte des Buddhismus degeneriert, und zumindest hier wird sie von ihren Anhängern auch so verstanden. Wie ein Ortsansässiger mir etwas verlegen verrät: »Ich bin ein Buddhist, aber ich gehe in der verkehrten Richtung um die Gebetssteine.«
Der Weg zum Bön-Kloster führt über den Fluß und dann durch Kartoffelfelder und Weidengebüsch in den immergrünen Wald. Obwohl Ringmo nicht unmittelbar am See liegt, lautet sein tibetischer Name Tsho-wa, »Am Seeufer«; ob das vielleicht der Name des versunkenen Dorfes war? Außer dem Kloster gibt es keine weitere Ansiedlung in der Nähe dieses Sees, über dessen Spiegel noch nie ein Boot gefahren ist. Seine durchsichtig blaugrüne Färbung läßt weißen Sand in der Tiefe vermuten. Wassertiere gibt es darin nicht, nicht einmal Algen leben in diesem von Felsen eingefaßten, wie ein Edelstein leuchtenden Wasser. Durch nichts verunreinigt, gleicht es jenem staubfreien Spiegel des Buddhismus, der »zwar eine endlose Bilderfolge zurückwirft, aber immer gleich, farblos und unwandelbar bleibt, obwohl von den Bildern, die er spiegelt, nicht verschieden.«[53]
Die heiligen Augen auf den kleinen Stupas am Ufer sehen mir lange nach. Hinter einem Birkenwäldchen tauchen die Klostergebäude auf, sie sind eng an die Felswand am Ostufer gebaut. Vor siebzehn Jahren lebten hier noch zwei Bön-Lamas und zwölf Mönche, jetzt ist alles zugeschlossen, nur einen alten, von einem großen Kropf geplagten Wärter und seine Frau treffe ich an. Er macht hölzerne Wasserfässer und grobe Gebetssteine, während 148die Frau ein winziges Kartoffelfeld bearbeitet. In Pungmo gebe es noch einen Bön-Lama, sagen sie und deuten nach Westen, aber wann er hierher käme, wüßten sie nicht. Enttäuscht mache ich mich auf den Rückweg. Zwei Tagesreisen nördlich von Shey Gompa liegt das Kloster von Samling, das der Mittelpunkt der Bön-Religion in diesen abgelegenen Bergen sein soll. Aber wenn wir den hiesigen Leuten glauben sollen, sind unsere Aussichten, Shey Gompa zu erreichen, ohnehin sehr gering.
Kalter Wind aus Norden. Ich wasche mir den Kopf. Um unsere Vorräte aufzustocken, werden Tukten und Gyaltsen heute nach Jumla aufbrechen, um Reis und Zucker einzukaufen, vielleicht finden sie dort auch Post vor. Wenn alles gutgeht, wollen sie um den 10. November in Shey Gompa eintreffen.
Gestern habe ich Briefe geschrieben, die Tukten mitnehmen kann. Das Schreiben deprimierte mich; es erweckte Sehnsüchte und die Sorgen um die Kinder. Das Bemühen, die außerordentlichen Erlebnisse der letzten Zeit in gewöhnlichen Worten zu schildern, hat mich von dem durch die Berglandschaft hervorgerufenen geistigen »high« heruntergeholt und die gesammelte innere Energie vergeudet, was einen Verlust an Selbstvertrauen und innerem Gleichgewicht zur Folge hat. Meine Beine sind wieder steif und schwer, und ich fürchte mich schon im voraus vor dem schmalen Sims in der westlichen Steilwand über dem Phoksumdo-See, den wir morgen überqueren müssen. Er ist von Ringmo aus zu sehen, und selbst GS war beim ersten Anblick bestürzt: »Dort möchte ich auch nicht jeden Tag spazierengehen«, meinte er. Ich fürchte auch den Schnee auf den hohen Pässen, der uns jeglichen Rück- und Ausweg aus der baumlosen Einöde abschneiden kann, wenn wir erst einmal dort oben sind. Diese Furcht macht den weiteren Weg nur noch schwerer, aber so zu tun, als sei sie nicht vorhanden, hat keinen Sinn. Es ist eine Sache, unzugängliche Berge zu besteigen, wenn man von Jugend an daran gewöhnt ist, aber es ist etwas anderes, in mittleren Jahren damit anzufangen. Nicht daß ich mich mit sechsundvierzig 149für alt halte, aber ich werde mich auf handbreiten Stegen an vereisten Hängen, auf glitschigen Baumstämmen über reißenden Sturzbächen und in den Gefahren, die klirrende Kälte und Schneestürme mit sich bringen, nie so recht wohl fühlen; im Hochgebirge bleibt wenig Spielraum für Fehler.
Warum denke ich so oft an den Tod, wenn ich doch das Gefühl habe, ihn nicht zu fürchten? Vor dem Sterben fürchte ich mich schon, besonders vor dem Erfrieren im eisigen Nordwind der Gletscher oder in den kalten Fluten dieses Sees, aber nicht vor dem Tod selbst. Und doch halte ich fest – woran? Warum diese gelegentlichen Anfälle von Verzagtheit und dieser Wunsch nach Fortdauer, wenn ich mich zu anderen Stunden unbeschwert wie ein Bharal auf den Steilhängen fühle, bereit, Wolf und Schneeleopard ins Auge zu sehen? Wohl muß ich achtgeben, denn ich habe halbwüchsige Kinder ohne Mutter großzuziehen und noch viel Arbeit vor, aber über einen gewissen Punkt hinaus sind dies nicht die wahren Gründe meiner Furcht. In meinem Innern tobt ein heftiger Widerstreit zwischen Anhaften und Loslassen. Hier nun endlich bietet sich mir Gelegenheit, loszulassen, »mein Leben zu gewinnen, indem ich es verliere«, was nicht Leichtsinn bedeutet, sondern Hinnahme, nicht Passivität, sondern Losgelöstheit.
Auch wenn ich könnte, würde ich jetzt nicht mehr umkehren. Meine Entscheidung, weiterzugehen, habe ich in eigener Verantwortung getroffen und muß sie nun mit ganzem Herzen annehmen. So schreibe ich es wenigstens nieder, in der heimlichen Hoffnung, mir mit diesen Worten selbst Mut einzuflößen.
Noch einmal spaziere ich um den Vorsprung herum, hinter dem der Gießbach in den Suli-Fluß stürzt. Unter Tannen und Silberbirken lecken kleine Wellen an den blaßgrauen Uferfelsen. Ein Zaunkönig und ein Taucher fliegen über dem quirlenden Wasser hin und her. Der braune Taucher ist mit der Nordamerikanischen Wasseramsel verwandt, und der winzige Zaunkönig ist der einzige Vogel, der aus der fernen Neuen Welt nach Eurasien eingewandert ist.
In der Strömung des Wildbaches klackern Geröllbrocken aneinander, und ein Stein, der sich vom Hang löst, trifft mich im Rücken. Von den hellen Augen einer Eidechse hypnotisiert, werde 150ich langsam ruhig. Dieser Fels, auf dem die Eidechse sich sonnt, lag unter dem Meeresspiegel, als die ersten Eidechsen geboren wurden. Nun höhlt das Wasser ihn aus, um ihn wieder dem Ozean zurückzugeben.
Wir müssen aus Ringmo verschwinden, ehe noch aus Dunahi die Nachricht eintreffen kann, daß wir nicht weiterdürfen. Die Bön-pos feilschen und zetern so lange über die Verteilung der Lasten, bis Jang-bu jedem einen Schnürsenkel aus seinen Stiefeln zieht, die Senkel vermischt und dann auf die Lastkörbe verteilt. Murrend schicken sich die Bön-pos in die Entscheidung dieses Loses.
Unruhig, in gedrückter Stimmung breche ich vor den anderen auf und habe schon einen Teil des Felssimses über dem See hinter mir, als mich die anderen einholen. Hie und da ist der Weg abgerutscht oder fehlt von jeher, die Löcher und Klüfte an solchen Stellen sind durch ein schütteres Flechtwerk aus Zweigen überbrückt. Einige Teilstrecken sind so schmal und der Hang darunter fällt so jäh ab, daß meine Füße mehr als einmal zaudern und mir vor Herzklopfen übel wird. Ein besonders schlimmes Stück zieht sich ohne den geringsten Halt für die Hand etwa dreißig Meter über den schroffen Uferfelsen um einen windigen Felsvorsprung. Ich gehe auf Knie und Handflächen hinunter und schiebe mich langsam vorwärts, bis ich nach einer Ewigkeit – aber immerhin noch in diesem Leben – eine Spalte erreiche, eine der wenigen Stellen, wo man einen anderen passieren lassen kann. Nach Atem ringend drücke ich mich hinein und warte, daß die anderen mich überholen.
Schon eine Zeitlang habe ich hinter mir das Lachen und Plaudern der Träger näher kommen gehört. An dem gefährlichen Vorsprung nun geschieht etwas Seltsames. Noch sehe ich sie nicht, als sie plötzlich verstummen, wie Vögel beim Schatten eines Falken. Die Stille in der Stille wird fast greifbar. Dann tauchen sie, einer nach dem anderen, um den Felsvorsprung auf, als Silhouette gegen den Himmel, unwirkliche Gestalten unter unförmigen Traglasten, die jeden Moment drohen, gegen die Felswand 151zu stoßen und sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Sie kommen auf mich zu, langsam und unbeirrt wie ein Ameisenzug, und doch scheinen sie mit einer mühelosen, fast ätherischen Leichtigkeit dahinzugleiten, als ob eine Art innerer Sammlung sie knapp über dem Boden schweben ließe. Weit nach vorne in den Tragriemen um ihre Stirn gestemmt, die Finger tastend abgespreizt, streifen sie leicht die Felswand zur Linken, schwingen zurück in den Nordwind zur Rechten. Fingerspitzen berühren meine Oberschenkel, eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Hände, aber ihre Konzentration ist so groß, daß sie den Unterschied zwischen kalter Felsoberfläche und warmen Bluejeans nicht zu bemerken scheinen. Stumm, wahrnehmungslos, mit einem glasigen Ausdruck in den Augen zwängen sie sich an mir vorbei in ihren wollenen Stiefeln und wallenden Gewändern und lassen in der klaren Luft den Geruch von Rauch und ranzigem Fett zurück. Hinter der Gefahrenstelle setzt schlagartig ihr Geplapper wieder ein, als führe jeder, aus einer Trance erwacht, den vorhin unterbrochenen Satz fort.
Hinter ihnen kommen die Sherpa. Phu-Tsering lächelt mir unter der roten Kappe mit blitzenden Goldzähnen ermutigend zu. GS erscheint als letzter mit gewohntem sicheren Schritt. Ich bin froh, daß der Felsvorsprung mein unrühmliches Kriechen auf Händen und Knien ihren Blicken entzogen hat. Als GS sich an mir vorbeizwängt, bemerkt er beiläufig: »Das ist bisher das erste wirklich interessante Wegstück.« Wie leicht könnte ich ihn mit einem Schubs hinunterbefördern!
Die zweite Hälfte des Simspfades ist angenehmer, so daß ich die unglaubliche Aussicht zu genießen vermag. Unter mir der türkisblaue See, dessen Spiegel nie ein Ruder durchbrochen hat, und ringsum, gleichsam als Rahmen des Himmels, ein Kranz von Schneegipfeln. Eine Schlucht spaltet den Felshang, das Wasser, das von einem kleinen Gletscher darin herabfällt, mündet in einer kleinen Bucht mit glatten Kieseln in den See. Von hier aus geht es nochmals steil zum Nordwesthang über dem Phoksumdo-See hinauf.
Hoch über dem See wartet GS auf mich, schon von weitem deutet er auf etwas am Boden. Lange sehe ich die Exkremente und die Pfotenabdrücke an, die in verkümmertes Wacholder- 152und Rosengebüsch hineinführen. »Er ist vielleicht ganz in der Nähe und beobachtet uns«, sagt GS leise, »während wir ihn nicht entdecken können.« Er sammelt die Leopardenlosung ein, und wir gehen weiter. Auf dem Kamm, wo ein heftiger Wind weht, mißt der Höhenmesser etwas über 4000 Meter.
Nun senkt sich der Weg zwischen Schnee- und Eisfeldern zu einem Birkenwäldchen am Seeufer. Am Nordende teilt sich der Phoksumdo-See in zwei Arme, die von Ringmo aus nicht sichtbar sind und in versteckte Flußtäler übergehen. Der östliche Arm, auf der anderen Seite des Sees, erlaubt uns einen Blick in ein geheimnisvolles, wunderschönes Flußtal, das steil in die Schatten der Berge hinaufstrebt. Der nordwestliche Arm, dem wir folgen, verjüngt sich zum Tal des Phoksumdo-Flusses, der mit seinem sumpfigen Delta aus Tundra-Bächen, Kiesbänken und Weiden so sehr einer Landschaft Alaskas ähnelt, daß wir beide mit einem Ausruf der Überraschung stehenbleiben. Ein kalter Wind kräuselt die Oberfläche der grauen Bucht, schon früh am Nachmittag sinkt die Sonne hinter das Kanjiroba-Massiv. Shey Gompa liegt mehr als 600 m höher als unser Lager am Nordufer, dort wird es noch wesentlich kälter sein. So können wir nur hoffen, daß dort die Berge im Westen nicht so hoch sind und wir länger die Abendsonne genießen können, denn wir haben nur wenig Brennstoff für die Lampen, an die Beheizung unserer Zelte ist nicht zu denken.
Allmählich färbt sich der Nordhimmel lavendelblau. Das kalte Seewasser gluckst über den grauen Kieseln, nirgends ein Lebenszeichen eines Vogels.
Vom Seeufer, wo die Ringmos ihr Lager aufgeschlagen haben, schallt Gesang herauf. Mir will der unheimliche Trance-Zustand der Leute nicht aus dem Sinn, als sie auf dem Felssims an mir vorüberzogen. Ob dies eine primitive Form der als Lung-gom[54] bekannten tantrischen Praktik ist, die es dem Adepten erlaubt, sich mit unglaublicher Geschwindigkeit und unfehlbarer Sicherheit fortzubewegen, sogar bei Nacht? »Der Laufende darf weder sprechen noch sich umschauen, er muß die Augen auf ein einzelnes, entferntes Objekt richten und darf seine Aufmerksamkeit durch nichts ablenken lassen. Sobald der Trance-Zustand erreicht ist, schaltet sich ein großer Teil des Normalbewußtseins aus 153und nur so viel davon bleibt übrig, daß der Läufer die Hindernisse auf dem Weg erkennt und die Richtung zum Ziel einhält.«[55] Lung-gom bedeutet wörtlich »Wind-Konzentration«, wobei der Begriff »Wind« oder »Luft« dem Sanskritwort Prana entspricht, das die Lebenskraft oder den Lebensatem bezeichnet, der alle Dinge beseelt. Und wenn die Materie aus Energie besteht, so kann man Lung-gom vereinfachend als die Beherrschung der Materie durch den Geist erklären oder als Materie, die in den Energiezustand zurückkehrt (mit entsprechender Abnahme des Gewichtes und der Schwerkraft), so daß sie frei fließen kann. Auf die gleiche yogische Beherrschung des materiellen Körpers dürfte sich auch die Fähigkeit zur »Unsichtbarmachung« zurückführen lassen, welche fortgeschrittene Yogis erlangen. Es heißt, daß sie ihr Sein und dessen Schwingungen so vollständig ruhigstellen können, daß ihre Körperlichkeit im Geist oder im Gedächtnis anderer Personen keinen Eindruck hinterläßt. Diese Beherrschung schließt auch die Rekristallisation der Energie in eine andere Gestalt ein, wie sich beispielsweise Milarepa zur Abschreckung seiner Feinde der Magie der Nyingma-pa-Tantras bediente und sich am Lachi-Kang (Mount Everest) in einen Schneeleoparden verwandelte. Seit den Zeiten Marco Polos berichten erstaunte Asienreisende von den Kräften, über die Heilige und Zauberer in Asien verfügen; ähnliche Trance-Praktiken sind auch von den amerikanischen Indianern und anderen Naturvölkern bekannt.
Die christliche und moslemische Überlieferung kennt ebenfalls das Phänomen der Levitation; so hat sich der heilige Joseph von Cuperino im Zustand der Ekstase erhoben und schwebte in die Bäume davon. Einmal soll er, wie ein Augenzeuge aus dem siebzehnten Jahrhundert berichtet, »aus der Mitte des Kirchenschiffs wie ein Vogel aufgestiegen und zum Hochaltar geflogen sein, wo er das Tabernakel umarmte.«[56] Solche ungewöhnlichen Fähigkeiten, seien sie nun durch Übungen erworben oder nicht, können den Adepten vom wahren Pfad der mystischen Gotteserfahrung ablenken; sie sind deshalb von den großen Lehrmeistern nie sonderlich geschätzt worden.[57] Im Mönchsorden des Buddha Shakyamuni zählte – nach Unkeuschheit, Diebstahl und Mord – auch das Sich-Rühmen für Wunderkräfte zu den Hauptvergehen 154gegen die Mönchsgelübde. Einmal soll Shakyamuni die Erlangung der Levitation durch einen seiner Schüler als wenig hilfreich abgetan haben, und ein anderes Mal weinte er vor Mitgefühl für einen Yogi, daß er zwanzig Jahre seiner menschlichen Existenz damit vergeudet habe, auf dem Wasser gehen zu lernen, wo ihn doch jeder Fährmann für eine kleine Münze ans andere Ufer gebracht hätte.
Beim Feuerschein unterhalten wir uns über den Schneeleoparden. Wie GS sagt, ist das Tier nicht nur selten, sondern auch in höchstem Maße wachsam und mit einer fast magischen Fähigkeit begabt, sich unsichtbar zu machen. Es ist seiner Umgebung so gut angepaßt, daß man wenige Meter vor ihm stehen könnte, ohne es zu erkennen. Auch Ortskundigen gelingt es nur selten, einen Schneeleoparden zu überraschen. Am häufigsten wurde er von Jägern gesehen, die bewegungslos eine Wildherde beobachteten, wenn er plötzlich aus seinem Versteck hervorbrach, um ein Tier zu schlagen. Ein Erforscher Zentralasiens und Tibets sah Wölfe, Wildesel, Argalis oder »Marco-Polo-Schafe«, Orongo- oder Tibet-Antilopen, wilde Kamele, Bären und sogar den Turkestanischen Tiger, erwähnt aber den Schneeleoparden nicht mit einem Wort.[58] In vielen Jahren der Suche nach dem Schneeleoparden hat GS nur zwei ausgewachsene Tiere und ein Jungtier gesehen. Die erste Begegnung mit Panthera uncia hatte er 1970 in Chitral Gol in Pakistan; im vergangenen Frühjahr gelangen ihm in derselben Region, nach einem vollen Monat Wartezeit mit lebenden Ziegen als Köder, die ersten Filmaufnahmen, die jemals von Schneeleoparden in der Wildnis gemacht wurden.
Der Schneeleopard lebt gewöhnlich in Höhen zwischen 1500 und 5500 Meter. Nirgends häufig, erstreckt sich sein Lebensraum über ein weites Gebiet der Zentralasiatischen Gebirge, vom Hindukusch in Afghanistan nach Osten über den ganzen Himalaja und Tibet bis nach Südchina hinein; nach Norden bis zu den Gebirgen der UdSSR an der sibirisch-mongolischen Grenze und nach Westchina bis zur Sayan-Region. Die seltenen gefangenen Wildtiere stammen meist aus dem Tienschan-Gebirge der UdSSR, wo nur wenige Exemplare der sonst geschützten Tierart gefangen werden dürfen.
Der typische Schneeleopard hat helle, graue Augen und einen 155hellen, nebelgrauen Pelz mit schwarzen Rosetten, deren Konturen im dicken Fell verschwimmen. Die ausgewachsenen Tiere sind nur selten schwerer als 50 Kilogramm und länger als 2 Meter samt dem bis zur Spitze buschigen, langen Schwanz. Ein Schneeleopard reißt jedoch mühelos Tiere, deren Körpermasse das Dreifache seiner eigenen beträgt, er hat riesige Klauen und einen Kopf mit kurzer Schnauze. Er ist ein kühner, geschmeidiger Jäger, der zu phantastischen Sprüngen fähig ist. Im allgemeinen sind Blauschafe seine Beutetiere, doch greift er auch Rinder- und Yakherden an, wobei er junge Yaks von mehreren hundert Pfund Gewicht tötet. Mit einem Menschen hätte er leichtes Spiel, doch ist nicht bekannt, daß ein Schneeleopard jemals einen Menschen angegriffen hätte.
Der Schneeleopard ist die geheimnisvollste der großen Wildkatzen, und über sein soziales Verhalten ist nichts bekannt. Fast immer trifft man Einzeltiere. Man weiß auch nicht, ob bei einem gerissenen Beutetier mehrere Schneeleoparden zusammenkommen, wie die Tiger, oder ob es sich bei ihnen, ganz nach Art der Leoparden, um ungesellige Einzelgänger handelt.
Gestern abend machten wir an der Mündung des Phoksumdo-Flusses ein großes Lagerfeuer aus Treibholz, lange saß ich dort und sah den aufsteigenden Sternen nach. Nach einer Weile kamen die Leute aus Ringmo lachend und singend aus ihrem Höhlenlager herauf und ahmten alles nach, was die Sahibs und Sherpa machten: »Thak you!«, »Ferry good!«, »Ho! Dawa!« Die bunt gekleideten Burschen sind unbefangen und lustig, und doch steckt Aggressivität in ihrem Verhalten, so daß wir ihnen nicht trauen. Gestern vor dem Aufbruch haben sie zwei Stunden vertrödelt, um sicherzustellen, daß sie nicht zwei lange, sondern drei kurze Tagesmärsche zurücklegen und bezahlt bekommen werden. Unterwegs legen sie ständig Rastpausen ein, und heute beschwert sich ein Mann über seine Last, wodurch er auch die anderen aufwiegelt. Da Jang-bu sich den Leuten gegenüber unentschlossen zeigt, schreit GS den Mann aus Ringmo an, entweder 156den Mund zu halten oder nach Hause zu gehen. Heute wirkt es, aber wir sind ja nur wenige Wegstunden von Ringmo entfernt; hoch oben im Schnee dürfte sich die Sache anders ausnehmen. Wir sind diesen »rotgesichtigen Teufeln« ausgeliefert, was sie nur zu gut wissen. Vielleicht sollten wir sie auf dieselbe herrische Weise behandeln, in der um die Jahrhundertwende ein Reisender mit aufsässigen Tibetern umging. In seinem Reisebericht schrieb er: »Ich stürzte mich auf ihn, packte ihn beim Zopf und gab ihm ein paar kräftige Schläge ins Gesicht. Als ich losließ, warf er sich zu Boden und bat heulend um Vergebung. Um ihm und den anderen Tibetern ein für allemal zu zeigen, wer hier der Herr war, ließ ich ihn meine Schuhe mit der Zunge sauberlecken … Er versuchte, davonzukriechen, aber ich faßte ihn nochmals am Zopf und beförderte ihn mit einem Tritt die Stufen hinunter, die er ohne Erlaubnis heraufgekommen war.«[59]
(Dieser aufrechte Brite wurde unterwegs in Westtibet ständig von Räubern belästigt – vielleicht nannte er sein Buch deswegen In the Forbidden Land [Im verbotenen Land]. Aber Tibet war nicht immer ein »Verbotenes Land«, vor den Gurkha-Invasionen im späten siebzehnten Jahrhundert und einigen nachfolgenden chinesischen Einfällen [einschließlich der von 1910 und 1950] hieß es die seltenen Besucher willkommen. Allerdings war es immer schon abgelegener und unzugänglicher als alle anderen Länder der Erde, dauerte doch vor der letzten chinesischen Invasion die Reise von Peking nach Lhasa volle acht Monate.[60])
Heute vor einem Monat sind wir aus Katmandu aufgebrochen, theoretisch könnten wir morgen Shey erreichen, also zwei Wochen später als geplant. GS, der wegen der Verzögerungen besorgt war, stellt erleichtert fest, daß die Blauschafe noch keinerlei Anzeichen von Brunft zeigen. Es ist vor allem eine Kostenfrage: immer wieder wurden die Träger fürs Herumsitzen und Dösen bezahlt. GS hält sich streng an sein Budget – er ist überaus penibel in seiner Verantwortung gegenüber seinen Geldgebern -, und in Pokhara war die Expedition bereits so knapp bei Kasse, einschließlich meiner eigenen, daß wir uns keinen zusätzlichen Träger für eine Last Kerosin, einige Konserven und auch nur eine Flasche Alkohol leisten konnten. Wurst, Kekse und Kaffee sind bereits ausgegangen, Zucker, Schokolade, Käse, Erdnußbutter 157und Sardinen gehen zur Neige, und bald werden wir uns mit bitterem Reis, grobem Mehl, Linsen, Zwiebeln und ein paar Kartoffeln ohne Butter begnügen müssen. Die Tage sind kurz, Heizmaterial gibt es überhaupt nicht, Brennstoff für die Lampen nurmehr wenig, so daß das Leben in Shey Gompa recht karg zu werden verspricht. Wir werden viel Zeit in unseren Schlafsäcken verbringen müssen, um uns warm zu halten, wobei ich in meinem elenden Zelt nicht einmal aufrecht sitzen kann und mit gekrümmtem Rücken und steifem Nacken darin hocken muß.
Rote Blätter treiben auf der stillen Bucht, ein Bön-po hustet. Hoch auf einer Bergwiese unter dem Himmel grasen Blauschafe. Im Hochgebirge hängt die Tageslänge an einem Ort von der Position der umgebenden Gipfel ab. Heute zeigt sich die Sonne achtzig Minuten früher als gestern über dem Tal des östlichen Seearmes. Wenig später sind wir unterwegs, das Westufer des Phoksumdo Khola entlang, in Richtung auf die Einmündung des Kang-Flusses.
Aus der Richtung des Kanjiroba tönt das Donnern von Lawinen; sie müssen an der für uns unsichtbaren Südseite des Berges, ausgelöst von in der Sonne schmelzendem Schnee, niedergehen, denn wir können keinen aufgewirbelten Schneestaub ausmachen, nur die glitzernde weiße Spitze vor dem blauen Himmel. Das Geräusch der Lawinen erinnert mich an das Brausen des großen Wasserfalles bei Phoksumdo, oder auch an die Brandung in schwerem Sturm: ein hohles, tiefes Donnern, wie ein Echo des Infernos der Schöpfung.
Sogar im hellen Sonnenschein wirkt das Tal mit seinen verkrümmten Birken und schütteren Weiden düster, die einzigen Vögel sind Hunderte kleiner toter Rotschwänzchen auf den Kiesbänken, offenbar ein ganzer Schwarm auf dem Weg in den Süden, der Schneestürmen des Oktober zum Opfer gefallen ist. Die bedrückten Mienen unserer Leute zeigen an, daß sie die toten Singvögel und das Donnergrollen der Berge für Warnungen der Berggeister halten, die in den tibetischen Legenden so oft die Pilger heimsuchen. Vielleicht werden wir morgen schon unser Reiseziel erreichen, aber GS meint, morgen würden wir wohl den härtesten Tagesmarsch überhaupt vor uns haben, selbst wenn sich die Träger als zuverlässig erweisen. Er hat vor, seinen Schlafsack 158selbst zu tragen, und empfiehlt mir, dasselbe zu tun: »Bei gutem Wetter macht eine Paßhöhe von über 5000 Meter nicht viel aus, aber das Wetter kann in dieser Höhe sehr schnell umschlagen und deshalb ist damit auch nicht zu spaßen; die Temperaturgrenze, bei der du anfängst zu frieren, kann sich durch plötzlichen Wind um fünfzehn bis zwanzig Grad verschieben. Für alle Fälle, auch den eines Unfalls, habe ich den Schlafsack gerne bei mir.« Auch GS scheint bedrückt zu sein. Obwohl wir nicht davon sprechen, wissen wir beide, daß Verletzungen oder Krankheiten in dieser Gegend eine ernste Angelegenheit sind, und mit jedem weiteren Tagesmarsch wären sie um so gefährlicher. Den Hin- und Rückweg gerechnet, ist Pokhara zwei Monate entfernt. Die nächste Funkstation befindet sich in Dunahi, und selbst wenn sie ausnahmsweise einmal funktionieren sollte, wäre es fraglich, ob sie einen Arzt erreichen könnte, der bereit wäre, wegen eines Fremden seine Praxis zu schließen und einen langen Fußmarsch über die Berge anzutreten. Kurzum, im Notfall können wir wohl kaum mit Hilfe rechnen. »Mit einem komplizierten Knochenbruch kann man noch durchkommen«, sagt GS. »Aber ein Blinddarmdurchbruch …« Den übrigen Satz kann er sich sparen.
In diesem grauen Tal gibt es keinen richtigen Pfad, sondern nur hin und wieder eine undeutliche Spur, die sich im Gebüsch oder zwischen den Steinen verliert. Es vergehen Stunden, ehe wir die Mündung des Bergbaches erreichen, der den Eisfeldern am Kang-La entspringt. Die Schlucht ist dunkel und so eng, daß wir mehrmals das reißende Gewässer durchwaten müssen. Jedesmal, wenn wir uns die Socken und Hosen ausziehen, machen die Ringmos ein großes Hallo, in der einfältigen Hoffnung, daß die Fremden auf den glitschigen Felsen ausrutschen und sich den Kopf einschlagen oder wenigstens ein kaltes Bad nehmen. Aber mit tauben Füßen ziehen wir ohne Zwischenfall weiter. Ein Stück weiter oben, wo die Kluft sich etwas weitet, streckt sich eine Schneezunge von Osten vor, und genau hier an der Baumgrenze setzen die Träger ihre Lasten ab; weiter oben, sagen sie, sei es zu kalt für ein Lager. GS ist nirgends zu sehen (später gestand er mir, er habe in der Nähe des Pfades gesessen und habe uns vorbeiziehen lassen; er mußte einfach eine Weile für sich alleine sein). Da Jang-bu wieder seine unentschlossene Miene aufsetzt, 159greife ich ein und schreie die Leute an, daß sie nun schon zum zweiten Mal nur eine halbe Tagesarbeit geleistet hätten und daß wir nie über den hohen Paß kämen, wenn wir jetzt nicht weitergingen und anderntags nicht früher aufbrächen. Zu meinem Erstaunen laden sie wortlos ihre Lasten auf und gehen noch eine Stunde lang weiter.
In einer scharfen Biegung der Schlucht liegen drei schmale Birkenstämme über den Felsen, mit großen Steinen beschwert. Offenbar haben Reisende vor uns sie als Brücke benutzt, denn das Wasser ist hier tief und zu reißend, als daß man es durchwaten könnte. Gischt aus dem Bach hat die wacklige Brücke mit einer dicken Eisschicht überzogen, und ohne Scham überquere ich sie auf allen vieren. Sherpa und Träger balancieren mit ausgestreckten Armen herüber. Nur Dawa mit seinen klobigen Stiefeln verachtet jegliche Hilfestellung; er schwankt auf den glatten Stämmen hin und her und hackt dabei mit der Hacke, die uns am Paß als Eispickel dienen soll, noch auf dem Eis herum. Ich bin naß und kalt, und dieser Leichtfuß trägt meine einzigen trockenen Sachen und meinen Schlafsack. Endlich ist auch er herüber.
Oberhalb der Brücke lagern wir in 4300 Meter Höhe in einer großen Höhle unter einem überhängenden Fels. Um allein sein zu können, steige ich ein Stück flußaufwärts und beobachte ein paar Graufinken, die im Schnee nach Nahrung suchen. An diesem Abend ist mir weitaus wohler, warum eigentlich? Ich mag den grauen Phoksumdo Khola ebensowenig wie diese düstere Klamm. Dicke schneeträchtige Wolken ziehen nach Norden, und die Träger sehen immer wieder kopfschüttelnd zur Paßhöhe hinauf. Dennoch bin ich ruhig, zu allem bereit, was da kommen mag, und deshalb glücklich. Meine Stimmung änderte sich heute morgen, als Dawa den Rucksack von Jang-bu, den ihm dieser über einen Bach zuwarf, ungeschickt ins Wasser fallen ließ. Zu meiner großen Verwunderung lachte Jang-bu schallend auf und Dawa und Phu-Tsering stimmten in das Gelächter ein, obwohl nun der Schlafsack und alle anderen Habseligkeiten des Sherpa-Führers klitschnaß waren. Die Zuversicht der Leute und ihr tiefes Lebensvertrauen, das nichts mit Fatalismus gemein hat, beschämten mich.
160
Am steilen Uferhang des Canyon steht mein Zelt ziemlich schief zwischen scharfen Gesteinsbrocken, dennoch habe ich gut geschlafen und wache gutgelaunt auf. Auch das Frühstück aus heißem Tee und Tsampa schmeckt mir ausgezeichnet. Im ersten Licht machen wir uns aus dem Höhlenlager auf den Weg, noch ehe die Bön-pos schimpfend aus ihrem Birkenwäldchen zum Vorschein kommen; solange sie keinen Lohn erhalten haben, sind sie gezwungen, uns zu folgen. Hochgestimmt stellen GS und ich fest, daß wir höchstwahrscheinlich heute in Shey eintreffen werden.
Wie GS gesteht, war auch er gestern niedergeschlagen und verdrossen. »Diese verdammten Träger aus Ringmo sind noch schlimmer als die dreckigen Kamis. Und die Sherpa gehen mir langsam auch auf die Nerven, sie verschwenden und zerbrechen alles, was ihnen in die Finger kommt: Gib ihnen etwas in die Hand, und nach einem Tag sieht es aus, als hätten sie es einen Monat lang benutzt. Gestern konnte ich einfach keine Leute mehr sehen, das war alles.« Im stillen, klaren Morgenlicht schaut er in die mit einer dicken Schneedecke überzogene Schlucht hinauf. »Das ist es, worauf es mir ankommt«, sagt er, während er seinen Rucksack schultert, »in ein Tal aufsteigen zu können, ohne auf menschliche Kothaufen zu stoßen.«
Bald darauf ist er hinter einer Biegung des Flußtales verschwunden. In der sirrenden Leere höre ich nur das gedämpfte Rauschen des Wildbaches unter der Eisdecke, die sich in der Nacht gebildet hat. Ich drehe mich langsam im Kreis und nehme das Bild der wuchtigen Felsen mit dem Schnee und dem Himmel darüber in mich auf. Ein gewaltiger Gletscher versperrt die Sicht nach Süden wie ein gefrorener Wasserfall, aber das Sonnenlicht, das diese Eiswand hinabfließt, hat den Rand des Canyon über meinem Kopf noch nicht berührt. Im grauen Dämmerlicht klettere ich der Sonne entgegen.
Von Eis und Schnee bedecktes, glitschiges Geröll macht den Aufstieg mühsam. Etwa 600 Meter über dem Lager, wo die Schlucht sich öffnet, trete ich in das Sonnenlicht. Nach der Karte von GS müßte jetzt ein steiler Aufstieg nach Norden erfolgen, 161aber die Karten dieser Gegend sind eher phantasievoll als genau. David Snellgrove, ein Kenner des tibetischen Buddhismus, der im Mai 1956 Shey Gompa aufsuchte (und dessen vorzügliches Buch[61] es mir ermöglicht, über die Ikonographie dieser Gegend zu berichten, ohne sie selbst eingehender studiert zu haben), hatte sein Lager weiter oben, am Ende des langen Canyon aufgeschlagen und sagt nicht, daß er für den Aufstieg zum Kang-La ein Stück Weg zurückgekehrt wäre. Da ich die Genauigkeit von Gelehrten wie ihm gerade in Kleinigkeiten kenne, scheint mir deshalb, daß der Aufstieg zum Paß etwa anderthalb Kilometer weiter oben beginnen muß.
Aber GS, sicher, daß er es besser weiß, steigt querfeldein in Richtung Norden auf. Ich warte in der Sonne auf die Leute aus Ringmo, um zu sehen, welche Richtung sie einschlagen; zwei von ihnen sind in einer freundlicheren Jahreszeit bereits in Shey gewesen. Sie erscheinen kurze Zeit später – die Kälte im Canyon scheint sie zu dieser ungewohnten Eile angetrieben zu haben. Kaum haben sie die Sonne erreicht, machen sie erst einmal Rast; dann gehen sie ohne Zögern weiter in Richtung auf das Ende der Schlucht. GS ist hinter einem Grat verschwunden, meine Rufe in dem nun leeren Tal erhalten keine Antwort. Entweder muß er dem Grat entlang nach einem Übergang zur Paßroute suchen, oder er wird umkehren und unseren frischen Spuren im Schnee folgen. Es gibt Anzeichen für Schafe hier, vielleicht ist er auch auf eine Na-Herde gestoßen.
Am Ende der Schlucht wird ein schmaler Bergpfad erkennbar, der an einer Reihe gefrorener Wasserfälle entlang zu einer Stelle führt, wo Weg und Bergbach unter Schneewehen verschwinden. Die Träger haben alle paar Minuten eine Pause eingelegt, seit sie aus der Kälte des Canyon aufgetaucht sind. Nun, auf einem schmalen Kamm, der windgeschützt und schneefrei ist, wollen sie wieder einmal nicht weitergehen. Um die Spur für sie zu treten, gehe ich vor, breche aber ständig bis über die Knie durch die Firnkruste. Schließlich kämpfe ich mich zu den gefrorenen Fällen durch und klettere auf den halb freiliegenden Felsen des Baches weiter den Schneefeldern entgegen, bis auch diese Felsen unterm Schnee verschwinden.
Die hohen Schneefelder unterhalb der Gipfel können einem 162mit ihrer überwältigenden Stille Angst einjagen. Wie ich sehe, ist mir niemand gefolgt, auch von GS ist nirgends etwas zu sehen. In der Hoffnung, daß die Sherpa mit den Trägern zurechtkommen, suche ich nach einem Übergang durch den Schnee, aber wohin ich mich auch wende, der Schnee trägt mich nicht. In der dünnen Luft ständig einbrechend, bin ich nach wenigen Metern schon erschöpft. Der einzig mögliche Weg scheint über ein Plateau geradeaus nach Westen zu einem Bergkamm zu führen, wo der Wind offenbar einen Teil des Schnees fortgeblasen hat.
Zwei Bön-pos ohne Traglast kommen mir nach, um zu sehen, wie es weitergeht; die Sherpa sind aus irgendwelchen Gründen zurückgeblieben. Da kein Übersetzer zur Verfügung steht, mache ich ihre Trödelei pantomimisch nach; es gelingt mir, sie zum Lachen zu bringen, und sie erklären sich bereit, die Lasten bis zu diesem Plateau heraufzuschaffen. Bis dahin dürfte auch GS wieder auftauchen, oder wenigstens Jang-bu, damit wir eine Entscheidung treffen können.
Aber die Träger treffen erst am frühen Nachmittag ein, und aus der Art, wie sie ihre Lasten in den Schnee werfen, ist sofort ersichtlich, daß etwas nicht stimmt. Auch die Sherpa schauen ziemlich unglücklich drein. Ich zeige auf den hohen Bergkamm im Westen, der weniger tief im Schnee zu liegen scheint; Kang-La ist in einem Aufstieg von zwei Stunden erreichbar, wir müssen nur abwechselnd die Spur treten … Aber die Leute aus Ringmo schütteln den Kopf. Die Schneefelder sind unbegehbar, und außerdem es ist zu spät heute, zu spät im Jahr, um überhaupt nach Shey zu gehen, zu kalt, um hier zu lagern. Während ich versuche, sie zu überreden, frage ich mich, wo zum Teufel dieser GS stecken mag. Jang-bu und Phu-Tsering sind entmutigt. Es ist den Ringmos gelungen, sie davon zu überzeugen, daß – selbst wenn wir den Kang-La erreichen – die Nordseite des Passes lebensgefährlich steil und vereist sei. Habe doch erst im letzten Jahr ein Mann sein Leben dort verloren! Und wie sollen Gyaltsen und Tukten uns in dieser Einöde finden, wo doch der Wind in kurzer Zeit alle Spuren verweht?
Ich, der ich mit meiner leichten Last schon atemlos und erschöpft bin, kann es ihnen nicht verdenken, daß sie umkehren wollen. Wir haben genug Blauschafe und Spuren von Schneeleoparden 163im Gebiet des Phoksumdo-Sees gesehen, weshalb sie nicht dort beobachten; außerdem gibt es, falls einmal etwas passiert, vom Phoksumdo aus wenigstens noch eine Verbindung zur Außenwelt. Vor dem Gedanken, daß uns der Winterschnee den Rückweg abschneiden könnte, wenn wir einmal jenseits des Kang-La sind, graut mir besonders. Andererseits sind wir zu weit gereist, um jetzt, kurz vor dem Ziel, aufzugeben. Es sind nicht viel mehr als anderthalb Kilometer bis zum Kang-La und vielleicht nur noch ein Tagesmarsch bis Shey Gompa – GS wird sich niemals auf einen Rückzug einlassen, selbst wenn ich ihn im Stich lassen wollte, was ich natürlich nicht tun werde.
Gegen Osten und Süden dräuen schwere Wolken über den Bergen, und Schneeschauer kommen und gehen. Ich sorge mich um GS, obwohl ich die ebenfalls besorgten Sherpa zu beruhigen versuche. Selbst wenn die Ringmos sich nicht weigerten, könnten wir nicht weitergehen, denn GS könnte einen Unfall gehabt haben. Vielleicht wartet er am Grund einer Eisspalte auf unsere Hilfe, während die bitterkalte Nacht heraufzieht. Zum Glück hat er wenigstens seinen Schlafsack bei sich, sage ich mir.
Die Ringmos murren, sie wollen die weiße Einöde zurücklassen und in der geschützten Schlucht Zuflucht suchen, solange das Licht noch ausreicht. Nachdem ich nochmals alle Hänge und Grate mit dem Fernglas abgesucht habe, gebe ich den Befehl, die Lasten hinter einer Schneewehe abzustellen, wo der kreiselnde Wind eine Stelle auf dem schwarzen Geröll freigelegt hat, und sie mit einer Zeltplane zuzudecken. Von hier aus, so verkünde ich, werden wir morgen früh aufbrechen – ich bekomme keine Antwort. Dawa und Phu-Tsering schicke ich mit dem nötigsten Geschirr und Vorräten zum Höhlenlager, wo es Brennholz gibt, während Jang-bu und ich den Spuren von GS nachgehen wollen, in der Hoffnung, ihn noch vor Einbruch der Dunkelheit zu finden.
Um Jang-bu zu trösten, habe ich gesagt, daß wir GS sicherlich auf dem Weg zurück zur Schlucht treffen werden. Und tatsächlich, kaum haben wir mit dem Abstieg begonnen, kommt er uns jenseits der Eisfälle entgegen. Schon von weitem sieht man ihm an, daß er nicht gerade erfreut ist, uns diesseits des Passes zu treffen; er besteht darauf, seine Karte sei richtig und die Leute 164hier wüßten nicht Bescheid, obwohl er den Kang-La nicht gefunden hat. »Mir scheint, dieser Tag ist ziemlich vermurkst worden«, sagt er in einem anklagenden Ton, verärgert über die Andeutung, daß sein Verschwinden, von allem anderen einmal abgesehen, uns alleine schon vom Weitermarschieren abgehalten hätte. Vermutlich wäre sein Ärger größer gewesen, wenn er bei Einbruch der Dunkelheit irgendwo mit gebrochenem Bein in den Eisfeldern gelegen hätte, während die Expedition den Weg nach Shey weiterzog. Ich verkneife mir, darauf hinzuweisen, daß er weder gestern noch heute zugegen war, als die Träger meuterten, und daß wir ohne mein Eintreten nicht einmal bis hierher gekommen wären. Statt dessen bemerke ich nur, die Träger hätten sich geweigert weiterzugehen, und sogar die Sherpa seien der Meinung, wir sollten uns mit dem Schneeleoparden und den Blauschafen bei Ringmo zufriedengeben … Nein, erwidert GS, die Herden bei Ringmo sind wild und zerstreut, da sie dauernd von Leuten wie diesen grindigen Trägern dort belästigt werden – wir gehen nach Shey.
Ich grinse zu Jang-bu hinüber, der traurig zurücklächelt. Da er weiß, wie sehr ich vom Spurtreten erschöpft bin, hat er sein Gepäck einem Träger gegeben und bietet mir freundlich an, das meine zu tragen. Um GS zu besänftigen, sage ich: »Nein, nimm lieber das von George.« Was GS ohne irgendein Dankeswort für mich oder Jang-bu akzeptiert und schweigend den Abstieg antritt. Jang-bu läßt sich noch so viel Zeit, um mir zuzuraunen: »Wenn es weiter so schneit, werden wir nie nach Shey Gompa kommen.« (In Wirklichkeit drückt er sich etwa so aus: »Mehr Schnee, nie gehen Shey«, denn das Englisch der Sherpa ist eher flüssig, als grammatikalisch richtig.) Ich sage, als Sherpa-Führer müsse er sich ein Herz fassen und seine Meinung vor GS vertreten. Ob er es getan hat, weiß ich nicht.
Langsam steige ich hinter den anderen den Berg hinunter, die Aussicht, in das dunkle Lager zurückzukehren, lockt mich wenig. Obwohl die Mühen des Tages mit einer Niederlage endeten, trotz des Verlustes von tausend erklommenen Höhenmetern, die morgen dann wieder vor uns liegen, trotz des düsteren Canyon, des unsicheren Wetters und der üblen Laune meines Freundes, und trotz der ungewissen Aussichten für den kommenden Tag bin ich 165mit mir selbst, den steilen Berghängen und dem vom Wind hochgewirbelten Schnee zufrieden und fühle mich geborgen im Schoß der Erde.
Der leichte Schneefall hielt den Abend über an, heute morgen ist der Himmel wieder klar. Die Leute aus Ringmo wollten einen zweiten Versuch der Paßüberquerung mit höheren Löhnen erpressen und haben, als sie diese nicht bekamen, den Dienst gekündigt. Ich stimme zwar mit GS überein, daß sie allesamt Räuber und Banditen sind, aber da es sich insgesamt um die lächerliche Summe von rund fünfundzwanzig Dollar handelt, meine ich doch, er spare am falschen Fleck. Allerdings kann er durchaus recht haben, wenn er sagt, er sei sicher, daß die Ringmos uns sowieso noch vor dem Paß im Stich lassen würden, nur daß wir dann um einen weiteren Tageslohn plus fünfundzwanzig Dollar ärmer und auch nicht besser dran wären.
In den frühen Morgenstunden ist GS mit zwei Ringmos aufgebrochen, die zwar nicht mehr tragen wollen, aber einen Führerlohn nicht verschmähen. Außerdem begleiten ihn Jang-bu, unser bester Übersetzer, und Phu-Tsering, der beste Bergsteiger unter den Sherpa. Nur leicht bepackt hoffen sie, Shey zu erreichen und dort vielleicht neue Träger anheuern zu können. Unterdessen soll Dawa eine Last Brennholz zu dem Depot auf dem Schneefeld hinaufschaffen für den Fall, daß GS und seine Leute nicht über den Kang-La hinüberkommen und auf dem Rückweg von Schnee oder Dunkelheit überrascht werden. Ich bleibe beim Lager, denn den langfingrigen Ringmos ist nicht zu trauen, einer hat bereits meinen festen Stock mitgehen lassen.
Inzwischen ist es Mittag, Dawa ist längst im oberen Ende der Schlucht verschwunden. Ein Tag Einsamkeit wird mir guttun, obwohl dieses Höhlenlager wohl das unwirtlichste von allen Camps seit Pokhara ist. Zwar vor Wind und Schnee geschützt, wird die tief in den Berghang geschnittene Höhle nur eine halbe Stunde lang von der Vormittagssonne erhellt, sonst herrschen Finsternis und eisige Kälte. Im herbstlichen Himalaja überrascht 166mich immer wieder der immense Unterschied zwischen Sonnen- und Schattenseite; der Bergbach unten vor meinem Zelt starrt vor Eisblöcken, während hier oben am Felshang, wo ich meine Notizen schreibe, sich Eidechsen auf den warmen Steinen sonnen.
Am Nachmittag streift die Sonne noch einmal kurz mein Zelt, dann fallen kalte Winde vom Kanjiroba herab. Da es zu kalt ist, um stillzusitzen, gehe ich ein Stück bergauf bis zu der Stelle, von der aus man den großen Gletscher und die Eisfälle in der Ferne sieht. Der Wind bläst mir glitzernde Schneekristalle ins Gesicht, die Wolken hoch oben am Himmel prangen in den unwahrscheinlichsten Farbschattierungen.
Immer wieder fasziniert mich das an diesen Bergflüssen zutage tretende Yin-Yang-Prinzip: das eine Ufer weiß bis zum Wasser hinunter, das andere dunkel; doch immer findet sich ein dunkler Felsblock auf dem hellen und ein Schneefleck auf dem dunklen Ufer, so daß beide den Samen ihres Gegenteiles in sich tragen. Das Gleichgewicht der kosmischen Energie zwischen den Polen Yang (positiv) und Yin (negativ), wie es im alten Buch der Wandlungen (I Ching) gelehrt wird, scheint die Elektronen-Theorie von der Energie als Materie vorwegzunehmen und ist außerdem ein wunderbares Sinnbild des Fließens, der gegenseitigen Durchdringung allen Seins, dessen gebräuchlichstes tantrisches Symbol das Yab-Yum, die sexuelle Vereinigung ist. Der Tantrismus sieht die pessimistische Furcht vor aller Lust und Freude, die den frühen Buddhismus kennzeichnete, als eine weitere Bindung an das irdische Dasein und empfiehlt eine Anteilnahme am Leben ohne Unterdrückung der natürlichen Lebenskräfte, aber auch ohne Anhaften und Verlangen. Das Tantra gibt sich mit der Gesamtheit der Existenz ab und bemüht sich, das gesamte Universum im Menschen erfahrbar zu machen. Alle Gedanken und Taten, einschließlich der sexuellen Kräfte, dienen der geistigen Entwicklung mit dem Ziel der Transzendenz; bei der sexuellen Vereinigung, bei Wein und Tanz kann man die Ich-Illusion der Getrenntheit von allem »anderen« verlieren, solange man dabei eine innerlich losgelöste Haltung zu wahren vermag. Alle Dinge und Taten sind gleich und miteinander verwoben, von den »niedrigsten« physischen Funktionen bis zu den »höchsten« geistigen 167Strebungen, so daß sogar das Verzehren des Fleisches gestorbener Menschen oder von Schmutz als Übung der vorbehaltlosen Annahme alles Seienden empfohlen wurde. Der Tantrismus kann daher als eine praktische Verwirklichung der frühesten religiösen Intuition der Menschheit verstanden werden, welche die grundlegende Einheit von Körper, Geist und der gesamten Natur erfuhr.[62] Im Laufe der Zeit machten sich jedoch Verfallserscheinungen in den verschiedenen tantrischen Sekten, insbesondere der »Alten Schule« (Nying-ma) des tibetischen Buddhismus bemerkbar, so daß im sechzehnten Jahrhundert die reformatorische Bewegung der neuen Gelug-pa-Schule einsetzte, deren Oberhaupt die Dalai Lamas waren. Zur selben Zeit ließ Mogul Akbar in Indien (wo der Buddhismus schon seit langem durch die Moslems verdrängt worden war) die hinduistischen Anhänger des Tantra an Elefanten binden und in Stücke zerreißen.
Bei meiner Rückkehr sitzen Dawa, Phu-Tsering und die beiden Ringmos plaudernd um das Feuer. Phu-Tsering berichtet, daß wir morgen das Lager abbrechen sollen. Die braunen Gesichter sehen mich seltsam an, als ich vor Freude wie ein kleiner Junge in die Hände klatsche. Aber die Nachricht von GS, der mit Jang-bu nach Shey weitergezogen ist, dämpft meinen Enthusiasmus.
12.00 Uhr, Paßhöhe
Peter,
die gestern eingeschlagene Richtung stimmt, schade daß ich nicht zur Stelle war. Geradeaus über den Kamm, wie du sagtest, dann bist du in zwei Stunden über dem Paß.
Schaffe alle Sachen nach Lager 2. Richte auf dem Paß Lager 3 ein. Zwei Aufstiege pro Tag sind leicht zu machen.
Schneide mit deinem scharfen Messer Weidenruten zurecht und markiere die Spuren alle paar hundert Meter für den Fall, daß sie zugeweht werden.
Zahle den Trägern 80 R aus.
GBS
Mißmutig schneide ich die Weidenruten zwischen den Felsen ab. Warum will GS auf dem windigen, verschneiten Paß in fast 5500 168Meter Höhe ein »Lager 3« aufschlagen lassen, wo wir doch ohnehin nach »Lager 2« zurückkehren müssen (offenbar meint er damit die auf dem Plateau deponierten Lasten). Für fünfundzwanzig Dollar zusätzlichen Trägerlohn, so fluche ich in mich hinein, hätten wir alle längst durch Kälte, Schnee und Wind hindurch und auf der anderen Seite des Kang-La sein können. Zugegeben, der Befehlston der Anweisungen wirkt sich auch nicht gerade günstig auf meine Stimmung aus, ebenfalls nicht die Andeutung, daß, wäre GS gestern im rechten Moment zur Stelle gewesen, die Träger noch am gleichen Nachmittag bis Shey Gompa weitergegangen wären.
Schließlich entspanne ich mich. Gewiß hat GS die Nachricht nicht so gemeint, wie ich sie verstehe. Was in seinem Verhalten oft übermäßig schroff wirkt, ist einfach seine eckige Art, so etwa, wenn er mir etwas, das ich mir ansehen soll, einfach durch die Klappe ins Zelt wirft. Einmal habe ich den Gegenstand sofort wieder hinausgefeuert, um anzudeuten, daß mir solche Umgangsformen nicht behagen. Aber seit ich diesen Mann besser kenne, fasse ich derartige Aktionen weniger als Unhöflichkeit denn als das Bestreben eines sehr auf seine Privatsphäre bedachten Menschen auf, den anderen möglichst wenig in seiner Privatsphäre zu stören. Konnte er denn wissen, ob ich nicht gerade Notizen machte oder meditierte und deshalb keinen Wortwechsel suchte? Auf einer so strapaziösen Reise, auf der man so eng zusammenleben muß wie auf der unseren, ist Rücksichtnahme (die er auch den Sherpa gegenüber zeigt) weitaus mehr wert als bloße »gute Manieren«, die oft nur eine niedrige Gesinnung übertünchen und sofort abblättern, wenn die Lage prekär wird.
Unten im Tiefland zeigte sich GS als recht steifer, förmlicher Zeitgenosse, der nicht imstande war, seine Gefühle zu äußern; hier oben öffnet er sich zu einem warmherzigen, wenn auch etwas rauhen Burschen. Bei zwei Gelegenheiten hat er es sogar fertiggebracht, mich wissen zu lassen, daß er mich sehr gern als Begleiter habe, und in Ringmo versetzte er mich in Erstaunen, als er von einem plötzlichen Bedürfnis sprach, eines der Kinder so richtig zu »knuddeln« (da das Kind rotznäsig und schmutzig war, ließ er es dann doch). Hinter seiner stacheligen Art verbirgt sich Güte; die Sherpa wissen das, sie mögen und achten ihn sehr.
169
Ich wasche meine Socken und fette die Stiefel ein. Phu-Tsering summt beim Tschapati-Backen vor sich hin. Dicht am Feuer hockend essen wir unser Abendessen. Phu-Tsering erzählt, vergangenen September habe er in Khumbu in Ostnepal beim Kartoffelausgraben zusammen mit vier oder fünf anderen Dörflern einen kleinen Yeti gesehen. Er habe etwa die Größe eines ausgewachsenen Schafes gehabt und sich auf allen vieren, wie auf der Suche nach Nahrung, fortbewegt. Als er die Erntenden bemerkte und floh, habe er sich auf die Hinterbeine erhoben und sei rasch davongerannt. Sein Oberkopf sei deutlich gewölbt, sein Fell von einer Farbe »zwischen rot und schwarz« gewesen. Ich muß an das sonderbare Geschöpf denken, das ich am oberen Suli Gad gesehen habe. Auch dieses war viel dunkler gefärbt als das Rötlichbraun, das man dem Yeti gewöhnlich zuschreibt; »zwischen rot und schwarz« stimmt genau und entspricht auch der Färbung anderer Primaten, die in der Jugend ein schwarzes Haarkleid tragen, das mit zunehmendem Alter ins Rötliche übergeht. Möglicherweise hat Phu-Tsering sich getäuscht oder sagt das nur, um dem Sahib nach dem Mund zu reden; er kann aber auch durchaus die Wahrheit sagen.
Das ehrfurchtsvolle Kindergesicht, das Phu-Tsering dabei macht, erinnert mich an eine Geschichte, die mir GS von ihm erzählte. Auf der Reise mit GS in Ostnepal erhielt unser Koch einen Brief, der ihn darüber informierte, daß seine Frau ihn wegen eines anderen Mannes verlassen habe. Schluchzend sei Phu-Tsering aufgestanden und hätte den Brief vor allen Sherpa des Dorfes, in dem sie kampierten, vorgelesen; und alle hätten dagestanden und mit ihm geweint. Wie GS kommentierte: »Ein Abendländer hätte sich davongestohlen und seine Wut im stillen ausgelassen; man muß die Sherpa für ihre Offenheit bewundern.« Ja, offen und wehrlos sind sie und deshalb frei, echte Bodhisattvas, die die kleinen und großen Ereignisse des Alltags hinnehmen wie das ewig wechselnde Wetter.
170
Mit einer vollen Traglast mache ich mich bei Tagesanbruch auf den Weg. Da ich die Strecke kenne, kann ich auf Details achten. Auf den kahlen Bodenflecken zwischen den verharschten Schneefeldern wachsen rote, gummiartige Sukkulenten. Viele der Steine enthalten Fossilien aus jener fernen Vergangenheit, als dieses Dach der Welt noch unter dem Meeresspiegel lag.
Wie immer in den Schneebergen – ist es die Höhe? – habe ich das Gefühl, offen, klar und wieder wie ein Kind zu sein. Empfindungen überwältigen mich, und unerwartet schießen mir Tränen in die Augen, hervorgerufen diesmal durch die Erinnerung an einen der letzten Tage Deborahs. Seit Tagen schon lag sie im Koma, dem letzten, wie die Ärzte glaubten, als frühmorgens das Krankenhaus anrief, sie wolle mich sprechen. Die Krankenschwester brauchte mehrere Minuten, um mich zu überzeugen, daß keine Verwechslung vorlag. Und dann hörte ich eine klare, schwache Stimme, die mich wie eine ferne Kinderstimme rief: »Peter, Peter? Komm ganz schnell her. Ich bin sehr, sehr krank.« Sie muß gefühlt haben, wie nah sie dem Tode war, und das ungläubige Erstaunen in ihrer Stimme brach mir schier das Herz. So wie ich gerade war, rannte ich durch die winterlichen Straßen zu ihr, wobei mir die verdutzten Gesichter der Passanten völlig gleichgültig waren.
Jetzt, am anderen Ende der Welt, mit gefrorenen Tränen in den Wimpern, bricht ein seltsamer Ton aus meiner Kehle, der wie das Winseln eines einsamen Gebirgsfuchses klingt, und im nächsten Augenblick lache ich schallend auf, als ich mir vorstelle, wie Deborah sich amüsiert hätte über den sentimentalen Kerl, der da im Schneegebirge seiner verlorenen Liebe nachjammert. Tränen und Gelächter wechseln sich ab, bis ich ganz weich, wie ausgewrungen bin und wunderbar befreit von dem Höhenkopfschmerz, der mich seit dem Aufstehen geplagt hat.
Am Schneefeld-Depot ist alles Schnee und Stille, Wind und Bläue. Ich ruhe mich ein wenig in der warmen Sonne aus, eingehüllt in die weiße Leere, in der, so scheint es mir, meine Gegenwart irgendwie wahrgenommen wird, auch wenn ich hier ganz alleine bin.
171
Als später Phu-Tsering erscheint, schlagen wir in einer Senke im Geröll zwischen den Schneewehen zwei Zelte auf. Hier ist auch mein vermißter Stock; der Bön-po, der ihn gestern vor meinem Zelt mitgehen ließ, hat ihn in einen Schneehaufen gesteckt. Schließlich taucht auch Dawa auf. Es ist kurz nach Mittag, wir stärken uns mit ein paar Tschapatis und wollen dann drei Lasten zum Paß hinaufschaffen und danach hierher zurückkehren. Trotz seiner schlechten Erfahrungen am Dhaulagiri trägt Dawa die Augenbinde nur, weil ich es ausdrücklich befohlen habe. Er hat kaum Erfahrung als Bergsteiger und, wie mir scheint, auch nicht als Erwachsener.
Der Wind hat sich gelegt, es ist heiß. Der knietiefe Schnee ist in der Sonne weich geworden, und unsere Stiefel brechen ständig durch die Fußspuren, die GS gestern morgen im harten Firnschnee hinterlassen hat. Ich schleppe einen Sack Linsen in einem brüchigen Korb. Nach hundert Metern Aufstieg ist mir klar, daß spätestens hier die Träger ihren Dienst quittiert hätten. Die dünnen Tragriemen schneiden tief in meine Schultern, das zerbrochene Korbgeflecht piekt Löcher in meine Parka, der schwere Korb zieht und rollt beim Gehen derart hin und her, daß ich dauernd aus dem Gleichgewicht komme. Bald keuche ich so sehr in der dünnen Luft, daß mir ganz schwindelig wird. Um nicht ständig von der noch zurückzulegenden Entfernung entmutigt zu werden, halte ich den Blick starr auf die schon leicht verwehten Spuren unserer Vorgänger gerichtet, die im Zickzack den steilen Hang hinaufpendeln. In gleißenden Wellen schlägt mir das Sonnenlicht vom Schnee entgegen.
Ohne andere Wegmarken, immer nur flimmerndes Weiß vor den Augen, in die der salzige Schweiß von der Stirn tropft, scheint der Weg zum Paß sich wie eine Treppe in eine blaue Unendlichkeit hinaufzuschrauben. Irgendwo in der Ferne das Donnern einer niedergehenden Lawine. Hier bin ich also in rund 5200 Meter Höhe und will nichts weiter als Luft zum Atmen; statt dessen taumele ich mit sechzig Pfund Linsen auf dem Rücken durch den weichen Schnee. Alle paar Meter bleibe ich nach Luft ringend stehen, mit dem Gefühl, meine Lungen müßten platzen. Die Anstrengung beschwört den Ärger und den Groll des Vortages erneut herauf. Ich verwünsche GS mit seiner Knauserei, die 172uns diese zusätzlichen Strapazen beschert hat. Heute schleppen wir einen Teil der Lasten über einen Höhenunterschied von 1200 Meter aus dem Höhlenlager zum Kang-Paß, morgen abermals zwei Lasten vom Schneefeldlager auf den Paß. Wo steckt dieser GS? Warum sind er und Jang-bu nicht zurückgekehrt, um uns bei der Plackerei zu helfen? Weshalb den Pfad mit Weidenruten für Tukten und Gyaltsen markieren, wenn sie ohne Führer erst gar nicht so weit kommen werden? Hätte GS bloß einmal einen Sack Linsen über mehr als tausend Meter hinaufgeschleppt, einen steilen Abhang hinauf und immer wieder knietief in die gleißende Firnkruste einbrechend, dann hätte er sicher nicht einen verdammten Zettel vonwegen zwei leichte Aufstiege pro Tag geschrieben.
Endlich komme ich wieder zu Sinnen, als hörte ich eine ferne Glocke der Vernunft: mein ganzes Wüten ist absurd. Ich kenne doch diesen Mann, und wenn er in Shey geblieben ist – die andere Möglichkeit, ein Unfall, ist unausdenkbar -, so wird er seine guten Gründe dafür haben. Mit meinem Zorn verschwende ich bloß Energie, die ich bitter nötig habe, eine Einsicht, die ihn schnell schwinden läßt.
Wo der Abhang sehr steil wird, bin ich fast wieder auf allen vieren, immer wieder berühren meine Fäuste den Schnee; die Last auf meinem Rücken verlagert sich, und die wundgescheuerten Schultern werden ein wenig entlastet. Drei Gedanken tragen mich fort: die Aussicht, über ganz Dolpo hinweg nordwärts nach Tibet hineinsehen zu können; die Aussicht auf den anschließenden leichten Abstieg über die glitzernden Schneefelder zu heißem Tee und Zwieback sowie die Wahrnehmung, die mich plötzlich überwältigt, daß die beiden Hände da vor mir, die den Schulterriemen des Tragkorbes umklammern, diese breiten, braunen Hände, die von den Narben eines bewegten Lebens gezeichnet sind, sich nicht von den alten Händen meines Vaters unterschieden. Im selben Augenblick bin ich ich selbst, das Kind, das ich einmal war, und der alte Mann, zu dem ich werde.
Nach dreistündiger gnadenloser Anstrengung erreichen wir die Paßhöhe, wo uns der eisige Nordwind sofort flach zu Boden zwingt. Der Kang-Paß ist, wie wir jetzt sehen, die einzige Kerbe in einem gewaltigen scharfen Bergkamm, von der aus ein Abstieg 173in die riesige Schneekuhle im Norden möglich ist. Aber auch hier sind die ersten hundert Meter so steil, daß sie ohne Zuhilfenahme der Hände nicht zu bewältigen sind. Das kleinste Ausrutschen würde zum Abgleiten und einem Sturz von mehreren hundert Metern führen.
Mit seiner Höhe von über 5400 Meter ist der Kang-La um ein gutes Stück höher als alle Berge der Vereinigten Staaten, Alaska ausgenommen, und doch steigen von hier aus in drei Richtungen noch mächtigere Berge empor. Nach Tibet ist Nepal das höchste Land der Erde. Dort am nördlichen Horizont hinter einer Gipfelkette liegt in tief purpurnem Schatten das Land Bhot. Im Zwielicht sind tiefe Schluchten an der Nordseite des Passes erkennbar, eine von ihnen muß nach Shey führen.
Angesichts dieser ungeheueren Leere kann man sich gut vorstellen, daß irgendwo hinter den Gipfeln – ähnlich wie jene grüne Bergwiese in der Saure-Schlucht unterhalb des Jang-Passes – als Mittelpunkt der Welt das geheimnisvolle Reich Shambala liegen könnte. Der Überlieferung zufolge verschwand Laotse, nachdem er den Wächter am Grenzpaß über das Tao belehrt hatte, mitsamt seinem Ochsen in einer solchen Leere; desgleichen auch Bodhidharma, der Erste Patriarch des Zen-Buddhismus in China, der den Dharma von Indien nach China brachte. Mein erster Eindruck von diesem Land besteht aus einem Durcheinander aufragender heller Bergspitzen ohne jegliche Spur von Leben, nirgends ein Feuer, ein Weg, eine Hütte oder gar ein Vogel.
Im Süden, unter den Gipfeln des Kanjiroba ist in der Sonne ein brauner Punkt erkennbar: unser Lager. Ich trete den Rückweg an, beginne den Hang hinunterzurennen, während der deprimierende Eindruck des ersten Ausblickes nach Norden von mir weicht. Die Gletscher glühen im Licht der untergehenden Sonne, als der Eishang des Kanjiroba in Sicht kommt. Das letzte Stück des Abstiegs lege ich in langen Sätzen und euphorischen Sprüngen zurück.
Ein schwarzer Adler fliegt quer von dem Gipfel herüber, dann fällt bittere Kälte von den rasch aufsteigenden, stechend funkelnden Sternen herab. Da wir mit dem Brennholz sparsam umgehen müssen, kriechen wir bald in unsere Schlafsäcke, um so die Nacht zu überstehen.
174
Morgens, als ich den ersten Blick in das stille Universum wage, sind meine Nasenlöcher voller Eis. Ich krieche in den Schlafsack zurück und decke das Gesicht zu. Wenn GS und Jang-bu heute nicht kommen, müssen wir eine harte Entscheidung treffen. Da unser Rückweg über vereiste Berghänge führt, dürfen wir hier nicht von einem Schneesturm überrascht werden; außerdem neigt sich unser Brennholz dem Ende zu. Das tiefe Schweigen über dem Plateau ist eine Warnung an uns, daß dies kein Ort für Menschen ist.
Beim Morgengrauen besuchen ein paar Raben das Lager. Dann steigt eine kühle Sonnenscheibe über den Rand der weißen Welt und bringt etwas Wind mit.
Heute müssen wir zweimal drei Lasten zum Kang-La hinaufschaffen. Das sind dann erst neun von den insgesamt vierzehn Lasten. Wir warten, bis die bitterste Kälte vorbei ist, und brechen erst auf, als die ersten Sonnenstrahlen den Hang streifen. Dann steigen wir rasch auf, ehe noch der Schnee weich wird, und erreichen den Paß in anderthalb Stunden. In den verschneiten Nordtälern, die noch tief im Bergschatten liegen, ist keine Spur von unseren Gefährten zu entdecken.
Die Sherpa kehren sofort um, sogar sie scheint die endlose Leere zu bedrücken. Ich bleibe allein zurück, abermals überwältigt von dieser Leerheit: kein Wind, keine Wolke, kein Pfad, kein Lebewesen; nichts als kristallene Grate zwischen riesigen klirrenden Felsgipfeln, die, befreit von der Eis- und Schneelast, ihr unerschütterliches Sein in die Bläue setzen. Im Morgenlicht zeichnen die Felsen scharfe Schattenbilder auf den Schnee, in der Spannung zwischen Licht und Dunkel ist die Kraft des Universums. Diese Stille, in die alles einmal zurückkehrt, das ist die Wirklichkeit, und Vernunft und Seele gelten hier nicht mehr als ein Schneeschauer. Die Bewußtheit der Vergänglichkeit und Bedeutungslosigkeit ist ebenso erregend wie erschreckend, vergleichbar der durch Meditation erlangten plötzlichen Erkenntnis der eigenen Transparenz. Die Schneegipfel, mehr noch als das Meer oder der Himmel, halten uns einen kühlen, klaren Spiegel vor, in dem sich unser wahres Selbst zeigt; völlige Stille, völlige 175Klarheit, ein Nichts, eine Leere ohne Leben und Klang, die doch alles Leben, alle Klänge in sich birgt. Aber solange mein »Ich« sich der Leere bewußt bleibt und außerhalb von ihr steht, liegt Schneestaub auf dem Spiegel.
Ein kleiner schwarzer Schatten taucht auf dem Schneefeld unter mir auf, es ist Dawa mit seinem Stirnband, aber in diesem Licht bewegt sich dort auch etwas, das viel mehr als Dawa ist. Die Sonne dröhnt, jeder Schneekristall birst vor Licht. Und wieder fühle ich mich im Innersten bewegt, ohne den Grund dafür zu erfassen, wieder erstarren auf meinem Gesicht warme Tränen zu Eis. All diese Felsen und Berge, all diese Materie, der Schnee, die Luft – die ganze Erde beginnt zu klingen. Alles ist in Bewegung, ist voller Kraft, voller Licht.
Auch den zweiten Aufstieg versuche ich rasch hinter mich zu bringen, solange die Eiskruste noch hart ist. Diesmal trage ich einen Sack Zwiebeln – wie fürchterlich die Zwiebeln in dieser schneeklaren Luft nach Zwiebeln stinken! Auch scheinen sie schwerer zu sein, als ihnen zusteht. Erst später bemerke ich, daß der schlaue Phu-Tsering zwei Büchsen mit Speiseöl unter den Zwiebeln versteckt hat, deshalb also hat er so gekichert.
Diesmal breche ich schon hin und wieder durch die Firnkruste, aber immer noch dauert der Anstieg eine Stunde weniger als gestern. Kurz nach Mittag stehe ich zum zweitenmal auf dem Paß. Phu-Tsering, der mich überholt hat und diesmal als erster in die riesige Schneeschüssel hinunterschaut, sagt mit erleichtertem Grinsen: »Da ist Tschortsch.« Dann seufzt er stirnrunzelnd: »Keine Träger.« Müde setzen Dawa und ich uns auf einen schneefreien Felsblock. Tief unter uns pflügt Tschortsch in seinem hellblauen Anorak durch den Schnee, ein Stück hinter ihm ruht Jang-bu auf einem Felsblock aus. In der vollen Sonne sehen die Berge im Norden jetzt weniger bedrohlich aus, aber an den Bewegungen von GS ist zu erkennen, daß der Weg nach Shey tief verschneit ist. Benommen starren wir hinunter, bis der Schweiß auf unseren Rücken erkaltet.
Heute machen mir die dünne Luft und die schwere Last weniger zu schaffen als der gleißende Schnee, der nach zwei Tagen meinen Kopf, meine Augen, mein Gehirn, alles an mir weichgekocht hat; in meiner Verwirrung glaube ich am Rand der Welt 176entlangzutaumeln. Auch Phu-Tsering und Dawa sind versengt und taumelig, übrigens geht Dawa trotz meiner Warnungen wieder leichtsinnig mit seiner Augenbinde um. Wir sind hungrig und müde nach den beiden Aufstiegen und kehren, ohne auf GS und Jang-bu zu warten, zum Lager auf dem Plateau zurück. Obwohl keiner darüber spricht, sind wir doch alle niedergeschlagen; die Arbeit, vierzehn Lasten hinauf auf den Kang-La und wieder hinunter nach Shey zu bringen, wird wohl uns fünfen überlassen bleiben.
Am frühen Nachmittag treffen unsere Freunde mit schlechten Nachrichten ein: in Shey gibt es weder Träger noch Lebensmittel. Der Regen, der uns in Dhorpatan festgehalten hat, ist hier als schwerer Schneefall niedergegangen, wie wir befürchtet hatten. Der ungewöhnlich frühe Wintereinbruch hat die Bewohner veranlaßt, das Kristall-Kloster zu schließen und von Shey ostwärts über die Berge nach Saldang zu gehen. Nur zwei Frauen sind zur Bewachung zurückgeblieben.
GS beginnt von sich aus zu erläutern, was er sein »knappes Schreiben« von vor zwei Tagen nennt: es sei so kalt und windig auf dem Kang-Paß gewesen, daß er nur das Wesentliche schreiben konnte. Er habe mich nur deshalb gebeten, die beiden Ringmos auszuzahlen, weil er mit seinen klammen Fingern nicht imstande war, die Banknoten abzuzählen. Ich gestehe, daß mich sein Brief keineswegs entzückt habe, aber ehe ich mich weiter darüber auslassen kann, kommt mir GS zuvor und sagt, er habe mich nicht kritisieren, sondern vielmehr bestätigen wollen, daß ich mit meinen Vermutungen über die Lage des Passes recht hatte und daß er uns durch seinen Abstecher in die falsche Richtung unnötig aufgehalten habe. Daß der Brief so ausfiel und ich ihn deshalb in den falschen Hals bekam, führt er auf die Belastungen der letzten Tage und auf die Reizbarkeit zurück, die in großen Höhen leicht auftritt und die schon manche Expedition in die Berge habe platzen lassen. Was er sagt, leuchtet mir ein, und ich komme mir recht kindisch vor. Rasch begraben wir die dumme Angelegenheit und schauen uns lachend an. Wir freuen uns, einander zu sehen – was um so wichtiger ist, da wir in diesem Lager das kleine Zelt teilen müssen. Und immerhin hat GS auch mit einer guten Nachricht aufzuwarten: in Shey gibt es viele und 177gar nicht scheue Blauschafe, deren Brunft offensichtlich gerade erst begonnen hat.
Wenn das gute Wetter anhält, wollen wir morgen früh die letzten fünf Lasten auf den Kang-La tragen und sie von dort den Nordhang hinabgleiten lassen bis zu einem kleinen schwarzen Bergsee am Grund des Talkessels. Für Tukten und Gyaltsen lassen wir im Lager am Plateau unter einem Steinhaufen Nahrungsmittel und eine Nachricht zurück: sie sollten nicht auf die Leute von Ringmo hören, sondern über den Paß nach Shey weitergehen, mit leichtem Gepäck müßten sie es in einem halben Tagesmarsch schaffen. Falls der Paß durch Schneefälle versperrt sei, sollten sie versuchen, auf einer anderen, viel längeren Route über Murwa und Saldang zu uns zu stoßen. Wie die Frauen in Shey sagten, gebe es zwar drei Pässe auf dieser Route, aber keiner davon sei so fürchterlich wie der Kang-La. Falls alle Versuche scheiterten, sollten sie in Dunahi auf uns warten.
Im Traum steige ich voller Freude auf einen Berg. Etwas bricht auf, und obwohl sich nichts ändert, wird alles leicht, licht und frei. Endlich erlöst, erhebe ich mich in den Himmel … Dieser Traum kommt oft wieder. Manchmal renne ich und steige dann auf wie ein Kinderdrachen. Eine Zeitlang schwebe ich völlig durchlässig hoch über der Erde, ehe ich mich entschließe, zu erwachen, aus Angst, herunterzufallen. Und doch sagen mir solche Träume, daß ich in den Dingen aufgehen könnte, wenn ich nur losließe und auch dabei bleiben würde. »Sei nicht schwer«, sagt Soen Roshi, »werde leicht, ganz leicht, voller Licht.«
Zweimal habe ich im Traum ein so helles, gleißendes Licht erblickt, daß ich davon erwachte. Aber das Licht blieb nicht bis in den Wachzustand erhalten. Was aber ist wirklicher, Wachen oder Traum? Das letzte japanische Schriftzeichen, das der ehrwürdige Lehrer von Soen Roshi niederschrieb, und das letzte Wort, das er sprach, war »Traum«.
178
Heute ist der letzte Oktobertag. Ich bin müde, der frühe Anstieg dauert eine halbe Stunde länger als gestern zur selben Zeit. Auf dem Grat ruhen wir kurz aus, ehe wir den Abstieg in den blau überschatteten Talkessel antreten. Ich suche mit dem Stock Halt, trete eine Stufe in die verharschte Schneewand, taste erneut mit dem Stock und setze den anderen Fuß vor … »Immer eins nach dem anderen«, warnt GS von oben, bis ich einen Punkt kurz über einer besonders steilen Stelle erreiche, an der einige spitze Felsbrocken aus dem Schnee ragen. Ich trete eine kleine Plattform in den Schnee, von der aus ich die Lasten in Empfang nehmen kann. Die Luft im Schatten ist entsetzlich kalt. GS läßt zuerst mein Gepäck herab, dann den Sack mit Linsen und zuletzt den in einen Plastiksack verpackten Mehlvorrat. Ich wuchte die Säcke ein Stück zur Seite, bis an eine Stelle, wo sie an den Felsen vorbeirutschen können, und lasse los. Der Linsensack kommt nach einer Rutschfahrt von etwa hundert Metern zum Stehen, dort wo die Wand in einen immer noch recht steilen Abhang übergeht, aber der glatte Plastiksack saust mit einer solchen Geschwindigkeit talwärts, daß die Sherpa, deren Köpfe gerade über der Gratkante auftauchen, vor Vergnügen aufjauchzen.
Ich schultere den Rucksack und arbeite mich vorsichtig zu den Linsen hinunter und steige dann langsam weiter ab, wobei ich den rauhen Sack neben mir herziehe. Auch hier ist der Abhang noch so steil, daß ich mit allen vieren am Hang noch fast aufrecht stehe. Bei jedem Schritt muß ich eine Stufe in die harte Kruste treten, um einen langen gefährlichen Sturz zu vermeiden.
Die Gestalten über mir sind sehr klein geworden. Jetzt arbeitet sich Phu-Tsering zu der Mulde vor. Und dann, wie aus dem Himmel, von dem aus die Sonne jetzt die ersten Strahlen über die Gratkante sendet, der Warnruf: Eine Last!
Schwarze Silhouetten gegen den Himmel, eine explodierende Sonne, das gleißende Eis und dieses schwere, hüpfende Ding – zuerst klein, doch mit jedem Überschlag bedrohlich größer, kommt es auf mich zu. Steif vor Kälte und durch den Rucksack in meiner Beweglichkeit behindert, kralle ich mich in die Kruste mit dem Gefühl, jede Bewegung könnte die falsche sein, denn das 179heransausende Geschoß ändert mit jedem Aufschlag seine Richtung. Verzweifelt trete ich das Eis fest, um einen Halt für einen Sprung in letzter Sekunde zu haben. Irgend jemand schreit auf, als das scharze Ding über mir aufschlägt, erneut hochspringt und den Himmel über mir verdeckt. Daß es genau dort wieder aufschlagen muß, wo ich gegen den Hang gepreßt liege, erscheint mir selbst in diesem letzten unwirklichen Sekundenbruchteil unwahrscheinlich. Ich springe nach links, und die große Kiste von GS – Bücher, Ersatzstiefel und Kamera-Ausrüstung – spaltet die Eiskruste, wo ich gerade noch war, und saust weiter abwärts. Ich habe den Halt verloren und beginne zu stürzen, kann im letzten Moment meinen Stock in die Eiskruste stoßen: er trägt mich. Platt am Hang, die Stirn in den Schnee gedrückt, taste ich mit den Fußspitzen nach Halt und finde ihn. Atemlos bleibe ich einen Moment liegen.
Weit oben schimpft GS Phu-Tsering laut wegen seiner Unachtsamkeit aus. Später, als ich den Koch aufziehe, »Ich dachte, du bist mein Freund!«, lacht er gequält und nervös: »I sorry!«
Wir hatten gehofft, bis Mittag den kleinen See erreichen zu können, aber die Sonne und die Wärme arbeiten jetzt gegen uns. Solange der Schnee hart gefroren ist, kann ein Mann auf dem steilen Stück drei Traglasten wie Schlitten hinter sich herziehen, aber weiter unten sinken sie in den weich gewordenen Schnee ein und müssen mühsam weitergezerrt werden. Oft sinken wir selbst bis zu den Hüften ein, und es wird später Nachmittag, bis die ersten Lasten am See eintreffen, der Rest liegt über den Berghang verstreut. GS mit seinen Schneeschuhen kommt etwas rascher voran, aber schließlich sind wir alle durchnäßt und erschöpft.
Wenn die Sonne hinter dem Paß verschwindet, wird hier bittere Kälte hereinbrechen. Die Sherpa machen sich so rasch wie möglich ohne Last auf den Weg nach Shey, das sie erst bei völliger Dunkelheit erreichen können. So gern ich endlich nach Shey gelangen möchte, schreckt mich doch der dreistündige Weg über Geröll und Eisfelder ab, naß und müde wie ich bin, möchte ich lieber hier am See kampieren. GS ist einverstanden. Und obwohl wir zu Mittag nichts gegessen haben, spüren wir vor Erschöpfung kaum Hunger. Wir schlagen das Zelt neben dem sonderbar 180schwarzen Wasserloch auf, eine Mulde mit schwarzem Lehm, in der zu dieser Jahreszeit Eis und Schnee unter der Mittagssonne schmelzen. Wir teilen die letzte Büchse Sardinen und kriechen in unsere Schlafsäcke, ehe noch der Bergschatten in tiefe Nacht übergeht.
Bei Sonnenuntergang hat sich der Wind gelegt, es herrscht tiefe Stille; das ist gut so, denn die Schneemassen um uns sind trocken und tief, sie könnten leicht ins Gleiten geraten. GS schläft tief und unbeirrbar, während die Nacht für mich lang wird. Der große schwarze Adler fällt mir ein, der im Zwielicht über den Himmel zog; vielleicht ist es derselbe, der gestern um diese Zeit das Plateau überflog: was kann den herrlichen Vogel in diese bittere weiße Wüste am Rande der Finsternis gelockt haben, hierher, wo es nichts zu jagen gibt?
181
Wie die vor das Auge gehaltene Hand den größten Berg verdeckt, so verdeckt das kleine irdische Leben die Sicht auf die mannigfaltigen Lichter und Wunder, an denen die Welt reich ist, und wer es vor seinen Augen fortzuziehen vermag, wie man eine Hand fortzieht, erblickt den mächtigen Glanz innerer Welten.
Die Tage und Monate sind die Reisenden der Ewigkeit. Desgleichen die vorbeiziehenden Jahre … Ich selbst wurde lange Zeit hindurch vom wolkentreibenden Wind verlockt – erfüllt von der heftigen Sehnsucht umherzuziehen … Ich wanderte durch Nebel und Wolken, atmete die dünne Luft großer Höhen und schritt über glatte Eis- und Schneeflächen, bis ich zuletzt durch ein Wolkentor, wie es schien, geradewegs auf der Bahn von Sonne und Mond den Gipfel erreichte, völlig atemlos und fast zu Tode gefroren. Alsbald ging die Sonne unter, und der Mond stieg schimmernd am Firmament auf.
183
Das Lager am schwarzen See, obwohl ein gutes Stück unterhalb des Kang-Passes, liegt immer noch um 5200 Meter hoch. Eine Stunde nachdem die Sonne hinter den Gipfeln versunken ist, sind meine feuchten Stiefel zu Eisblöcken gefroren. Das Thermometer von GS zeigt minus zwanzig Grad, und obwohl ich alle vorhandenen Kleidungsstücke anziehe, schnattere ich die ganze Nacht vor Kälte. Endlich bricht der Morgen an, aber es ist nicht einfach in diesen Höhen, einen Topf Eis in heißes Wasser zu verwandeln. Es wird neun Uhr, bis die Stiefel so weit aufgetaut sind, daß wir uns auf den Weg machen können.
Im Schneekessel entspringt ein eisbedeckter Fluß, der in einem tiefen Canyon nach Shey hinunterfließt. In der Schlucht kommen uns Jang-bu und Phu-Tsering entgegen, die Töpfe und Vorräte holen wollen; Dawa ist wegen akuter Schneeblindheit in Shey zurückgeblieben.
Die Spuren der Sherpa führen im eisigen Schatten an den gläsernen Uferfelsen entlang. Irgendwo gleite ich aus und verliere die Feder des Wiedehopfes, die bis dahin meine Mütze geschmückt hat. Der Fluß fällt sehr steil ab, denn Shey liegt fast tausend Meter tiefer als der Kang-La. Stellenweise ist die Strecke so gefährlich, daß die Sherpa keinen Weg in den tiefen Schnee getreten haben, offenbar hat sich jeder auf seine Weise durch das Gewirr der Felsblöcke hindurchgeschlängelt. Von einer hochgelegenen Biegung der Schlucht aus kommen rötlichbraune Bauwerke in Sicht. Wie eine kleine Festung steht das Kloster auf einer Felsnase, die sich an der Stelle vorschiebt, wo ein Fluß aus Osten in unser Flußtal mündet; anderthalb Kilometer weiter unten verschwindet das Gewässer wieder in einer tiefen, dunklen Klamm. Vom Südhang, auf dem das Kloster liegt, ist nur der untere Bereich schneefrei, sonst ist die ganze baumlose Einöde ringsum mit dickem Schnee bedeckt, aus dem hie und da nackte Felsen wie kalligraphische Muster vorstechen. Die Gegend sieht so wild und öde aus, daß sie die wenigen zusammengekauerten Behausungen zu erdrücken scheint.
Im Westen ragt eine weiße Pyramide in den Himmel – der Kristall-Berg. Im Sommer ist das Felsenmonument das Wallfahrtsziel 184von Pilgern, die aus ganz Dolpo und von noch weiter her kommen, um die vorgeschriebene Umwandlung des Kristall-Berges zu vollziehen und an einem religiösen Fest in Shey teilzunehmen.[63] Es ist vor allem die ungewöhnlich kraftvolle Form, die diesem Gipfel seine Besonderheit verleiht; auch heute, da keine Wolken an dem weißen Berg vorbeiziehen, scheint er die Himmelsbläue zu durchstoßen. »Die Macht eines solchen Berges ist so groß und zugleich so subtil, daß Menschen von nah und fern, ohne äußeren Zwang oder Notwendigkeit, sich von ihm angezogen fühlen, wie von einem unsichtbaren Magneten, und unsagbare Mühen und Entbehrungen auf sich nehmen in dem unerklärlichen Drang, sich dem Zentrum dieser heilversprechenden Macht zu nähern und ihr Verehrung darzubringen … Diese ehrfürchtige oder religiöse Haltung ist nicht durch wissenschaftliche Fakten, wie die in Zahlen ausdrückbare Höhe, bestimmt, die den modernen Menschen in erster Linie beeindruckt. Ebensowenig ist der religiös empfindende Mensch von der Idee beherrscht, den Berg ›erobern‹ zu wollen …«[64]
Eine Kiesbank im Fluß unterhalb des Klosters ist über Eisschollen und Felsblöcke in einem seichten Seitenarm erreichbar. An ihrem unteren Ende stehen Gebetsmauern und ein Tierpferch mit Steinwänden, weiter flußauf leiten kleine Kanäle das Flußwasser zu den Wasserrädern von Gebetsmühlen, die einzeln in Steinhäuschen aufgestellt sind. Jetzt sind die Kanäle zugefroren, und die Räder stehen still. Auf den kleinen Stupas liegen als Opfergaben weiße Quarzkristalle, die die Pilger vermutlich im Sommer am Kristall-Berg finden, wenn die fünf Wasserräder die alten Gebetstrommeln antreiben und das om mani padme hum in den kalten Canyon senden.
Am anderen Ende einer Bohlenbrücke führt ein Pfad bergauf zu zwei großen, rotweißen Eingangs-Stupas auf dem Bergvorsprung; langsam steige ich hinauf. Gebetsfahnen flattern im Wind, ein hölzerner Halbmond, an den Klöppel eines Windglöckchens gebunden, läßt dieses klingen. Das zarte Sirren des Windglöckchens über dem Klackern der Steine im Fluß, das von einer leichten Brise herangetragen wird, ist das erste Geräusch, das mich in Shey Gompa empfängt.
Das halbe Dutzend Steinhäuser ist rot gestrichen als Zeichen, 185daß Shey ein Kloster und kein Dorf ist. Eine weitere Gruppe von Häusern, fünf dürften es sein, klebt weiter oben am Berg. Darüber ist mit bloßem Auge eine Herde Blauschafe zu erkennen. Im Norden, auf der anderen Seite des Flusses kurz vor dessen Eintritt in die Schlucht, steht auf einer Klippe eine rote Einsiedlerklause. Sonst gibt es hier nur Felsen, den trockenen, baumlosen Südhang, wo der Schnee geschmolzen ist, und darüber nichts als Schnee und Himmel.
Langsam gehe ich weiter, benommen und erschöpft. Zu der Kette eisiger Bergzacken hinter mir aufschauend, begreife ich erst jetzt, daß wir über das Kanjiroba-Gebirge in die Bergwüste der Tibetischen Hochebene vorgedrungen sind; wir haben den Himalaja von Süd nach Nord überquert. Aber erst auf diesem kurzen steilen Pfad vom winterlichen Fluß zum Felsplateau über mir spüre ich so richtig, wieviel Kraft mir der fünfunddreißigtägige harte Marsch abgefordert hat. Aber hier bin ich nun, am ersten Novembertag, und stehe vor dem Kristall-Kloster mit seinen seltsamen Steinen, Fahnen und Glocken vor der eisigen Kulisse.
Das Hauptgebäude des Klosters mit seinen Anbauten bildet einen nach Süden offenen Hof. Zwei Frauen und zwei Kinder sitzen in der Sonne, ohne den geringsten Willkommensgruß zu geben. Vor ein paar Tagen, als GS und Jang-bu das erstemal auftauchten, hatten sie sich aus Furcht vor Khampa-Banden in den Häusern eingeschlossen, und noch immer scheinen sie unserer für sie unverständlichen Expedition nicht recht zu trauen. Die jüngere Frau webt ein grobes Stück Tuch auf einem altertümlichen Webrahmen. Als ich mit »Namaste« grüße, wiederholt sie die Worte, als müsse sie sie erst einmal ausprobieren. Drei schäbige Dzos und eine alte Geiß ausgenommen, sind es die einzigen in Shey verbliebenen Bewohner, das übrigens von den Leuten hier Somdo oder »Zusammenfluß« genannt wird nach den beiden Bergflüssen. Ich erfahre, daß wir bisher dem Kangju oder »Schneewasser« gefolgt sind (den ich im stillen den »Schwarzen Fluß« genannt habe nach seiner schwarzen Quelle, dem schwarzen Adler und den dunklen Felsen in der Schlucht); der aus Osten kommende Fluß heißt Yeju, »Niedriges Wasser« (ich nenne ihn »Weißen Fluß« nach seiner Herkunft aus den Gletschern).
186
Jang-bu hat sich die einzige unversperrte Behausung als Koch- und Vorratsraum eingerichtet. Wie die anderen hat die Hütte ein Flachdach aus Zweigen und Lehm, das mit Reisig bedeckt ist. Eine niedrige Tür führt in den einzigen Raum, und ein winziges Fenster in der Westwand läßt die Nachmittagssonne ein. Wie auf einem mittelalterlichen Gemälde erhellt ein einzelner Lichtstrahl das rauchgeschwärzte Gebälk, welches das Dach trägt; dieses ist so niedrig, daß GS und ich nicht aufrecht stehen können. Eine Feuerstelle aus Lehm auf dem nackten Boden ist die einzige Einrichtung. An der Seite ist eine Öffnung, durch die man das rauchige Dung- oder Reisigfeuer anfachen kann. Das Zelt von Jang-bu und Phu-Tsering steht draußen vor der Tür, während Dawa drinnen neben den Vorräten schläft. GS schlägt sein blaues Zelt oberhalb der Hütte auf, während ich meines etwas abseits aufbaue, mit dem Eingang in Richtung auf den Sonnenaufgang über dem Weißen Fluß.
Unsere Kochhütte gehört dem Bruder der jüngeren Frau. Sie heißt Tasi Chanjun, aber die Sherpa nennen sie Namu, »Wirtin«. (Wie bei den Eingeborenen Amerikas gilt auch bei den Tibetern die Anrede mit dem formellen Namen oft als Unhöflichkeit.) Ihr kleiner, etwa vier Jahre alter Sohn heißt Karma Chambel, das zweijährige Töchterchen Nyima Poti. »Nyima« bedeutet »Sonne«, die »sonnige Poti«. Der Name der alten Frau lautet Sonam; ihr Mann, Chang Rapke, und ihre Tochter Karima Poti sind für den Winter nach Saldang gezogen, so daß Sonam allein in der abgelegenen Berghütte wohnt. Wie Namu berichtet, wohnten vor dem Wintereinbruch bis zu vierzig Personen in Shey, darunter um die zwanzig Mönche und zwei Lamas. Sie alle sind über die Berge nach Saldang gegangen, aber – ist das eine Warnung für die Ausländer, die ohne Frauen gekommen sind? – der Ehemann Namus wird in wenigen Tagen zurückkommen. Ihr Mann hat auch den Schlüssel zum Kloster, sagt Namu, er wird ihn sicher bei sich haben, wenn er in vier oder fünf oder auch zwanzig Tagen zurückkehrt. Namu dürfte um die dreißig Jahre alt sein, sie ist in ihrer robusten Art recht hübsch und sehr selbstbewußt. Bhot ist ihr bekannt, nicht aber Nepal, sogar Ringmo liegt für sie im fremden Land weit hinter dem Kang-La.
Wir sind enttäuscht, daß wir den Lama nicht antreffen, trotzdem 187sind wir sehr froh, überhaupt angekommen zu sein. Jetzt brauchen wir morgens keine nassen Stiefel anzuziehen, das Lager abzubrechen und die Leute anzutreiben; abends kommen wir sozusagen »nach Hause«. Keine Träger verderben unsere gute Laune, und vor Schlechtwetter sind wir geschützt. Der hohe Paß, der Shey von der übrigen Welt im Süden trennt, liegt geisterblaß zwischen den Schneegipfeln, die kalt im Sternenlicht glänzen. »Mein Gott, bin ich froh, daß wir heute nacht nicht dort oben sind«, ruft GS aus, als wir, den Bauch voll warmer Linsensuppe, zu unseren Zelten aufbrechen. Wir haben Glück gehabt, daß wir den Kang-Paß bei sonnigem, windstillem Wetter überqueren konnten. Aber wie lange wird das gute Wetter anhalten, und werden Tukten und Gyaltsen den Weg zu uns finden? Es ist bereits November, alles hängt von den Schneeverhältnissen ab.
Auf 4500 Meter Höhe liegt Shey ebenso hoch wie der Jang-Paß. Es liegt im sogenannten »Inneren Dolpo«[65], das von Ost-Dolpo durch eine hohe Gebirgskette abgetrennt ist und wohl zu den höchsten besiedelten Gebieten der Erde gehört. Die Einwohner sind reinrassige Tibeter, deren Lebensweise sich wohl kaum von der jener Chang-Tataren unterscheidet, die ursprünglich in Tibet lebten. Auch in ihrer Sprache widerspiegeln sich noch die Gewohnheiten des Nomadenvolkes, das sich vor zweitausend Jahren hier niedergelassen hat. Dolpo gehörte ehemals zu West-Tibet, und der Buddhismus gelangte bereits früh hierher. Hinter dem Fluß Karnali erhebt sich im Nordwesten der Kailas aus dem Tibetischen Plateau, der heilige »Berg Sumeru« oder »Meru« der Hindus und Buddhisten, Wohnstätte Shivas und Mittelpunkt der Welt. Am Kailas entspringen die vier großen Flüsse Karnali, Indus, Sutlej und Brahmaputra, die in Gestalt eines großen Mandala den indischen Meeren zuströmen.
Shey Gompa (tib. Shel dgon-pa) ist ein Kloster der Kargyütpa-Sekte, die sich im elften Jahrhundert als Seitenlinie des Kalacakra-Tantra von der Alten oder Nyingma-Sekte trennte (Kalacakra = »Rad der Zeit«). Die Kalacakra-Lehre war im selben 188Jahrhundert nach Tibet gekommen. Der Überlieferung nach gründet sie sich auf ein Tantra, einen Lehrtext, der unter dem Titel Reise nach Shambala bekannt ist. Er lehrt die Gläubigen, die Zeit (den Tod) zu transzendieren, und gilt als das Buch der Weisheit, das auf den Darstellungen des Bodhisattva Manjusri[66] zu sehen ist. In der Kalacakra-Lehre werden die ohnehin schon zahlreichen Buddha-Aspekte nochmals aufgeteilt in friedliche und rasende Manifestationen ein und derselben Gottheit; so tritt Avalokiteshvara, der Große Erbarmer, gleichzeitig auch als Mahakala (Große Zeit), der Herr des Todes, auf. Er ist eine Verkörperung der zerstörerischen Kräfte des Universums und wird oft mit einer Kette aus Menschenschädeln, einem Umhang aus Menschenhaut und einer Handvoll Pfeilen abgebildet, die er bedrohlich schwingt und dabei auf der kopulierenden Menschheit herumtrampelt. Mahakala bringt Befreiung für die Menschen, die für ihre Vergangenheit sterben können, um wiedergeboren zu werden, und es ist erschreckend nur für jene, die sich ans weltliche Dasein des Samsara klammern, an jenes endlose Dürsten und Gestilltwerden und erneute Dürsten, das die mit Blut gefüllte Schädelschale der Priester symbolisiert. Das Kalacakra-Pantheon der friedlichen und rasenden Gottheiten wurde auch von den »reformierten« Sekten übernommen: den Kargyütpas, den Sakyapas und auch von den Gelugpas, deren Oberhäupter die Dalai Lamas sind.
Die Kargyütpa-Sekte ist eine Gründung des großen Lamas Marpa, genannt der »Übersetzer«. Dreimal reiste er nach Indien, um die Lehren des Meisters Naropa zu studieren. Nach Tibet zurückgekehrt, übermittelte Marpa die Lehre des Dharma an seinen Schüler Milarepa. In der Nachfolge spalteten sich einige Schüler Milarepas von den Kargyütpas ab und gründeten die neue Schule der Karmapas, die im dreizehnten Jahrhundert als erste tibetische Sekte[67] Einfluß auf den damaligen Herrscher Chinas, Kublai Khan, gewann. (Nach der Chronik des Marco Polo wurde der Glaube des Khan an die tibetischen Lehren durch einen Lama verstärkt, der die Bekehrungsversuche von Vertretern des Christentums, des Islam und des Taoismus übertrumpfte, indem er eine Tasse ohne äußere Einwirkung zu den Lippen des Herrschers schweben ließ.)
189
Die im sechzehnten Jahrhundert erfolgten Reformen der Gelugpas haben das Wesen der Lehren der Karma-Kargyütpas kaum zu ändern vermocht, wenigstens nicht an so abgelegenen Orten wie dem Kristall-Berg. In seiner asketischen Disziplin und der einfachen Lehre, die alle metaphysischen Spekulationen verwirft zugunsten einer langjährigen Meditationspraxis in Einsamkeit, kommt die Praxis der Karmapa-Schule der des Zen-Buddhismus recht nahe, der ebenfalls die intuitive Erfahrung über alle priesterlichen Rituale und Doktrinen stellt. Beide Richtungen werden als »Kurzer Pfad zur Erlösung« bezeichnet, und obwohl der direkte Weg steil und schwierig ist, stellt er doch den Kern des Buddhismus dar, frei von allen zeremoniellen Auswüchsen. Es erscheint mir als wunderbares Karma, daß gerade das Kristall-Kloster zu der zen-verwandten Sekte gehört und daß der Lama von Shey, ein ehrwürdiger Tulku oder inkarnierter Lama, im ganzen Land Dolpo als die gegenwärtige Verkörperung des Lama Marpa verehrt wird. Unterwegs sah ich mich in meiner Vorstellung schon im Mönchsgewand zu seinen Füßen sitzen und von ihm in die alten Mysterien eingeführt werden, hatte ich doch gehofft, daß er mein Lehrer werden würde. Daß das Gompa verschlossen und der Lama abgereist ist, kann auch als karmische Zurechtweisung für mich verstanden werden, als eine stille Mahnung an mein Ich, sich nicht immer wieder bemerkbar zu machen wie dort jene meckernde Ziege im Nordwind.
Da letzte Nacht die Temperatur auf minus dreizehn Grad sank und ein steifer Ostwind an meinem Zelt rüttelte, trage ich meine Sachen in den Hof eines leerstehenden Hauses und schlage dort mein Zelt auf. Auf einer Mauer liegen mehrere ausgezeichnete Steinskulpturen, darunter ein Bildnis der Tara (in Tibet Dölma genannt), die aus der mitleidigen Träne Avalokiteshvaras (Tschenrezigs) geboren wurde und die das Bodhisattva-Prinzip verkörpert. Als weiblicher Aspekt Tschenrezigs ist Dölma die große Schutzgöttin Tibets, und ich freue mich über ihr Bild in meiner Nähe.
Der Tempel unterscheidet sich von den Gebäuden zu seinen Seiten durch den feierlich erhöhten Eingang unter einem überdachten Balkon und eine Fülle von Ornamenten auf dem Dach, 190darunter Gebetsfahnen, Tritonsschnecken, die großen Hörner eines Argalis und die noch größeren des Sikkim-Hirsches, einem Bewohner von Nord-Bhutan und Südost-Tibet. (Da keines dieser Tiere hier beheimatet sein soll, interessiert GS sich brennend für die Herkunft der Hörner und Geweihe, vor allem, da der Sikkim-Hirsch ausgestorben sein soll.[68])
Obwohl das Kloster fest verschlossen ist, geben die beiden großen Stupas oberhalb der Brücke eine Vorstellung davon, wie die Ikonographie darin aussehen mag. Die Stupas sind etwa zehn Meter hoch, sie bestehen aus dem typischen roten Kubus als Unterbau und einer mit roten Ranken verzierten weißen Kuppel, über die sich ein spitz zulaufender Aufsatz mit einer Mondsichel und einer Sonnenscheibe erhebt. An den vier Seiten des Unterbaus befinden sich grobe Lehmfresken von symbolischen Tieren: Elefanten im Osten, Pferde im Süden, Pfauen im Westen und auf der Nordseite ein Bildnis des Garuda, eines mythischen Falken, der hier als geflügelter Mann mit Sonne und Mond auf den Schwingen dargestellt ist. Der Garuda ist, ebenso wie die Swastikas im Stupa-Inneren, ein vorbuddhistisches Symbol, desgleichen das Yin-Yang-Zeichen auf der Tür, das noch älter sein soll als der frühe chinesische Taoismus des dritten Jahrtausends vor Christus.
In der kleinen Kammer der einen Stupa stehen zwei Reihen alter Gebetsmühlen, fünf an jeder Seite, so daß der Besucher gleichzeitig zehn Rotationen des om mani padme hum in Gang halten kann. Jedes Gebetsrad steht für das Rad des Dharma, das zum erstenmal durch den Buddha in Bewegung gesetzt wurde, aber auch für das rotierende Universum. An der Decke und an den Wänden finden sich Mandalas und Buddha-Bilder in bunten Farben, auch Samantabhadra und Padmasambhava fehlen nicht; letzterer ist als grimmiger »Tigergott« des Kalacakra dargestellt, der den Dharma beschützt. Eine gütige Gestalt mit vier Händen ist Avalokiteshvara oder Tschenrezigs; er trägt eine Perlenkette, eine Lotusblüte und die blaue Mani-Kugel, das Zeichen des Erbarmens. Über allen aber thront Dorje-Chang (Vajradhara), der Donnerkeilträger, der als Urbuddha Tibets verehrt wird. Der Dorje oder »Donnerkeil«, der unzerstörbare Diamant, ist das Symbol der Essenz der kosmischen Energie. Dorje-Chang übertrug 191den Dharma dem großen indischen Weisen Tilopa, mit dem eine berühmte Traditionslinie beginnt, die sich über Naropa, Lama Marpa, Milarepa und viele andere bis in unsere Zeit fortgesetzt hat. Auch auf dem Kuppeldom ist Dorje-Chang mit den Plejaden und einer schwarzen Mondsichel über der Schulter dargestellt; seine himmelblaue Farbe weist auf sein ewiges Wesen, die Glocke, die er in der Hand hält, versinnbildlicht den vollkommenen Klang der wortlosen Weisheit. Neben der Kuppel hängt ein Windglöckchen, dessen dünner klarer Ton das Schweigen dieser Andachtsstätte noch zu vertiefen scheint.
Die zweite Stupa ähnelt der ersten in Größe und Aussehen. Zwischen den beiden Stupas und den Klostergebäuden liegen Tausende und aber Tausende von beschrifteten Steinplatten zu einer anderthalb Meter hohen Plattform aufgetürmt, die größte Ansammlung von Gebetssteinen, die ich je gesehen habe. Am häufigsten ist das om mani padme hum in die Steine geritzt, aber auch Bilder des Buddhas und des Lebensrades sowie Zitate aus religiösen Texten sind massenhaft vorhanden. Die Steine variieren in der Größe von zehn bis zu mehreren hundert Pfund, manche sind offensichtlich erst vor kurzem hingelegt worden, während auf anderen die Zeichen nach jahrzehnte- und jahrhundertelanger Verwitterung kaum noch sichtbar sind. Eine weitere große Wand aus Gebetssteinen umgibt die Klostergebäude und eine Gruppe kleinerer Stupas an der Nordseite, aber auch auf den Flußinseln und entlang der Wege ziehen sich überall Mauern aus Gebetssteinen, deren unterste viele Jahrhunderte alt sein müssen. Die gewaltige Anhäufung so alter Steine legt die Vermutung nahe, daß das Kristall-Kloster ein sehr altes buddhistisches Heiligtum ist und vielleicht schon eine Kultstätte des Bön-Glaubens war. Das Kloster Samling zum Beispiel, nicht weit nördlich von hier, ist eine solche alte Bön-Niederlassung, in der die ältesten Bön-Texte aufbewahrt werden. Ich stelle mir gern vor, daß hier das archaische Königreich Sh'ang Sh'ung gelegen haben könnte, das die Bönpos als die Heimat ihres Glaubens betrachten. Man kann darüber streiten, wie weit dieses Sh'ang Sh'ung »mythisch« ist, denn auch Dolpo findet sich nirgends in alten geographischen Schriften und kommt sogar Leuten wie mir, die sich einbilden, dort gewesen zu sein, reichlich mythisch vor.
192
An diesem Morgen bade ich in meinem durchsonnten Zelt und sehe meine Sachen durch. Dawa jammert immer noch über Schneeblindheit, aber Jang-bu und Phu-Tsering sammeln jenseits des »Schwarzen Flusses« Wacholderzweige für das Feuer, und GS ist den Berghang über Somdo hinaufgestiegen, um seine Schafe zu beobachten. Halb erfroren kommt er noch vor Mittag zurück. Nach einer raschen Tschapati-Mahlzeit spüren wir einer anderen Schaf-Population nach und folgen dazu dem »Weißen Fluß« ein Stück aufwärts nach Osten. Schneewolken ziehen auf, und der bisher funkelnde Fluß sieht plötzlich schwarz aus. Ein einsames Dzo schnüffelt auf dem steinigen Boden herum. GS hat den Kot eines größeren Raubtieres gefunden und untersucht ihn genau, während er sich darüber wundert, daß die am Schwarzen Bergsee so häufigen Fuchsspuren hier gänzlich fehlen.
»Zu groß für einen Fuchs, meine ich …«
Unterdessen suche ich die Berghänge nach Blauschafen ab; bisher ist uns auf den flachen Hängen östlich von Somdo noch keines zu Gesicht gekommen. Plötzlich sagt GS: »Halt! Rühr dich nicht! Zwei Schneeleoparden!« Ich sehe einen grauen Schatten hinter einer Schneewehe am Pfad verschwinden. »Der Schwanz ist zu kurz«, murmelt GS aufgeregt. »Es müssen doch Füchse gewesen sein …«
»Nein«, widerspreche ich, »dafür waren sie zu groß!«
»Wölfe«, ruft GS, »es sind Wölfe!«
Und da sind sie auch schon.
Ohne Hast ziehen sie nicht weit vor uns über einen offenen Hang und bringen Leben in die erstarrte Welt. Die zwei letzten Wölfe fangen an zu hüpfen und miteinander zu spielen, während sie immer wieder zu uns herüberäugen; die Zutraulichkeit der Tiere ist erstaunlich. Dann schließen sie sich den drei anderen an, die in eine Kluft zwischen den Felsen hinaufsteigen. Das Rudel hält immer wieder inne, um nach uns herüberzuschauen, durch das Fernglas können wir jedes schimmernde Haar in ihrem Pelz erkennen: es sind zwei silberfarbene und zwei hellbraune Wölfe; der fünfte, ein eisgraues Männchen, scheint das Leittier zu sein. Alle haben schwarze Schwanzspitzen und hübsche schwarze Zeichnungen auf dem Rücken. »Deshalb gibt es keine Füchse oder Leoparden in der Nähe«, sagt GS, »und deshalb bleiben die 193Schafe zwischen den Felsen der Schlucht, statt sich auf das offene Gelände zu wagen.« Ich frage ihn, ob die Wölfe denn auch Füchse und Leoparden jagen, was er bestätigt. Die Anwesenheit von Wölfen überrascht uns, diese mythischen Geschöpfe hätten wir nur in Tibet vermutet. Es handelt sich um eine asiatische Rasse von Canis lupus, dem uns beiden aus Alaska bekannten Waldwolf. Wir finden alten Wolfskot, der hellgraue und gelbliche Haarbüschel enthält: die Überreste von Blauschafen und Murmeltieren.
Auf dem Weg begegnen wir einer alten Frau, die allein über den Shey-Paß von Saldang gekommen ist; sie ist von unserem Anblick mindestens ebenso überrascht wie wir von dem ihren. Auch sie hat die fünf Jangu gesehen und noch zwei weitere; allerdings scheint sie vor den großen Fremdlingen mehr Angst zu haben als vor den Wölfen.
Wir machen uns Gedanken über das einsame Dzo, das kaum einen Kilometer entfernt von der Stelle, wo wir die Wölfe nach Osten abgelenkt haben, zwischen den Felsen grast. Später erzählt uns Namu, daß die Wölfe zwei bis drei Dzo im Jahr töten und sich fünf bis sechs Schafe aus dem Pferch herausholen. Voll Sorge um ihr Dzo macht sie sich auf den Weg und ist bei Sonnenuntergang wieder mit dem Tier zurück.
Es gibt so vieles, das mich hier an diesem stillen, abgelegenen Ort entzückt, daß ich mich besonders leise bewege, um den Zauber nicht zu brechen. Da der Lama von Shey jegliches Töten verboten hat, kommen die Blauschafe und Wölfe ganz nahe an das Kloster heran. An den Berghängen und im Steinbett der Flüsse finden sich Fossilien aus jenen fernen Zeiten, als diese Gesteinsmassen noch Meeresboden waren. Und überall gibt es Gebetssteine, Gebetsfahnen, Gebetsräder und Gebetsmühlen im Fluß, die alle Elemente der Natur zum Lobpreisen des Einen auffordern. In meinem Zelt höre ich eine zarte Windglocke und das Rauschen des Flusses im Osten. Bei Tagesanbruch besuchen mich zwei Raben, ihre Krallen kratzen auf den Gebetswänden.
194
Die Sonnenstrahlen werden von den spiegelglatten Bergen zurückgeworfen, die Luft ist eisig. Die alte Sonam, die allein in dem Dorf oberhalb des Klosters lebt, ist schon vor Sonnenaufgang zum Dungsammeln auf den Berg gestiegen; der seltsame dunkle Klumpen auf dem Hang richtet sich plötzlich auf, und vor dem in der Morgensonne aufflammenden Himmel erkenne ich ihre Gestalt.
Elf Schafe sind jetzt auf dem Berg über Somdo sichtbar, sechs Widder und eine Gruppe von Mutterschafen und Jungtieren. Und obwohl die beiden Gruppen sich näherkommen und an den gegenseitigen Urinspuren schnüffeln, ist noch kein eigentliches Zeichen der Brunft erkennbar. Aus unserem Beobachtungsstand in Sonams Hütte können wir auf den Westhängen hinter dem Schwarzen Fluß noch drei weitere Gruppen mit je sechs, vierzehn und sechsundzwanzig Tieren sehen.
GS, der die unruhigen Tiere kaum mit dem Fernglas zu verfolgen vermag, ruft mir zu, ich solle auf die sechs Tiere achten, die auf dem Hang gegenüber etwa in gleicher Höhe mit uns sind. »Warum rennen die Schafe so plötzlich los?« fragt er und weiß auch gleich die Antwort: »Die Wölfe!« Alle sechs Schafe springen mit großen Sätzen zu den Klippen über ihnen hinauf, aber zwei Wölfe, die den Hang gerade abwärts laufen, schneiden dem letzten Tier der Gruppe den Weg ab. Das blaugraue Geschöpf jagt über eine Schneezunge zu den Felsen, viel zu schnell, so glauben wir, als daß die Wölfe es erreichen könnten. Aber auch die Wölfe kommen auf dem hartgefrorenen Schnee rasch voran, sie stieben durch die Wacholdersträucher, springen über Felsblöcke, und es sieht so aus, als seien sie jeden Moment in der Position, um das Schaf von oben her anzuspringen und umzuwerfen. Im letzten Augenblick bricht das Bharal mit einem mächtigen Satz nach vorn durch und erreicht einen schmalen Felssims, auf den kein Wolf ihm folgen kann.
Als hielte die ganze Bergwelt den Atem an, so gespannt ist die Stille. Wir sehen zwar, wie die Flanken des Schafes fliegen und die Wölfe hecheln, aber hören können wir es nicht. Ich atme tief auf, und mit mir atmet wieder der Berg und die ganze Welt.
Die Wölfe sehen sich einen Moment um, dann setzen sie sich mit jenem gemächlichen Trab in Bewegung, in dem sie mühelos 195bis zu achtzig Kilometer am Tag zurücklegen können. Zwei andere gesellen sich dazu, dann machen die vier eine Pause auf einer Yak-Weide, wo sie herumtollen und sich im Dung wälzen, ehe sie sich den Hang entlang davontrollen. Zwei Wölfe waren gestern nicht unter den fünf, die wir gesehen haben, und wir erinnern uns, daß die alte Frau von sieben Wölfen gesprochen hat.
Jetzt kommen auch die vierzehn Schafe auf dem Kamm oberhalb von ihnen in Bewegung. In schnellem Lauf flüchten sie auf einen hohen Grat, von wo aus sie in einer Linie stehend den Rückzug des Rudels im Auge behalten. Es dauert nicht lang, ehe alle Schafe wieder friedlich im Schnee nach Gräsern scharren.
Lachend schauen wir uns an und schütteln den Kopf. »Das allein war die fünfwöchige Reise wert«, seufzt GS. »Die aufregendste Wolfsjagd, die ich je gesehen habe.« Ein wenig später fragt er mich, ob ich mich an den Regentag in der Serengeti erinnere, als wir zusahen, wie wilde Hunde ein Zebra rissen und all die Tausende von Tieren in der Ebene zu flüchten begannen! Ich nicke, immer noch aufgeregt vom Anblick der Wölfe; sie gestern so nahe zu sehen und heute auf der Jagd nach Blauschafen beobachten zu können, wie sie in Sichtweite unseres Lagers über die Felsen flogen – welche Freude!
GS, der sich jahrelang zunächst mit Raubtieren beschäftigt hat, ist jetzt von den Caprinae, den Schafen und Ziegen fasziniert, die in den von ihm geliebten hohen Bergregionen leben. Und zu den seltensten Arten der Caprinae gehört das Blauschaf, zu dessen Beobachtung wir hergekommen sind. Die Schafe und Ziegen stammen vermutlich von einer gemeinsamen Ahnform aus der Gruppe der Rupicaprinae, den sogenannten Ziegenantilopen ab, deren Urheimat, wie man glaubt,[69] irgendwo südlich des Himalaja liegt. Diese Urform dürfte dem Goral, jener kleinen Ziegenantilope, die wir in der Bherischlucht sahen, ähnlich gesehen haben. Außer den sechs Arten der echten Ziege (Capra) und den sechs echten Schafsarten (Ovis) gehören zu den Caprinae noch drei des Tahr (Hemitragus), das Mähnenschaf (Ammotragus) und das Himalaja-Blauschaf oder Bharal (Pseudois), deren Merkmale sowohl denen der Ziegen als auch denen der Schafe ähneln. Die Tahre, die nach Körperbau und Verhalten ein Zwischenglied von Ziegenantilopen und echten Ziegen zu sein scheinen, werden zu 196den Ziegen gezählt wie auch die in ihrem Erscheinungsbild eher schafartigen Mähnenschafe. Auch Pseudois sieht den Schafen sehr ähnlich, insbesondere dem Wildschaf der Rocky Mountains, es bewohnt auch dasselbe Habitat der Berge in unmittelbarer Nähe der Felsklippen. Manche Exemplare tragen, wie GS sagt, die Zwischenzehen-Drüsen in allen Füßen, was als Merkmal der Ovis gilt, auch fehlen der starke Geruch, die Halsmähne und die Knieschwielen, wie sie von Capra bekannt sind. Dennoch ist GS der Ansicht, daß die Blauschafe näher mit den Ziegen als mit den Schafen verwandt sind, und hofft, dies durch seine Beobachtungen des Brunftverhaltens zweifelsfrei zu belegen.
Das meiste, was von den wilden Schafen und Ziegen Asiens bekannt ist, stammt aus den Berichten von Jägern, deshalb ist auch die Klassifizierung von Pseudois keineswegs gesichert. Und da das Blauschaf nur in wenigen Tiergärten der Welt gehalten wird, bleibt nur noch die Möglichkeit, es in seinem eigenen unzugänglichen Territorium – zwischen der Baumgrenze und Höhen bis zu 5500 Meter in der Nähe von Felsen – zu beobachten, das sich über die abgelegensten Gebiete von Ladakh und Kaschmir über Tibet nach Nordwest-China erstreckt; im Süden reicht das Verbreitungsgebiet bis zum Rand des Himalaja-Gebirges, im Norden bis zu den Kuen-Lun- und Altyn-Gebirgen. In Nepal finden sich kleine Bharal-Herden an den West- und Südhängen des Dhaulagiri (dazu gehört auch die Population, die wir in der Nähe des Jang-Passes gesehen haben), außerdem im oberen Arun-Tal; die weitaus größten Herden leben jedoch hier im Nordwesten nahe der tibetischen Grenze.
An diesem Morgen betrachte ich zum erstenmal die Blauschafe genau durch das Fernrohr. Die kurzbeinigen, kräftigen Tiere mit den kräftigen Rücken ähneln den Rocky-Mountain-Schafen, mit schnellen, schmalen Läufen und dämonisch goldfarbenen Augen. Die männlichen Tiere tragen ein mächtiges Gehörn und ein hübsches, schieferblaues Haarkleid mit weißem Rumpf und Bauch, von dem sich die dunkle Gesichtsmaske und die schwarzen Streifen an der Brust und an den Flanken wirkungsvoll abheben, auch die Vorderseiten der Beine sind dunkel. Mit zunehmendem Alter werden die Hörner wuchtiger und die Färbung dunkler. Die weiblichen Tiere sind wesentlich kleiner, sie haben 197fahlere Farben und weniger Schwarz im Pelz, ihre Hörner sind gedreht wie bei den echten Schafen, während die Böcke schwere, nach oben und hinten und dann auswärts nach vorn gekrümmte Hörner tragen. Auch das Hinterhauptbein an der Schädelbasis ähnelt dem der Ziegen, wie auch die großen Afterzehen und die ausgeprägte Zeichnung an der Vorderseite der Beine. Da die Zugehörigkeit aus den Körpermerkmalen nicht eindeutig festgestellt werden kann, wird das Brunftverhalten der Tiere der ausschlaggebende Faktor sein, von dem noch kaum Berichte vorliegen. Soweit überhaupt vorhanden, deuten sie jedoch auch im Verhalten auf eine Zwischenform. So hebt beispielsweise das Schaf bei der Paarung den Schwanz kaum über die Horizontale, wohingegen die Ziege ihn ganz auf den Rücken vorbiegt, während Tahre und Blauschafe den Schwanz gerade in die Luft strecken, vielleicht um die fehlenden Duftdrüsen der echten Ziegen auszugleichen.
Obwohl die männlichen Herden noch beisammenbleiben – die Geselligkeit der Böcke ist wiederum eine Eigenschaft der Ziegen -, besteigen die Böcke einander, wie um die sexuelle Rangordnung festzustellen. Übrigens ähneln die jungen männlichen Tiere bei vielen Schafs- und Ziegenarten den Weibchen dermaßen, daß die Leitböcke sich möglicherweise irren und alle rangniedrigen Tiere für gleich ansehen.[70] Einige Tiere zeigen ein seltsames Verhalten, von dem bislang nichts berichtet wurde und das GS als »Rumpfreiben« bezeichnet: dabei reibt der eine Bock seine Schnauze am Hinterteil eines anderen. Wenn weibliche Tiere in der Nähe sind, tritt der Bock mit einer lockeren Fußbewegung in ihre Richtung in die Luft, möglicherweise als ein Vorspiel der Besteigung oder auch um auf seine hübschen Markierungen aufmerksam zu machen. Auch stößt der Bock seine Schnauze in den Urinstrahl der Weibchen, wohl um festzustellen, ob sie brünstig sind oder nicht, und leckt dann aufgeregt an seinem Penis. Damit führen die Blauschaf-Böcke den ersten Teil einer Verhaltensform aus, die von den pakistanischen Markhor und anderen Wildziegen (den Ahnen der Hausziegen, die von Pakistan bis Griechenland verbreitet sind) bekannt ist. Die Böcke nehmen den Penis ins Maul und urinieren kräftig hinein, dann verspritzen sie den Urin über ihr ganzes Fell. Der Bart eines Ziegenbockes ist oft nichts 198weiter als ein mit Urin getränkter Schwamm, der den für die Ziegen kennzeichnenden Geruch verbreitet.
Das Fieber der Brunftzeit hat begonnen, und auch die Jungtiere scharren und stoßen spielerisch herum, als fürchteten sie, die einzige ereignisreiche Zeit im Jahr eines Blauschafes zu verpassen. GS wundert sich, daß es so wenig Jungtiere sind, und folgert daraus, daß die Sterblichkeit der Jungtiere im ersten Lebensjahr bei 50 Prozent liegen muß, was teils auf Schwäche und Krankheit wegen der kärglichen Umweltbedingungen, teils auch auf räuberische Aktionen von Wölfen und Leoparden zurückzuführen ist. Von drei Jungtieren dürfte nur eines das Alter der Geschlechtsreife erlangen, so daß die Zahl der Tiere konstant bleibt, entsprechend dem Nahrungsangebot ihres Lebensraumes. Diese Region der Tibetischen Hochebene ist mit ihren Felshängen und öden Geröllhalden einer Wüste sehr ähnlich, es wachsen hier vor allem zweierlei dornige Sträucher, sowie Caragana und die buschige Heckenkirsche Lonicera; doch fressen die Blauschafe alles, was die Gegend hervorbringt, einschließlich trockener immergrüner Gewächse und des öligen Wacholders; die Anpassungsfähigkeit der Caprinae erlaubt ihnen sogar, die dornigen Zweige in kleinen Mengen zu verzehren. Denn alle hier wachsenden Gräser, die bevorzugte Nahrung der Blauschafe, sind mit Ausnahme einiger Stellen unter dem Dornengestrüpp von den Yak-, Schaf- und Ziegenherden, die aus fernen Dörfern hierher auf die Sommerweide getrieben werden, schon weitgehend vernichtet, so daß die kahl gegraste Landschaft allmählich der Erosion unterliegt.
Da mich die Kälte dazu nötigt, jede Nacht zwölf Stunden in meinem Schlafsack zu verbringen, widme ich mich meinen Zen-Übungen. Jeden Morgen vor Tagesanbruch ziehe ich meine Daunen-Parka in den Schlafsack, um sie anzuwärmen, dann setze ich mich in Meditationshaltung auf und rezitiere für etwa vierzig bis fünfzig Minuten Sutras, darunter auch das an Kannon oder Avalokiteshvara gerichtete Sutra und das sogenannte »Herz-Sutra« (das Herzstück des mächtigen Prajnaparamita-Sutra, welches die 199Grundlage des Mahayana-Buddhismus bildet). Diese Morgenandacht gewinnt an Würde durch eine kleine Buddha-Statue aus Lehm, die ich aus dem Scherbenhaufen alter Bildnisse bei einer Stupa in Ringmo aufgelesen habe; daß es möglicherweise eine Bön-Figur ist, stört mich weiter nicht. Ich stelle die Figur auf einen flachen Altarstein vor das Zelt, wo die ersten Strahlen der Morgensonne sie treffen, und bleibe vermummt im Inneren des Zeltes sitzen, denn zu dieser Stunde beträgt die Temperatur nie mehr als minus zwölf Grad. Manchmal nimmt ein kleiner Vogel, eine Braunelle (Prunella), an der Andacht teil, mit wippendem Schwanz stöbert sie in den Dungresten herum. Sie hat einen schmalen Schnabel, hellgraues Gefieder mit einer rötlichen Brust und weißem Bauch.
Dawa fühlt sich heute besser. Die drei Sherpa wollen zum Schwarzen Teich aufsteigen und drei weitere Traglasten herunterholen. Da wir auf ihren guten Willen angewiesen sind, schonen wir sie so gut es geht, teilen unsere Sachen mit ihnen und warten ab, bis sie freiwillig an eine Arbeit herangehen, was sie auch immer tun. Aber es ist ein mühseliger, schlechtbezahlter Job, den sie übernommen haben, und ohne ihre religiöse Überzeugung hätten sie uns wohl längst im Stich gelassen, wie ihnen das die Träger so oft vorgemacht haben.
Im Verlauf der nächsten Tage bringen sie alle Lasten herab; wir zahlen ihnen dafür den doppelten Lohn als Sherpa und als Träger. Es macht nichts, daß sie verschwenderisch und unvorsichtig mit unseren Sachen umgehen, sich nicht darum kümmern, eine Schneebrille zu benutzen, und auch nicht einmal richtig warme Winterkleidung in die Berge mitbringen: ihre innere Haltung ist großartig. Zumindest diese drei haben anständige Stiefel, wogegen Gyaltsen das Geld, das er zum Kauf von Stiefeln erhalten hat, in Katmandu für unwichtigere Dinge ausgegeben hat, während Tukten nach guter Sherpa-Sitte seine Stiefel nach der letzten Expedition verkauft und die jetzige barfuß angetreten hat. So müssen die beiden den Kang-Paß in den billigen Segeltuchschuhen übersteigen, die wir wegen der Eiskruste am Jang-La an die Träger ausgeteilt hatten.
Wir gehen über die Brücke zur Flußinsel und springen von dort von Stein zu Stein zum anderen Ufer hinüber.
200
Die Sonne, durch hohe Zirruswolken verschleiert, taucht den Schwarzen Fluß und seine Umgebung in metallisches Licht, in dem Shey Gompa mit den beiden Stupas und den Gebetsfahnen wie ein Scherenschnitt auf der kahlen Felsstufe vor der weißen Schneewand steht. Auch die Sherpa machen sich auf den Weg, lachend laufen sie über die Brücke wie übermütige Jungen. Wir folgen diesmal den Spuren der Blauschafe auf den Westhängen, halten Ausschau nach Anzeichen für einen Schneeleoparden und wollen die rotgestrichene Einsiedelei besuchen, die Tsakang genannt wird. Außerdem wollen wir Brennholz sammeln.
Von den steilen Schneefeldern des Kristall-Berges ziehen mehrere Grate oder Bergrücken abwärts, die wie abgeschnitten am Ende steil zum Fluß abfallen. Zwischen den Kämmen, einer höher als der andere, liegen tiefe Schluchten. Der Weg windet sich um und über diese Endpunkte hinauf, die wie alle Anhöhen dieser Gegend durch Gebetsfahnen und Wände aus Gebetssteinen gekennzeichnet sind. Innerhalb einer Stunde sind wir gegenüber der roten Einsiedlerklause angelangt, die hoch über der Klamm auf den Felsen sitzt. Drei riesige Himalaja-Geier ziehen ihre Runden im kalten Aufwind, der aus der Schlucht des Schwarzen Flusses heraufweht. Jetzt geht es in die Schlucht hinunter, in die noch keine Sonne dringt, so daß jeder Fehltritt verhängnisvoll sein kann. Am Ende der Schlucht führt der Weg über den vereisten Fluß und steigt dann zur Klause auf. Wie wir jetzt bemerken, befindet sich noch eine zweite, kleinere Einsiedelei auf einem nördlichen Felsvorsprung. Solche abgelegenen Orte werden überall in Tibet als Stätten geistiger Einkehr errichtet »in stolzer Einsamkeit auf vom Wind umtosten Gipfeln, inmitten öder Landschaften, als wollten sie unsichtbaren Feinden aller vier Weltgegenden trotzen«.[71]
Tsakang besteht aus vier wie Schwalbennester an den Fels geklebten Hütten. Die eine ist eine Zelle mit einem engen Fensterschlitz, der auf eine Welt aus Himmel und Schnee, aus Blau und Weiß hinausblickt, die zweite hat schiefe Türen und Fensterflügel aus Holz. Auf einer kleinen Terrasse wurde ein Kartoffelacker angelegt, Kartoffelscheiben liegen zum Trocknen in der Sonne ausgebreitet. An der Felswand liegen Dungfladen und Wacholderzweige als Brennstoff für den Winter, aus einer kleinen 201Höhle tropft Wasser in eine Schieferrinne, die es in einen Kupferkessel weiterleitet. In der Höhle steht zu Ehren des Wassers eine kleine Stupa.
Die Einsiedelei ist eine echte Gompa, was eigentlich nicht »Kloster« bedeutet, sondern »Wohnstätte in der Einsamkeit«.[72] Diese Gompas werden bevorzugt in der Nähe einer Quelle an einer Felswand gebaut, die einen Fluß oder See überragt; häufig wird sie nur von einem Mönch bewohnt. Tsakang ist mit weißen und blauen Gebetsfahnen geschmückt, es hat einen prachtvollen Fenstervorbau, der mit roten, orange- und türkisfarbenen Ornamenten bemalt ist. Gemeißelte Buddha-Steine zieren die besonnten Wände.
Von der Klause aus sieht man nur die Schneegipfel, die in den blendenden Himmel ragen; selbst Shey liegt hinter den Bergen versteckt. Der Eindruck der Zurückgezogenheit ist so überwältigend, daß GS, dem das Ganze nicht geheuer vorkommt, unwillkürlich gegen das Leben des Einsiedlers und einsame Meditation Stellung bezieht: »Aber an irgend etwas muß man sich doch halten können!« Das Wesen der Meditation besteht jedoch gerade darin, alles loszulassen: »Wenn dein Geist leer ist wie ein Tal oder eine Schlucht, so wirst du die Macht des Weges erkennen.«[73]
Zwei bronzehäutige Mönche sitzen ruhig auf einer Steinbank, als ob sie etwas erwarteten. Der eine flickt seine Filzstiefel, der andere macht ein Ziegenfell mit einer gelblichen Paste aus Ziegenhirn und ranziger Butter geschmeidig. Lächelnd nehmen sie unseren Gruß an, antworten aber nicht, vielleicht haben sie Schweigen gelobt. Der Stiefelflicker ist ein junger Mann mit offenem Gesicht, kaum über zwanzig; der andere, in sonderbare Lederfetzen gehüllt, ist unbestimmbaren Alters; er ist verkrüppelt und trotzdem gutaussehend. Als wir nochmals grüßen, verbeugen sie sich, lächeln abermals, bleiben aber stumm.
Der steile Pfad klettert weiter zu den Hängen über den Klippen, die mit gelbgrünen Flechten bewachsen sind. Sonst gibt es hier nur Dornengestrüpp und Schiefergestein. Auf den Stufen einer großen Stupa verzehren wir die fettigen Teiglappen, die laut Phu-Tsering »Pfannkuchen« sein sollen und als Abwechslung die trockenen Tschapatis oder »Brote« aus grünem Buchweizenmehl 202 ersetzen. Unten in der Hütte erscheinen uns diese Mahlzeiten reichlich eintönig, hier oben am Berg in Sonne und Wind erscheint alles, was den Hunger stillt, frisch und schmackhaft.
GS will die Schafe oberhalb von Tsakang beobachten, ich klettere den Pfad wieder hinab, um Brennholz zu sammeln. Auf halbem Weg begegnet mir ein struppiger Fremder, der singend zu der kleinen Plattform heraufsteigt, auf der ich ihn erwarte, um ihn vorbeizulassen. Er setzt seinen Korb ab, stellt sich hinter einen Felsen und fragt angriffslustig: »Timi kaha gani?« (Wohin gehst du?) »Shey Gompa«, antworte ich. Er wiederholt »Shey Gompa«, tritt hinter dem Felsen hervor, und wir beide deuten auf Somdo, um es zu bekräftigen. Der Mann ist in schwärzliche Schaffelle gekleidet und trägt das übliche Sammelsurium von Meditationsketten und Amuletten um den Hals, dazu ein silbernes Feuerzeug und einen Dolch. Er fordert etwas zu rauchen und lacht ungläubig, als ich bedeute, daß ich nichts dergleichen bei mir habe. Drohend richtet er den Dolch auf meine Kehle, um mir zu demonstrieren, was ein Räuber jetzt mit mir täte. Grußlos setzen wir beide unseren Weg fort.
Weiter unten, wo gestern die Wölfe die Schafe gehetzt haben, suche ich im Wacholdergebüsch nach abgestorbenen Ästen. Das Wacholderreisig ist das einzige verfügbare Brennholz; zwar gibt es in den Schluchten verkrüppelte Birken, doch sie wachsen dort an völlig unzugänglichen Stellen. Mit dem Reisigbündel auf dem Rücken treffe ich in Shey ein, wo es mittlerweile lebendig geworden ist. Wie sich herausstellt, gehört der Mann, den ich getroffen habe, zu einer Gruppe von Leuten aus Saldang, die nach ihren Yaks suchen. Die Tiere waren hier auf der Sommerweide, offenbar hat ihnen der Platz gefallen, denn sie sind aus freien Stücken zurückgekehrt. Ein paar Yaks grasen am Berghang, andere sind auf den Flußinseln zu sehen, wo dichteres Gras wächst.
Die Besucher drängeln sich in die Kochhütte, um zu beobachten, wie die Sherpa die Körbe mit Lebensmitteln vom Kang-La auspacken. Die Hirten berichten, daß neun oder zehn Wölfe regelmäßig auf ihrer Jagdtour durch die Gegend von Shey kommen, auch sollen sich zwei oder drei Schneeleoparden im zerklüfteten Gelände oberhalb des Flusses aufhalten. Ferner erzählen 203sie, daß es in Saldang einen Polizeiposten gibt; es ist für uns also nicht ratsam, uns dort blicken zu lassen. Einer der Männer hat die Gelegenheit unserer Abwesenheit genutzt und aus meinem Zelt ein Paar Socken geklaut, die ich zum Trocknen aufgehängt hatte. Dabei hat er auch meinen Buddha umgeworfen. Solange die Leute in der Nähe sind, muß immer einer von uns als Wachtposten bei den Sachen bleiben. Jang-bu nimmt an, daß die Hirten unsere Anwesenheit dem Polizeiposten melden, so daß wir in den nächsten Tagen Besuch zu erwarten haben, da Fremde in dieser abgelegenen Region von Dolpo ungern gesehen sind.
Gestern abend schneite es eine Weile, dann kam der Mond durch die Wolken, und heute morgen ist der Himmel wieder klar. Bei Tagesanbruch stehen die zottigen Yaks unbeweglich wie Statuen am Flußufer.
Zum erstenmal auf unserer gemeinsamen Reise ist GS völlig glücklich. Wie ich ist auch er sehr von Shey beeindruckt, das die langwierige Wandertour gelohnt hat; ständig kritzelt er Notizen in sein Heft, sogar während des Essens. »Außergewöhnlich« ist das Wort, das mir hier ständig einfällt, obwohl ich mir bewußt bin, daß es zu schwach und auch nicht ganz treffend ist. Nicht daß die Dinge, die wir hier gefunden haben, außergewöhnlich sind, beeindruckt mich so, sondern daß sie die unmittelbare Wirklichkeit jener Regionen des Geistes haben, in denen »Berge, Wölfe … Schnee und Feuer ihr wahres Wesen verwirklicht hatten, oder ihren Ursprung hatten«.[74] Trotzdem betrachte ich täglich mit Besorgnis die dunklen Wolken, die von Norden und Süden heranziehen. Wie es scheint, schneit es am Kang-Paß und im Süden. Ich schäme mich meiner Angst, daß uns der Schnee einschließen könnte, und das um so mehr, als GS sich überhaupt nicht darum kümmert, obwohl er ebensogut weiß wie ich, daß im Kloster nicht genügend Vorräte vorhanden sind, um uns alle über den Winter zu bringen.
204
Nachmittags bricht plötzlich ein Hagelschauer los, der Hagel wird zu Schnee und am Abend schneit es noch immer. Jang-bu berichtet, unsere Spuren am Kang-Paß seien unter dem Schnee verschwunden, und die Leute aus Saldang haben erzählt, der Weg nach Samling, das wir in den nächsten Tagen besuchen wollten, sei durch Schneewehen versperrt. Aber solange der Shey-Paß im Osten offen ist, kann man in einem Tagesmarsch nach Saldang gelangen. Von dort aus soll es eine Route über Tarap und entlang dem Bheri geben, die gewöhnlich den ganzen Winter passierbar ist, da die Pässe dort nicht so hoch sind. Wir haben jedoch keine Papiere für die Tarap-Region und auch nicht das Bedürfnis, den Rest des Winters im Gefängnis von Tarap zu verbringen. GS meint, man könne sich vielleicht bei Nacht am Polizeiposten vorbeischleichen, aber die Hunde würden uns wahrscheinlich doch finden. Meist streift er das Problem nur, und wenn ich darauf zu sprechen komme, tut er es mit einer Handbewegung ab: »Darüber wollen wir uns jetzt noch nicht den Kopf zerbrechen; wenn wir mit unserer Arbeit hier fertig sind, sehen wir weiter.«
Gegen Mittag kommt scharfer Ostwind auf, der Himmel bezieht sich und es wird sehr kalt. Die Leute aus Saldang haben gestern ein Yak geschlachtet und bieten uns Fleisch zum Kauf an, aber unser mageres Budget ist ihren Wucherpreisen nicht gewachsen; auch die ranzige Butter lehnen wir dankend ab. Einige Saldang-Leute sind bereits aufgebrochen und haben das Fleisch und Kartoffeln auf dem Rücken ihrer Yaks mitgenommen; auch eines der beiden Thermometer von GS haben sie mitgehen lassen. Da das Thermometer zu seinem Arbeitsmaterial gehört, ist seine Wut verständlich, mit der er den zurückgebliebenen Saldangleuten mit der Polizei von Saldang droht. Sie hätten Abgesandte der Regierung Ihrer Majestät in Katmandu bestohlen, sagt er ihnen. Das stimmt zwar, denn offiziell sollen wir für diese die Möglichkeit erkunden, hier ein Naturschutzgebiet einzurichten, aber diese groben, langhaarigen Kerle scheren sich den Teufel um die Regierung in Katmandu, die viele Jahrhunderte entfernt jenseits des Himalaja liegt.
Der Mann mit dem Schnurrbart und den großen Ohrringen, 205der uns die Butter angeboten hat, heißt Tundu, sein Gehilfe ist ein junger Bursche namens Tasi Fintso. Mit der Hilfe von Namu und Tasi Fintso belädt er die übrigen Yaks und Dzos, die vor dem Kloster angebunden stehen. Mit ihren kurzen Nasen und den flauschigen Stummelschwänzen sehen die Tiere recht gutmütig aus, in Wirklichkeit sind es jedoch recht wilde, störrische Bestien, die bis zu einer halben Tonne und darüber wiegen können. Tasi Fintso hält denn auch respektvoll Abstand, während Tundu gelassen mit den Ungetümen umgeht, er redet ihnen gut zu, während er die Packsättel aus Holz und Leder auflegt und die Säcke darüber festbindet. In seinen Bewegungen ist eine Ruhe, die ihm eine gewisse Würde verleiht, offenbar ist er auch der Anführer der Gruppe. Er verspricht, den Schlüssel zum Kloster mitzubringen, wenn er in etwa fünf Tagen aus Saldang zurückkommt. Ohne ein weiteres Wort führt er seine Tiere nach Osten davon. Seine kleine Tochter Chiring Doma läßt er bei Namu zurück. Chiring Doma und Nyima Poti sitzen auf einer Decke in der Sonne und essen Kartoffeln. Trotz der Kälte ist Nyima Poti splitternackt, während ihr Bruder Karma Chambel wenigstens einen Kittel anhat. In ihrem Kleid aus Sackleinwand sieht die rotbackige kleine Chiring Doma selbst wie eine lachende Kartoffel aus. Sobald Tundu gegangen ist, setzt Namu ihre Arbeit fort und legt Yak-Dung zum Trocknen unter den Gebetswänden aus.
Die Nächte in Shey sind klirrend kalt unter den kühl funkelnden Sternen und so still, daß man auf dem hartgefrorenen Pfad den Tritt eines Wolfes weithin in der Schlucht hören würde. Doch heute rüttelt noch vor Tagesanbruch ein steifer Wind an der Zeltleinwand, und es ist wieder klar, dafür aber auch noch kälter geworden; der Weiße Fluß unter uns ist eisbedeckt und läßt kaum noch ein Murmeln hören.
Zwei Raben lassen sich auf dem Dach der Gompa nieder. Goraak! Goraak! krächzen sie, und so werden sie auch von den Sherpa genannt. Zwischen den Gebetsfahnen und den großen Argalis-Hörnern hockend grüßen sie das erste Tageslicht mit einem 206seltsam musikalischen Laut – A-ho -, den man niemals aus ihren rauhen Kehlen erwartet hätte. Doch noch ehe die Sonne erscheint, fliegen die großen schwarzen Vögel wie Nachtgespenster davon. Dafür flitzt jetzt die kleine Braunelle im Hof hin und her.
Um sieben gibt es Frühstück in der Kochhütte – Tee und Porridge -, danach begleite ich GS gewöhnlich zu seinen Schafen und mache mich nach einer Weile zu meinen eigenen Erkundungsgängen auf. Ich suche die Höhlen und Simse auf der anderen Seite des Flusses mit dem Glas nach Leopardenspuren ab und halte ständig Ausschau nach Vögeln, Wölfen und Fossilien. Manchmal betrachte ich auch nur den Himmel und die Berge, manchmal meditiere ich und versuche, jenen Zustand geistiger Leere zu erlangen, in dem alles »ruhig, frei und unsterblich« ist. »Alle Dinge waren ewig gegenwärtig, da sie an dem ihnen zugedachten Platz waren … etwas Unendliches erschien hinter jedem Ding.«[75] (Das hat nicht etwa ein Buddhist gesagt, sondern ein Brite im siebzehnten Jahrhundert.) Und bald bekommen alle Geräusche, alles was man sieht und fühlt, eine Unmittelbarkeit, als würde das Universum aufhorchen, ein Universum, in dessen Mittelpunkt man selbst steht und das nicht identisch ist mit, aber auch nicht verschieden ist von diesem Selbst. »Du wirst dich der Welt nicht recht erfreuen, solange nicht das Meer in deinen Adern fließt und du dich mit den Himmeln kleidest und die Sterne als Krone trägst: solange du dich nicht als Alleinerben der ganzen Welt erkennst und mehr als das, denn es leben darin andere Menschen, die ebenfalls Alleinerben der Welt sind, ebenso wie du.«[76]
Auf dem Berg über Somdo habe ich einen Platz entdeckt, der sich als Meditationsstätte eignet: eine altarförmige Stufe in einer Felsnische, die von allen Seiten durch Granitblöcke und dichtes Dornengebüsch geschützt und nur nach Süden offen ist. Wenn die Sonne scheint, wird es richtig warm hier. In den Felsritzen haben kleine, verkümmerte Pflanzen Zuflucht gefunden: bereits welke, rotbraune Stengel eines wilden Buchweizens (Polygonum), ein paar Büschel Fingerkraut, blasses Edelweiß und Immergrün und sogar ein paar armselige Hanfstengel. Ich rücke einen großen Stein als Sitz zurecht, lege das Fernglas in Reichweite, 207falls sich irgendwelche Tiere zeigen sollten, und setze mich dann mit gekreuzten Beinen hin. Ich lasse meinen Atem ruhig werden, bis ich kaum noch atme.
Die Berge um mich her beginnen zu leben, der Kristall-Berg bewegt sich. Ich höre den Fluß unterm Eis murmeln, obwohl mir unglaublich erscheint, daß ich das Geräusch hier oben hören kann. Auch bei Windstille schwillt das Flußrauschen an und ab, wie der Wind selbst. Instinktiv öffne ich mein Inneres, um alles Lebendige einzulassen, wie sich eine Blume mit Sonne füllt. Jetzt müßte man sich wie eine aus der Schote platzende Frucht von der alten Schale befreien können und dann auffliegen …
Obwohl ich mir keiner Gemütsregung bewußt bin, legt sich mit der Öffnung meines Geistes ein feuchter Schleier über meine Augen. Dann bläst frischer Wind mir die Augen und den Kopf wieder klar und Körper-Geist kommt und geht mit der leichten Brise. Ein sonnendurchtränkter Buddha. An einem dieser Tage muß ich einmal im fallenden Schnee meditieren.
Ich senke den Blick von den Eisgipfeln zu den Flechten, glänzenden Dornen und Schneeflecken. Obwohl ich blind für sie bin, ist die Wahrheit ganz nahe, sie ist da in der Wirklichkeit, auf der ich sitze – im Gestein. Diese harten Felsen lehren meine Knochen, was mein Gehirn in dem Herz-Sutra nie verstanden hat: »Form ist Leere, Leere ist Form« – der leere Raum des blauschwarzen Weltalls ist in allem enthalten. Während ich meditiere, beginnen die schweren Felsen manchmal zu tanzen.
Das Geheimnis der Berge besteht darin, daß sie einfach existieren, was ich auch tue, sie existieren einfach – und das tue ich nicht. Die Berge haben keine Bedeutung, sie sind Bedeutung, sie sind. Die Sonne ist rund. Ich klinge vor Leben, und die Berge klingen, und wenn ich es zu hören vermag, dann ist da ein Klang, der uns gemeinsam ist. Ich begreife das alles weniger mit dem Verstand als mit dem Herzen und weiß, wie sinnlos der Versuch ist, das nicht Ausdrückbare in Worte zu fassen, denn nichts als leere Worte bleiben übrig, wenn ich es anderntags wieder lese.
Gegen vier Uhr setzt die Sonne dem Kristall-Berg Feuer auf. Ich schlage den Kragen hoch und ziehe die Handschuhe an, ehe ich den Rückweg nach Somdo antrete, wo mein Zelt noch die letzten Sonnenstrahlen gefangen hält. Im Windschatten trinke ich 208heißen Tee und beobachte, wie die Dunkelheit aus der Erde steigt. Die untergehende Sonne schickt heilige Strahlen ins tiefer werdende Blau und verwandelt einen Raben in einen schimmernden Silbervogel der Nacht. Die große Stille senkt sich herab und mit ihr die Kälte; die Temperatur ist weit unter den Gefrierpunkt gesunken und wird bis zum Morgengrauen noch um die zwanzig Grad tiefer fallen.
Im Dunkeln gehe ich an den unbewohnten Häusern vorbei zur Kochhütte, wo Phu-Tsering mit einem frisch gebackenen grünen Laib Brot wartet. Die Sherpa haben aus Steinplatten zwei Tische gebaut, abends wird es in der Wärme des Dung- und Wacholderfeuers fast gemütlich hier.
Wie immer sitzt GS neben mir und zeichnet Daten auf. Mit tränenden Augen schreiben und lesen wir beim Schein der Kerosinlampe. Wir freuen uns darüber, zusammen zu sein, sprechen jedoch kaum mehr miteinander als ein paar Worte beim Essen. Gewöhnlich gibt es bitteren Reis mit Tomaten- und Sojasoße, Salz und Pfeffer, hin und wieder auch eine dünne Linsensuppe dazu. Nach dem Abendessen schaue ich noch eine Zeitlang in die Glut, bis mir die Augen vom Rauch brennen. Ich sage gute Nacht, trete mit gesenktem Kopf durch die niedrige Tür in die frische, sternenklare Nacht hinaus und gehe zu meinem kalten Zelt, um dort die nächsten zwölf Stunden bis zum ersten Tagesschimmer zu verbringen. Ein wenig lese ich noch, ehe der Docht in meiner kleinen Kerosinlampe verglimmt. Dann liege ich lange Zeit unbeweglich da, geborgen in der Stille der Erde, aufgeregt und erwartungsvoll wie ein Kind. Ich brauche das Marihuana gar nicht, das ich in Yamarkhar gesammelt und unterwegs getrocknet habe, um mir die langen finsteren Nächte zu vertreiben; ich bin so schon »high« genug.
»Betrachte es als eines: Dieses Leben, das folgende und das Leben dazwischen«, schrieb Milarepa. Und manchmal frage ich mich, in welches Leben es mich verschlagen hat, so still sind hier die langen Nächte, und so kalt.
209
Hoch oben in den Bergen treffe ich auf eine Herde von siebenundzwanzig Blauschafen, in der sich Böcke und weibliche Tiere aller Altersstufen befinden; bis jetzt haben die Böcke eine eigene Herde gebildet.
Sobald sie mich sehen, zieht die vielversprechend gemischte Gesellschaft über einen Bergkamm nach Norden; ich folge ihr in der Hoffnung, für GS, der in der Nähe von Tsakang arbeitet, einige Daten sammeln zu können. Nach einer Weile legen die Schafe sich auf einem Grashang nieder, der steil zur Mündung des Schwarzen Flusses abfällt. Ich ziehe mich an eine Stelle zurück, wo die Tiere mich nicht sehen können, damit sie sich beruhigen, ehe ich mich ihnen erneut nähere.
Lange Zeit hindurch sitze ich unbeweglich. Ein Rotschwänzchen hüpft auf den nahen Felsen herum, dann kommen Dohlen im Wind herbeigesegelt, ein Schwarm von etwa fünfzig Vögeln bricht laut in die stille Landschaft ein.
In meiner Anoraktasche finde ich ein paar Nüsse von Rohagaon und klopfe sie mit einem Stein auf. Von meinem Sitz aus kann ich in alle vier Windrichtungen sehen. Im Osten kommt der Weiße Fluß von den Schneefeldern herab, irgendwo dort hinten liegt Saldang. Im Süden windet sich der Canyon des Schwarzen Flusses in das Kanjiroba-Gebirge, im Westen ragt der große kantige Kegel des Kristall-Berges auf in den Wind, der unangenehm dunkle Wolken über den blauen Himmel schiebt. Im Norden hinter dem Somdo-Berg liegt irgendwo auf einem verborgenen Plateau Samling, die alte Hochburg des Bön-Glaubens.
Die Herde ist weiter den Hang hinaufgezogen, auf eine Höhe von über 4500 Meter. Da der Wind von Süden kommt und meine Witterung auf sie zuträgt, setze ich mich einen Kilometer seitlich nach Osten ab und steige dann vorsichtig auf, bis ich, zuletzt flach auf dem Bauch kriechend, nur etwa hundert Meter entfernt liegenbleibe.
Es ist aufregend, so in unmittelbarer Nähe der Schafe ausgestreckt auf dem warmen Berghang zu liegen, der atmend, wie ich atme, mich in sich aufnimmt. Bis auf einige Tiere liegen wieder alle da, etwas abseits von den übrigen stehen vier ausgewachsene 210Böcke, die mich furchtlos ansehen. Die Sonne funkelt auf den Grannenhaaren im Fell der wiederkäuenden Schafe, die schweren Böcke mit ihren breiten Rücken sind kräftige, schöne Tiere. Obwohl der Wind nun aus ihrer Richtung weht, rieche ich nichts.
Eines der Männchen spürt, daß ich da bin, es hat den Nacken aufgebogen und seine Ohren und Augen sind mit einer gelassenen Wachheit auf mich gerichtet, die mich irgendwie an Tukten erinnert; wo mag unser sonderbarer Mönch jetzt wohl sein? Die meisten Jungtiere haben mir ihr Hinterteil zugekehrt, während die erwachsenen Tiere umgekehrt liegen und mir den Kopf zuwenden, da sie Gefahr von unten erwarten. Wie wir täglich beobachtet haben, halten sie zu dieser Zeit ihr Vormittagsnickerchen und werden kaum vor einer Stunde aufstehen. Ich ziehe mich deshalb hinter einen Felsen zurück. Als ich eine Stunde später nach ihnen sehe, stehen sie gerade auf. Ein Weibchen uriniert kauernd, der Bock hinter ihm steckt erst die Schnauze in den Strahl und dann in die Vulva. Dann reckt er den Hals in sichtbarer Erregung und kräuselt mit geschlossenen Augen die Oberlippe, wie um den Geruch genau zu prüfen. Ein anderer Bock verfolgt ein zweites Weibchen und stupst die Nase ebenfalls in ihr Hinterteil, ein dritter Bock dreht den Kopf nach hinten, wie auf der Suche nach dem eigenen Penis (wie es die Ziegenböcke tun), verliert aber bald das Interesse daran.
Die Tiere beginnen zu grasen. Mit verdrehtem Nacken suchen sie unter den buschigen Geißblattgewächsen nach Grasbüscheln und nehmen dabei auch ein paar von deren gelblichen Blättern mit. Angeführt von einem Weibchen – gemischte Herden werden meist von weiblichen Tieren geführt – ziehen sie langsam talwärts und verschwinden in der Talmulde. Als sie wieder auftauchen, kommen sie geradewegs auf den kleinen Hügel zu, hinter dem ich liege. Sie sind auf einmal so nahe, daß ich das Fernglas zentimeterweise sinken lasse, um sie durch das aufblitzende Glas nicht zu erschrecken. Das Kinn dicht an den mit spärlichem Gras bewachsenen Boden gedrückt, hoffe ich, daß sie mein braunes Haar für den Schopf eines Murmeltieres halten. Und da kommen sie auch schon grasend heran, die Böcke immer dicht hinter den Weibchen schnüffelnd, die beiden Jährlinge zum Schluß.
Das weibliche Leittier steht jetzt etwa zehn Meter entfernt von 211mir auf der Hügelkuppe. Plötzlich wittert sie mich, dreht sich mit einem Ruck herum und mustert meine reglos im Staub liegende Gestalt. Auch sie rührt sich nicht von der Stelle, sondern steht gespannt da mit runden Augen und leicht zitternden Beinen: ein herrlicher Anblick. Der Bock hinter ihr bekommt jetzt ebenfalls meinen Geruch in die Nüstern. Mit einem Sprung wirbelt er herum, der Schwanz schießt steil in die Höhe. Er stampft mit dem rechten Vorderfuß auf, wobei er ein sonderbar rauhes und helltönendes Wiehern hören läßt: Chirrritt! – es erinnert mehr an die Stimme eines Eichhörnchens als an die eines Huftieres. (Den Laut habe ich später GS genau zu beschreiben versucht, so weit uns bekannt ist, ist es der erste Hinweis überhaupt auf die Stimme der Blauschafe.) Kühn tritt jetzt der Bock vor, um den Störenfried zu untersuchen, die übrigen Schafe folgen nach, bis der Berghang hinter lauter gehörnten Schafsköpfen und blauen Fellen verschwindet. So gut ich kann, halte ich den Atem an. Nervös beginnen ein paar Tiere zu grasen, dann beruhigen sich alle, und die Herde verschwindet nach Osten hinter einem Kamm. Noch einmal tauchen die Köpfe von zwei Weibchen darüber auf, wie um zu prüfen, ob auch wirklich kein Verfolger nachkommt. Dann sind alle verschwunden.
Auf dem Heimweg halte ich vor Sonams Hütte an. In rußigen Lumpen und groben Filzstiefeln, die Korallenkette ihrer verlorenen Mädchenzeit um den Hals, sitzt die alte Frau mit ausgestreckten Beinen im Hof und webt eine Decke auf einem Webrahmen, der zwischen Steinen und Stöcken ausgespannt ist und gegen den sie ihre Sohlen drückt. Ihre Arbeit zeigt ein hübsches Muster; diese alte Wilde hat einen Sinn für dekorative Wirkung. Ich bewundere sie mit ihrem plötzlichen Grinsen, ihrem starken Rücken und ihrer gegerbten Haut, der die Kälte nichts auszumachen scheint.
Auch Sonam war einmal ein Kind mit roten Wangen wie die kleine Poti. Jetzt webt sie, mit altersschwachen Augen über ihre Arbeit gebeugt, im letzten Tagesschimmer, während schon die Kälte der Nacht unter dem blassen Halbmond aufsteigt. Wenn sie nicht mehr genug sieht, kriecht sie in ihre enge Hütte und ißt ein wenig Gerste. Wovon träumt sie bis Tagesanbruch, wenn sie sich auf die endlose Dungsuche begibt? Vielleicht weiß sie es auch 212besser und träumt und denkt überhaupt nicht, sondern geht einfach dem Geschäft des Überlebens nach wie ein Wolf; zu überleben ist ihre Art des Meditierens. Als ich Jang-bu später frage, weshalb sie den ganzen Winter allein oben am Berghang wohnt, wo doch Hütten unten neben Namus Haus leerstehen, sieht er mich verwundert an: »Aber sie ist doch an ihr Zuhause gewöhnt!« antwortet er.
Namu hat Mausefallen für GS ausgelegt, und bald hat er eine ganze Sammlung flauschiger, kurzschwänziger Mäuse, einige Wühlmäuse und eine Spitzmaus zusammen.[77] Außer Schafen und Wölfen gibt es noch Spuren von Wieseln, dem tibetischen Hasen und Füchsen, die aber wie die winterschlafenden Murmeltiere unsichtbar bleiben. Einmal erhaschen wir den Anblick eines Hasen, sonst müssen wir uns mit ihren Kotspuren zufriedengeben. Das gilt auch für einen unidentifizierten Hühnervogel, vermutlich handelt es sich um ein Himalaja-Rebhuhn. Zu Gesicht kommen uns nur einige Gebirgsvögel wie Adler, Weißkopf- und Lämmergeier, Dohlen, Bergtauben, Finken, Rotschwänzchen, Braunellen und Lerchen, ferner die ausdauernden Eidechsen der Sonnenhalden und einiges Kleingetier, wie Ameisen, Bienen, Heuschrecken und Spinnen.
Bemerkenswert sind vor allem die Populationen jener Kleintiere, die am Schattenhang des Weißen Flusses leben. Seit mehr als einem Monat schon sind sie unter der dicken Schneedecke eingeschlossen, wo sie im Jahr vier Monate länger in der Winterstarre verbleiben müssen als ihre Artgenossen auf der Sonnenseite desselben Tales. Es müßte faszinierend sein zu erforschen, welche Adaptionen der sonst identischen Populationen im Laufe der Jahrtausende aufgetreten sind (oder auch nicht), worin GS mir zustimmt.
Gestern trafen wieder Yaks ein, dazu ein Pony mit einer Glocke, das Ongdi gehört, dem Bruder Namus und Eigentümer unserer Kochhütte. Er ist mit seinen Söhnen und einer Schwiegertochter hergekommen, zweifellos auf die Nachricht hin, seine 213Hütte sei von Ausländern besetzt, die tote Mäuse und Wolfsscheiße sammelten; nun will er versuchen, diese unerhörte Situation zu seinen Gunsten auszunutzen. Der scharfäugige, gerissene und immer lächelnde Bursche fordert fünf Rupien täglich für seine Bruchbude, gibt sich aber dann auch mit einer Rupie zufrieden, als wir ihm ein Pfund billigen Tee dazu anbieten. Ongdi betrachtet unsere Habe mit gierigen Blicken, ihn hat das Fieber des Erwerbens ergriffen; wie seine Schwester uns erzählt, will er Ende des Monats auf eine Tausch-Handelsreise über Jamoson und das Kali-Gandaki-Tal möglicherweise bis nach Katmandu gehen. Er war schon einmal in Katmandu und wird deshalb von den Einheimischen als weitgereister Mann geachtet. Im Tausch gegen einige Keksdosen, Plastikbehälter und ähnliche Schätze, die wir ohnehin zurückgelassen hätten, gibt er uns einen Korb voll Kartoffeln und ein Stück Yakbutter. Abends gab es geröstete Kartoffeln mit Butter – die erste Butter seit Pokhara und ein Gericht, das der haute cuisine seit Wochen am nächsten kam.
Die Morgensonne verwandelt mein dünnes Zelt aus einem braunen Abfallsack aus Plastik in einen mit Licht erfüllten Ballon. Natürlich bleibt es ein zerschundenes Zelt mit Flecken und Rissen, aber trotzdem habe ich es liebgewonnen, denn es ist mir zum Zuhause geworden. Jeden Tag fege ich den Staub hinaus, der unaufhörlich von den trockenen Dungfladen im Hof hereingeweht wird. Man versteht die Gleichgültigkeit der hiesigen Leute gegenüber dem Schmutz, wenn man schon wenige Momente nach dem Waschen wieder voller Staub ist: Ich starre allmählich vor Dreck.
Neben der Gebetswand sammelt Namu getrocknete Dungscheiben in einen Korb, Ongdi wird das kostbare Brennmaterial mit nach Saldang nehmen, wo es noch weniger zu verfeuern gibt als hier. Der Yakmist verbrennt mit einer heißen, klaren Flamme fast ohne Rauch und wird in den Gebirgsregionen oberhalb der Baumgrenze als wertvolle Ware gehandelt.
Ongdis jüngerer Sohn, Tema Tende, schlägt einen unergründlichen eigenen Rhythmus auf einer Felltrommel, deren Ton weit durch die Bergluft dringt: bum-bum-bum,bum-bum-bum,bum.
Mit seinem ältesten Sohn Karma Dorje und dessen hübscher, 214kindlicher Frau Tende Samnug packt Ongdi Kartoffeln, Fleisch und Gerste auf seine Yaks, dazu eine kleine, grob gearbeitete Kommode, die er in Saldang verkaufen will. Jang-bu wird sie nach Saldang begleiten, um sich dort über Lebensmittel, die Polizei und die Route über Tarap zu erkundigen, für den Fall, daß der Kang-Paß durch Schneefälle versperrt wird.
Als Ongdi einmal nicht herschaut, schiebt mir Tende Samnug vier Kartoffeln als Geschenk herüber, die Gabe kommt von Herzen, und Tende Samnug strahlt über das ganze runde Kindergesicht. Nachher will Ongdi mir noch unsere einzige Kerosinlampe abhandeln. Sollte er in ein, zwei Wochen noch einmal herkommen, wenn unser Kerosin ausgegangen ist, dann soll er sie haben. Karma Dorje, auch ein Dauerlächler, will ebenfalls etwas von mir, was ich nicht verstehe, und so reden wir hin und her, wobei »Saldang« das einzige Wort ist, das beide Parteien verstehen.
Frühmorgens, beim Beobachten der Schafe, bin ich mit GS übereingekommen, daß ich Shey am 18. November verlassen werde, falls Tukten und Gyaltsen bis dahin eingetroffen sind. Andernfalls müssen wir annehmen, daß sie durch irgendeine der vielen denkbaren Möglichkeiten daran gehindert wurden, zu uns zu stoßen. Wenn Tukten nicht kommt, wird Jang-bu mich das erste Stück auf dem Weg begleiten. Wir wollen dann die Route über Saldang nach Osten einschlagen in der Hoffnung, so den beiden Sherpa zu begegnen. Jang-bu soll für mich einen Träger in Saldang anheuern und dann so rasch wie möglich zu GS zurückkehren. Mir ist wohler nach diesem Beschluß, jetzt kann ich die ganze Angelegenheit fürs erste beiseite schieben.
Auf dem Weg hinter Tsakang in Richtung Norden gibt es eine Stelle, von der aus sich ein phantastischer Anblick auf die Gipfel und Bergketten bietet, die sich bis zu dem Tal erstrecken, wo Yeju und Kangju vereint in den großen Karnali-Fluß münden. Der Weg ist oft nur ein schmaler Sims und dazu an jedem Nordhang mit Eis und Firnschnee überkrustet. Aber auch auf den schneefreien Südseiten muß man auf jeden Schritt achten, und 215dabei fällt mir etwas auf, was einem großen Pfotenabdruck ähnlich sieht. Einerseits ist es ziemlich undeutlich, andererseits haben wir hier noch keine Leopardenspuren gefunden und GS ist viel zu weit voraus, um ihn deswegen zurückzurufen. So schlage ich keinen Alarm, sie wird auf unserem Heimweg auch noch da sein. Im selben Augenblick bleibt GS über mir stehen und zeigt auf etwas, das ich beim Näherkommen als deutliche Kratzer und Abdrücke einer großen Katzenpfote erkenne. Auch diese Abdrücke sind schon älter, aber wir wissen jetzt zumindest, daß hier Schneeleoparden vorkommen.
Im allgemeinen verbringt jeder von uns den Tag allein, aber oft, wenn wir zusammen unterwegs sind, scheint uns das Glück besonders gewogen. Die Kratzer und Spuren führen zu einer Felskante, an der ein anderer Canyon einmündet, und GS meint: »Dort vorne an der Ecke müßte ein Haufen Leopardenkot liegen, solche Stellen lieben sie.« Und dort liegt er auch, ausgerechnet unter einer kleinen Stupa – das Juwel im Herzen des Lotus, denke ich unwillkürlich, als ich meinem Freund anerkennend zunicke. »Na, ist das nichts«, fragt GS, »sich derart über einen Kothaufen zu freuen?« Und er sammelt den Fund in einer Plastiktüte, die er gleich neben unserem Vesperbrot in seinem Rucksack verstaut. Obwohl die Spuren mindestens eine Woche alt sind, suchen wir doch alle umliegenden Hänge und die Spalten und Höhlen darin sorgfältig mit unseren Ferngläsern ab.
Noch mehrere Male treffen wir auf Fußspuren und Exkremente. Vielleicht ist das Tier hier nicht ansässig, sondern kommt nur gelegentlich auf einer Jagdtour vorbei wie die Wölfe; seit einer Woche haben wir keinen Wolf mehr gesehen. Andrerseits bietet sich das Labyrinth aus Schluchten und Geröllhalden über uns geradezu als Leopardenunterschlupf an, hier ist er sicher vor seinen Feinden, den Wölfen, und nahe genug, um die Bharals zu jagen. Möglicherweise werden wir den Leoparden auch in den folgenden Tagen nicht zu Gesicht bekommen, aber es scheint ziemlich sicher, daß uns der Leopard von irgendwo beobachtet.
In der folgenden Schlucht wird die zweite Einsiedelei sichtbar, deren rotbemalte Mauern mit blaugrauen und weißen Ornamenten geschmückt sind, doch fehlen die Reisigbündel an den Wänden und andere Anzeichen von Bewohnern; die weißen Gebetsfahnen 216hat der Wind zu Streifen zerschlissen. Ganz in der Nähe sind Höhlen mit rauchgeschwärzter Decke, offensichtlich Behausungen einstiger Einsiedler, denen die Nahrungsmittel vielleicht aus Tsakang herübergebracht wurden. Die kleine Gompa ist halb in eine Höhle in der Felswand hineingebaut, am äußersten Ende eines Felsens, der steil in den Schwarzen Canyon abfällt; sie schaut wie Tsakang nach Süden über den Schwarzen Fluß, nur sind von hier aus die Stupaspitzen von Shey über der Flußbiegung zu sehen, so daß die Aussicht weniger halluzinatorisch wirkt als das ausschließliche Blau-Weiß in Tsakang. Die kleine Einsiedelei liegt an einem Pilgerpfad, der vom Schwarzen Fluß hochsteigt, den Kristall-Berg umrundet und dann über Tsakang nach Shey zurückführt. Jetzt ist alles verlassen, am Nordhang verschwindet der Weg unter Eis und Schnee.
Ich setze mich auf die Schwelle, den Rücken gegen die sonnenwarme Holztür gelehnt, und esse einen grünen, von Phu-Tsering gebackenen Buchweizenfladen, der wie ein mit Flechten überwachsener Mandala-Stein von der Gebetswand aussieht und auch so ähnlich schmeckt. Blauschafe haben ihren Dung in den kleinen Hof abgesetzt, irgend jemand hat eine Sonne und einen Mond über den Türpfosten gemalt. Hier, an diesem verlorenen Ort am Rande der Schlucht und der Welt erscheinen mir das harte Brot, der Schafsdung und das Flattern der zerfetzten Fahnen im Wind ebenso illusionär wie alle Vernunft. Warum beunruhigt mich das Poltern der Felsblöcke in der Schlucht des Schwarzen Flusses? Das alles in sich aufnehmen können, den Bergfluß, die Sonne und den Wind, die Fülle des Seins mit dem Atem hineinnehmen … und doch … ich weiche vor diesem Geräusch zurück, das mir wie das drohende Donnern des Universums vorkommt.
Heute hat GS einen unsicheren Schritt. Er stellt Überlegungen an über atmosphärische Ionen, die eine depressive Wirkung haben sollen, wie bei den Mistral-Winden in Südfrankreich (es gibt neuerdings Spekulationen darüber,[78] daß negative Ionen mit ihrem günstigen Einfluß auf Tiere und Pflanzen irgend etwas mit Prana, der »Lebenskraft«, zu tun haben). Wir sind uns einig, daß man in gedrückter Stimmung besonders ungeschickt ist, GS 217meint jedoch, daß seine Schlappheit eine Krankheit, etwa eine Erkältung ankündigt. Vielleicht hat er recht, aber ein Stück zurück, auf demselben Sims, war es, als suchten meine Füße wie von einer unsichtbaren Kraft gezwungen von selbst die lockeren Steine und vereisten Stellen, ich fühlte mich benebelt, schwer und ängstlich. Dort lag eine Kraft in der Luft, eine undeutliche Bedrohung. Auf dem Rückweg ist die Bedrücktheit vergangen, ich schreite wieder rasch und leicht voran. Irgendwie ist mir wohler, wenn der Abgrund links von mir liegt, aber das kann nicht der Grund dafür sein, daß mir derselbe Sims, der mir beim Hinweg solche Angst einjagte, jetzt mit einemmal richtig Spaß macht. Ich werde keineswegs leichtsinnig, im Gegenteil, gerade der präzise, an genau der richtigen Stelle aufsetzende Schritt und das Tappen meiner Füße erfüllen mich mit Leben. Sonnenstrahlen fangen sich in den Eisgipfeln über mir, und ein Schwarm schwarzer Dohlen tanzt über der Tiefe; Dunkel und Helligkeit wechseln ab über dem Pfad in der alles durchdringenden Gegenwart des Seins.
Die hohen Steinmauern dieses Hofes trennen mein Zelt von den anderen ab, wodurch es möglichem Diebstahl besonders ausgeliefert ist. Diebstahl ist nichts Ungewöhnliches in dieser Gegend, deshalb behalte ich die beiden Wollhändler im Auge, die gestern von Saldang herübergekommen sind. Sogar für hiesige Verhältnisse überaus schmutzig, haben sie weder Wolle noch andere Handelsgüter bei sich. Dem ersten Mann begegnete ich im Hof von Namus Haus, wo er Gerstenkörner verzehrte, der zweite stattete mir einen unerbetenen Besuch ab, indem er einfach den Kopf zu mir ins Zelt hineinsteckte und den Inhalt unverfroren musterte, wie um seinen Wert abzuschätzen. Das Zelt ist so klein, daß man es fast wie ein Kleidungsstück trägt. Das plötzliche Eindringen eines anderen Kopfes – und eines unheimlichen, wölfischen, dreckstarrenden dazu – brachte unsere Gesichter näher zusammen, als mir lieb war. Daß der Kerl sich nicht gleich zurückzog, als er merkte, daß das Zelt besetzt war, nahm ich als 218Zeichen der Unschuld; trotzdem machte ich eine nicht eben herzliche Gebärde, er solle sich sofort davonscheren. Daraufhin sprach der Kopf zum ersten Mal mit sanfter Stimme auf englisch: »Ich gehen?« Und dann verschwand der Kopf mit einem Lächeln, das dieses Gesicht, welches mir zuerst hinterhältig und verschlagen vorkam, völlig veränderte: Es war kein Lächeln, das man »freundlich« nennen dürfte, es war begnadet, Ausdruck einer aus tiefstem Herzen kommenden Hinnahme der Gegebenheiten dieser Welt, ja des Einverstandenseins mit ihr.
Ich hob die Zeltklappe, um ihm nachzurufen, wußte aber nicht, was ich sagen sollte. Der Mann winkte mir trotz meiner Unhöflichkeit freundlich zu und verließ den Hof.
Bald entdeckte ich, daß auch der andere Mann, der in Namus Hof Gerstenkörner gegessen hatte, ein überaus freundliches Lächeln hat; allerdings fehlte ihm die seraphische Aura seines Gefährten. Beim Abendessen schwieg ich mich aus, als GS und Phu-Tsering ihrer festen Überzeugung Ausdruck gaben, es handle sich wohl um Tempelräuber, die sich liebend gern mit unserem letzten Sack Linsen davonmachen würden. Sie beschlossen, über Nacht die Holztür der Hütte abzusperren, und anderntags sollten die Sherpa so lange abwechselnd Wache halten, bis die beiden das Weite gesucht hätten.
Heute morgen zeigt sich, daß all unsere Sicherheitsvorkehrungen albern waren, denn die Wollhändler sind bei Tagesanbruch den Schwarzen Fluß entlang zum Kang-Paß aufgebrochen. Mir tut es leid, denn ich hätte ihnen als Wiedergutmachung gern einen freundlichen Abschiedsgruß mitgegeben. Tatsächlich sind sie unsere Wohltäter, dadurch – falls sie durchkommen -, daß sie eine neue Spur in den Schneefeldern am Kang-La treten, so daß Tukten und Gyaltsen, die dieser Tage in Ringmo eintreffen müssen, einen gebahnten Weg finden. Wenn sie hören, daß eben zwei Männer den Kang-Paß bewältigt haben, werden sie den Übergang ebenfalls wagen.
Namu, die heute morgen den Tee mit uns trinkt, hat geröstete Gerstenkörner mitgebracht, die dem grauen Porridge eine willkommene Abwechslung im Geschmack verleihen. Sie weiß nur Gutes von den Händlern zu erzählen, die schon im letzten Jahr hier vorbeikamen; sie wohnen am Bheri-Fluß und haben früher 219mit Bhot oder B'od Handel getrieben. Namu sagt »Po«, das Land Po. Im allgemeinen werden nur die Zentralprovinzen U und Thang von den Tibetern »Bhot« genannt, was soviel heißt wie Geburtsort oder Heimat, wogegen Osttibet als Khams bezeichnet wird und Westtibet sich früher aus kleinen Königreichen wie Lo (Mustang) und Dol zusammensetzte. Ich denke an Tsurton-Wang-Gay, wie Milarepa, einen Jünger des Marpa, der aus dem Lande Dol kam. Falls das alte Dol und Dolpo tatsächlich identisch sind, müßten die ältesten Gebetssteine im Steinfeld neben dem Gompa noch aus dem elften Jahrhundert stammen, als Tsurton-Wang-Gay in diesen Bergen wandelte und sich Milarepas Haut grün färbte, da er nur von den Nesseln vor seiner Höhle lebte. Vielleicht hatte Milarepa ähnliche langfingrige Gesellen im Sinn wie unsere Besucher aus Saldang, als er vom »gesetzlosen Volk der Yepo und Yemo aus Dol« sprach.[79]
An diesem Morgen steige ich auf den Berg hinter Somdo und beobachte zwölf Böcke, die bislang noch keinerlei Interesse an weiblichen Tieren zeigten. Nach einer zweistündigen harten Kletterpartie bin ich höher als der Schwarze See und kann den ganzen Canyon des Schwarzen Flusses in Richtung Kang-Paß überschauen. Hinter dem Kang-La versperrt die große Eiswand des Kanjiroba den Blick nach Südwesten, ein Wall aus kristallinen Graten und weißen Gipfelhörnern, der weit über 6000 Meter in die Höhe ragt. Hier oben geht nur ein leichter Ostwind, aber über dem Kanjiroba blasen die Höhenwinde feine, in der Sonne leuchtende Schneewolken in das Himmelsblau.
Zwei kleine schwarze Punkte wandern in der weißen Wüste: Die Wollhändler nähern sich dem Schwarzen See und dürften am frühen Nachmittag auf dem Paß anlangen. Vielleicht übernachten sie im Höhlenlager und treffen dann morgen in Ringmo ein. Ich weiß nicht warum, aber die beiden Händler erinnern mich an meinen ersten Aufenthalt in Katmandu im Winter 1961, als sich in den alten Basaren die Händler aus den Bergen drängten. Damals war das Nepal-Tal voll von tibetischen Flüchtlingen, die ihre wertvollen Kultgegenstände verkaufen mußten, um überleben zu können. Dort im Asan-Basar kaufte ich auch den grünen Akshobhya-Buddha aus Bronze, der später den Mittelpunkt eines kleinen Altars in Deborahs Krankenzimmer bildete; Akshobhya 220ist der »Unerschütterliche«, er verkörpert jenen Aspekt des Buddha-Wesens Shakyamunis, der den Versuchungen der Dämonen unter dem Bodhi-Baum in Gaya widerstand.
Die Tage hier sind strahlend wie jene fernen Oktobertage in Tichu-Rong. Nicht ein Wölkchen zeigt sich, alles ist klar, klar, klar. Obwohl es im Schatten auch tagsüber sehr kalt ist und ein ständiger Wind weht, brennt die Sonne heiß herab; man stelle sich vor: eine glänzende gestreifte Eidechse im tiefen November in über 4500 Meter Höhe! Zum erstenmal wird mir die unglaubliche Hitze unseres Sternes bewußt, wie sie die frostige Weite so vieler Kilometer des Weltraumes durchdringt.
Felsen und Schneegipfel, große Vögel am blauen Himmel und dunkle Flußtäler, mit welchen Worten kann man solche Herrlichkeit beschreiben? Und doch steckt auch hier wieder ein unfaßbarer, verborgener Schrecken in all der Pracht, wie das demantene Eis, das die Felsen auseinandersprengt. Die Sonne blinkt wie eine Waffe, mir dreht sich der Kopf. Der Schwarze Canyon wölbt und windet sich, der Kristall-Berg ragt auf wie eine Burg des Schreckens und das ganze Universum zittert vor Entsetzen. Mein Kopf ist die blutgefüllte Schädelschale des Magiers, und würde ich wagen, mich umzuwenden, dann würden meine Augen gerade ins Herz des Chaos sehen, in das blutige Inferno, den Schmerz, den ich in den hellen Augen dieser kleinen Eidechse ahne.
Dann endlich weicht der Spuk, hinterläßt jedoch einen Nachgeschmack. Die Eidechse liegt noch da, eins mit dem Felsen, ihre Flanken pulsieren in der Hitze des Sternes, der uns beide wärmt. Die Ewigkeit ist nicht weit weg, sie ist hier, neben uns.
Ich will mich von oben und Osten her den Blauschafböcken nähern, so daß die Sonne mir im Rücken steht. Ich warte auf die Flaute, die sich bei schönem Wetter jeden Morgen einstellt; danach beginnt dann eine Brise von Norden zu wehen, in der die Schafe mich nicht wittern können.
Über dem Bergkamm fliegen tibetische Schneefinken, die ich bisher nur von weitem gesehen habe. Sie lassen sich zwischen den Felsblöcken nieder, einige Lerchen sind auch dabei, sie stieben dann mit leisem Gezwitscher ebenso plötzlich davon, wie sie gekommen sind.
221
Im Windschatten ist es so still, daß man das tropfende Schmelzwasser unter dem Schnee hört, die ganze Welt scheint zu ruhen. Ich pirsche mich unter dem Bergkamm nach Westen und luge immer wieder über das Geröll und die Schneewehen, bis ein Stangenwald von Hörnern in Sicht kommt. Aufmerksam behalten die Bharals die tieferliegenden Hänge im Auge, die nächsten sind etwa zweihundert Meter westlich unter mir. Kriechend erreiche ich eine Felsengruppe, die nur einen Steinwurf weit von den Tieren entfernt ist. Voll Genugtuung über meine Anschleichkünste grinse ich in mich hinein – und werde sofort dafür bestraft: das Trommeln von Hufen durchbricht die Stille.
Die Schafe ziehen nordwestlich zum Gipfel der Anhöhe, wohin ich ihnen in einigem Abstand folge. Diesmal erreiche ich mühelos meinen Beobachtungsposten und sehe zu, wie sich die befreundeten Böcke gegenseitig stupsen, beschnüffeln, lecken und sogar besteigen. Aber bald schon höre ich wieder das mir bereits vertraute chirrit, chirrit, chirrit, das so sehr dem Warnruf eines Nagers ähnelt, daß ich mich unwillkürlich nach einem Murmeltier umschaue. Mehrere Bharals schrecken gleichzeitig auf, und innerhalb von Sekunden rast die kleine Herde im Galopp hangabwärts, obwohl ich gut verborgen liege und mich nicht gerührt habe. Vielleicht unterschätze ich meinen Geruch.
Ein goldfarbener Adler gleitet mit schrillem Geschrei fast in Augenhöhe an mir vorüber; eine tiefere Stimme, wie sie einem solch königlichen Vogel gemäßer wäre, würde nicht so weit durch die leere Wildnis dringen. Nun kommen auch Wildtauben angeflogen, es sind Turkestanische Bergtauben mit blaugrauer Flügeldecke, die hier auf dem Tibetischen Plateau die Stelle der Schneetauben einnehmen. Adler und Tauben, ein herrliches Bild in der eisigen Luft, doch trösten sie mich nicht darüber hinweg, daß die Schafe mir wieder weggelaufen sind; ich folge ihren Spuren nordwärts, bis die frischen Abdrücke in eine steile, vereiste Klamm führen, wohin weder Mensch noch Wolf ihnen folgen können. Aber die Schafe haben mich auf den einzigen Aussichtspunkt in dieser Gegend geführt, von dem aus man, weit entfernt auf einem Plateau im Nordosten, zwei blasse Gebäude erkennen kann: Mein erster und einziger Blick in dieser Inkarnation auf das alte Bön-Kloster Samling, denn der Weg durch den tiefen 222Schwarzen Canyon ist unpassierbar und der Pfad über die Berge ist durch Schneeverwehungen gesperrt.
Am Nachmittag kommt Jang-bu mit guten Nachrichten zurück. Der Weg von Saldang über Tarap ist tatsächlich fast den ganzen Winter über offen, man muß nur über den Shey-Paß nach Saldang steigen. Außerdem gibt es einen Yak-Pfad von Saldang nach Murwa, jenem hübschen Dorf südlich von Ringmo unter den großen Wasserfällen. Um diese Jahreszeit gehen viele Leute aus Saldang nach Murwa oder ins Bheri-Tal, teils um als Arbeiter oder Träger Geld zu verdienen, teils als Woll- und Salzhändler oder auch, um ihre Yaks als Tragtiere auf der Hauptroute zwischen Tarakot und Jumla zu vermieten. Wie Jang-bu erzählt, findet eben jetzt ein großes Abschiedsfest mit viel Tanz und Bier statt, aber sicherlich werden bis zu unserem Eintreffen noch genug Träger für den Heimweg zu haben sein.
Jang-bu hat in Saldang auch mit den beiden Wollhändlern gesprochen, die später durch Shey kamen und die wir so unfreundlich behandelt haben. Wie sich jetzt herausstellt, haben sie von Jang-bu eine Botschaft an Tukten und Gyaltsen übernommen. In Saldang gebe es auch keine Polizei, versichert Jang-bu, dafür aber »viele Tempel« und einen Lama aus Shey. Aber der echte Lama von Shey Gompa, der Tulku oder inkarnierte Lama, den ich so gerne treffen wollte, ist niemand anders als der verkrüppelte Mönch, der das Ziegenfell mit Yakbutter und Hirnbrei bearbeitete. Namu hat den Einsiedler in Tsakang gut geschützt.
Im Osten steigt nach Einbruch der Dunkelheit hell der Planet Mars auf, und bald darauf folgt auch der Vollmond dem Weg der Sonne von Ost nach West. Bei Vollmond werde ich immer unruhig, sozusagen mondsüchtig, und hier über dem Weißen Fluß werde ich zum Mondgucker. Der Mond steigt über den Weißen Fluß, läßt die Gebetsfahnen geisterhaft aufleuchten und scheint das gestapelte Reisig zu entzünden. Mein kleiner Lehm-Buddha auf seinem Altarstein bewegt sich. Die Schneefelder leuchten im Mondlicht auf, die Felsen und Gipfel, der gewundene Fluß in 223seiner dunklen Schlucht, die Sterne und das Firmament, alles klingt wie die Glocke von Dorje-Chang. Jetzt! Hier ist das Geheimnis! Jetzt!
Bei Tagesanbruch, als sich das Blauschwarz im Osten silbern lichtet, geht der Mond mit der Dunkelheit im Westen unter. Tauben kommen in den Hof geflogen, vierzehn helle, blaugraue Vögel mit einem breiten weißen Band über den Schwanzfedern, das in den ersten Sonnenstrahlen aufleuchtet. Wie alles Getier im Umkreis des Kristall-Berges sind die Bergtauben nicht scheu; sie fliegen nicht davon, als ich mich vorsichtig nähere, sondern wenden nur neugierig den Kopf.
Ich treffe die gemischte Herde hoch oben am Hang. Diesmal versuche ich, mich ihnen im Zickzackkurs zu nähern, ich klettere immer wieder ein Stück auf sie zu und dann wieder zurück, was die Tiere sonderbarerweise zu beruhigen scheint. Sie betrachten mich eine Zeitlang und stellen dabei offenbar fest, daß sie mich nicht ernstzunehmen brauchen, denn sie kümmern sich nicht mehr um mich und gehen ihrer Beschäftigung nach, die heute morgen besonders langweilig ist. Ich klettere weiter. Tief unter mir ist der Fluß von seiner nächtlichen Eisdecke befreit und reißt das graue Geröll aus den Bergen mit sich.
In der Hoffnung, einen Schneeleoparden zu sehen, habe ich mir an der Schneegrenze einen Windschutz auf einem Aussichtspunkt gebaut, von dem aus ich nach Norden über den ganzen Schwarzen Canyon hinweg bis zum Terrassenhang unterhalb von Samling blicken kann. Auch der Berghang vor Tsakang ist in meiner Sichtweite, desgleichen die Höhlen unter den Klippen und die Steilhänge zwischen den Querschluchten. Damit sollte ich die Bewegung der meisten Blauschafe hier in dieser Gegend sehen, falls sie von einem Wolf oder Leoparden gejagt werden. (GS schätzt die Population in der Umgebung von Shey auf 175 bis 200 Tiere.) Anders als die Wölfe, kann ein Leopard seine Beute nicht auf einmal verzehren und bleibt mehrere Tage in der Nähe, wenn er ein Schaf gerissen hat. Wir müssen also nur genau hinsehen, wo sich die Geier, Raben und Dohlen in größeren Scharen versammeln.
Der Himalaja-Weißkopfgeier ist lederbraun gefärbt und erreicht fast die Größe eines Lämmergeiers. Seine eleganten Kreise 224über den Gipfeln und Graten regen die Phantasie der Tibeter an, die ähnlich wie die verschwundenen Arier der vedischen Zeit Himmel und Wind verehren. Blau und Weiß sind die Farben des Himmelsgottes, der im Bön-Glauben als Verkörperung von Raum und Licht gilt, und auch die Wesen der oberen Himmelsregionen sind zu Bön-Symbolen geworden wie die Geier, die Drachen und die sagenhaften Garudas.
Die buddhistischen Tibeter glauben, daß die Gebetsfahnen und Windglocken die Anrufungen der Gläubigen dem Wind übermitteln. Aber auch die roten Papierdrachen, die an Festtagen über der braunen Altstadt von Katmandu tanzen, sind tibetischen Ursprungs. Es gibt einen Brauch, der »Luftbestattung« genannt wird, bei dem der Körper des Verstorbenen auf einem Felsen wie diesem in der Wildnis ausgesetzt wird, damit Raubtiere und Aasfresser die Weichteile verzehren, und wenn dann nur noch die Knochen übrig sind, werden auch diese zu Pulver zerstoßen und mit Teig vermischt als Vogelfutter ausgelegt. So wird alles den Elementen zurückgegeben, der Tod geht über ins Leben.
Die Geierschatten streifen immer häufiger über mich hinweg. Vielleicht glauben die Greifvögel, der seltsame Fleck in der Landschaft – die reglose Gestalt eines in Meditation versunkenen Mannes – sei der Anwärter einer solchen Luftbestattung, denn ein junger Adler mit schwarz-goldenem Gefieder kommt mir mit seinem hohen Geschrei immer näher, und ein Lämmergeier streicht so dicht über mich hinweg, daß ich den Luftzug seiner Flügel spüre. Ich fahre zusammen, springe mit einem Satz auf und erschrecke damit auch den dunklen Vogel, so daß er vier langsame Flügelschläge macht, die einzigen übrigens, die ich je bei diesen großartigen Seglern des Himalaja gesehen habe.
Der Boden wirbelt vor Energie – die langsame, spiralförmige Bewegung hat nichts Erschreckendes -, und in dieser Höhe, in diesem unendlichen Raum und dieser grenzenlosen Stille strömt diese Energie durch mich hindurch und verbindet meinen Körper mit der Sonne, bis kleine, silbrige Atemzüge, ein kühler, klarer Lufthauch, der nicht mehr der meine ist, sich im mineralischen Atem des Berges verlieren. Eine weiße Daunenfeder tanzt vor mir in der Sonne, balanciert für einen Moment auf einer Spitze in 225einem Dornbusch und trudelt dann weiter. Zwischen dieser weißen Feder, dem Schafsdung, dem Licht und der flüchtigen Ansammlung von Atomen, die ich »Ich« nenne, gibt es nicht den geringsten Unterschied. Gegenüber ist ein Berg, aber dieses »Ich« steht keinem Ding gegenüber, keinem Ding entgegen.
Ich wachse in den Berg hinein wie Moos, ich bin verzaubert von den blendenden Schneegipfeln und der glasklaren Luft, dem Klingen von Erde und Himmel in der Stille, den Bestattungsvögeln, den Sagentieren, den Fahnen, großen Hörnern und alten beschrifteten Steinen, von dem groben Tatarenvolk in seiner Tracht und den Filzstiefeln, vom silbernen Eis auf dem Schwarzen Fluß, dem Kang-La und dem Kristall-Berg. Und ich liebe die alltäglichen Wunder: das Murmeln meiner Freunde am Abend, das heimelige Wacholderfeuer im Lehmherd, die eintönige Nahrung, die Härte und Einfachheit dieser Tage und die Befriedigung, immer nur eines nach dem anderen zu tun. Wenn ich meinen blauen Trinkbecher in die Hand nehme, tue ich nichts anderes. Seit Ende September wissen wir nicht, was für Neuigkeiten es in der Welt gibt, und werden es auch bis Dezember nicht wissen. Allmählich läutert sich mein Geist, Sonne und Wind haben meinen Kopf leergefegt. Und obwohl wir wenig sprechen, bin ich nie einsam; ich bin in mich selbst zurückgekehrt.
Nun, da ich einmal hier bin, möchte ich den Kristall-Berg nie wieder verlassen. Schon bei dem Gedanken daran lächle ich, um nicht weinen zu müssen. Ich denke an Deborah, auch sie würde lächeln. In einem anderen Leben – ich weiß das nicht, ich spüre es nur – sind diese Berge mein Zuhause gewesen. Irgendwo in mir regt sich längst vergessenes Wissen und tritt hervor wie eine Quelle aus einer verborgenen Wasserader. Einen Blick auf das eigene Wahre-Wesen zu erhaschen, ist eine Art Heimkehr zu einem Ort östlich der Sonne und westlich des Mondes, eine Heimkehr, die keines Heimes bedarf, wie der Wasserfall am oberen Suli Gad, der sich in Nebel verwandelt und wieder aufsteigt, noch ehe er die Erde berührt.
226
Tukten und Gyaltsen sind gestern abend eingetroffen, einen Tag vor dem frühesten geschätzten Termin. Sie hatten gutes Wetter und überhaupt keinen Schnee auf den niederen Pässen zwischen Tibrikot und Jumla. In Ringmo haben sie die beiden Wollhändler getroffen, und jemand hat sie zum Kang-Paß geführt. Aber wie Gyaltsen berichtete, der als erster eintraf und mit seiner Version der Geschichte herausplatzte, hat es unterwegs große Schwierigkeiten gegeben. In Jumla hat Tukten sich betrunken und dann vorgeschlagen, mit dem Geld durchzubrennen, das sicher in den an GS und mich gerichteten Briefen enthalten sei; der ständige Disput darüber endete erst in Ringmo mit einer handfesten Prügelei.
Gyaltsen ist jung und aufgeregt, aber er ist kein Lügner; die Sherpa haben uns schon immer vor Tukten gewarnt. Trotzdem ist die Geschichte verworren, und immerhin ist die Post wohlbehalten eingetroffen. Tukten, der einige Zeit nach Gyaltsen eintrifft, ist ruhig und sieht uns mit offenem Blick an wie immer. Er verteidigt sich keineswegs, sondern schließt Gyaltsen so selbstverständlich in sein freundliches Verhalten gegenüber jedermann ein, daß sogar Jang-bu, Gyaltsens Freund und Tukten gegenüber immer besonders mißtrauisch gesinnt, nach einer Weile völlig entwaffnet über seine kuriosen Geschichten lacht. Dieb oder nicht, ich freue mich, Tukten wiederzusehen, der mein Begleiter auf dem Heimweg werden soll.
Die Briefe stecke ich ungeöffnet in meinen Rucksack; ich werde sie erst in Jumla oder gar in Katmandu lesen. Heut ist der zwölfte, am achtzehnten November werde ich Shey Gompa verlassen. Selbst wenn die Briefe schlechte Nachrichten enthalten, könnte ich nicht früher aufbrechen, denn Tukten und Gyaltsen haben eine anstrengende Reise hinter sich und brauchen Ruhe. Auch gute Nachrichten würden hier nur stören und mir die einzigartige Möglichkeit verderben, Augenblick für Augenblick in der Gegenwart zu leben, ohne in Zukunft oder Vergangenheit abzuschweifen und mir Trugbilder von Beständigkeit und Dauer vorzugaukeln, wo ich doch gerade versuche, alles fahrenzulassen und wie die weiße Daunenfeder davonzuwehen.
227
Gestern hat ein streunender Wolf, als hätte er sie umwandelt, eine Spur um die Gebetsmauer am anderen Flußufer gezogen, und heute sind auf dem Pfad nach Tsakang Leoparden-Abdrücke sichtbar. Wie um Schutz zu suchen, grasen die Blauschafe in unmittelbarer Nähe der Einsiedelei, wo ich in Gesellschaft Jang-bus dem Lama von Shey einen Besuch abstatten will.
Als wir ankommen, ist der Lama gerade in der Einsiedelei mit Sutrenrezitationen beschäftigt; sein Gehilfe sitzt vor der Tür und sortiert Kartoffeln aus. Er ist ein Trapa, ein Mönchsanwärter, der mit seinem offenen Gesicht jünger aussieht als die zweiundzwanzig Jahre, die er tatsächlich zählt. Er heißt Takla und kommt aus dem Norden der tibetischen Ebene.
Wir sitzen auf dem sonnigen Vorsprung unter dem hellblau umrahmten Fenster der Gompa, lauschen dem Gemurmel des Lama von drinnen und schauen hinaus auf den Schnee. Bald kommt Leben in die Berge, sie tanzen und schwingen – wie lebendig sie doch sind vor dem blauen Himmel. Würden sie doch nur zerspringen und uns in einer Explosion von weißem Licht verschlingen! Aber ich bin dafür noch nicht bereit; ich wehre mich voller Angst, die Welt aus meiner tödlichen Umklammerung zu entlassen, all das loszulassen, was mir die Illusion von Sicherheit vorgaukelt. Die gleiche Furcht – die Kontrolle zu verlieren, verrückt zu werden, eine Furcht, die ärger ist als die Furcht vor dem Tode – kann einen auch nach der Einnahme halluzinogener Drogen befallen: Bekannte Dinge verlieren die Form, die wir ihnen zugeschrieben haben, geraten in Bewegung, unser Bezugsrahmen zerbricht, denn wir suchen ihn außen und nicht in unserem Inneren.
Als der Lama schließlich zu uns heraustritt, scheint er sich über den Besuch zu freuen, obwohl wir ihm keine Kata, den bei einer solchen Gelegenheit als symbolische Opfergabe üblichen weißen Schal überreichen können. Er ist ein imposanter Mann mit der langen Hakennase und den vorspringenden Wangenknochen eines Prärie-Indianers. Er hat eine dunkle, kupferfarbene Haut und weiße Zähne, die langen schwarzen Haare sind in einem Zopf aufgesteckt. Er trägt eine alte Lederjacke mit Messingknöpfen, die mit vielen farbigen Flicken aus grobem, buntgewebtem Leinen besetzt ist. Beim Sprechen sitzt er barfuß mit verschränkten 228Beinen, zieht aber ausgetretene Schuhe ohne Senkel an, sobald er herumgeht. Im Flur hinter ihm hängt ein Wolfsfell, das er sich in der kalten Hütte um die Hüften legt.
Auf mein Bitten erzählt er seine Lebensgeschichte; aus Jang-bus stockender Übersetzung entnehme ich folgendes:
Karma Tupjuk wurde vor zweiundfünfzig Jahren von tibetischen Eltern in der Gegend von Manang, einer Stadt mit tibetischer Bevölkerung, an den Nordhängen des Annapurna geboren. Zu dieser Zeit war der vormalige Lama von Shey Gompa, Tuptok Sang Hisay, schon seit mehreren Jahren tot. Da er ein Tulku gewesen war, das heißt eine Reinkarnation seines Vorgängers, suchte die Bevölkerung von Dolpo nach dem neuen Tulku, der gewöhnlich wenige Jahre nach dem Hinscheiden der vorigen Reinkarnation geboren wird – nicht aus demselben Fleisch und Blut, sondern so, als würde mit seiner Lebensflamme eine neue Kerze entzündet. Auf der Suche kam die ausgesandte Delegation auch nach Takang in der Gegend von Manang nahe dem Wallfahrtsort Muktinath, wo Wasser, Luft und Erde in einem sonderbaren Feuer brennen. Als sie von einem Knaben hörten, der sich als der gesuchte Tulku bezeichnete, unterwarfen sie ihn den verschiedensten Prüfungen; so wählte er aus einer Vielzahl ähnlicher Gegenstände ohne Zögern jene aus, die dem Lama in seinem früheren Leben gehört hatten: Trinkschale, Kleider, religiöse Gegenstände. Als Tupjuk seine Prüfer davon überzeugt hatte, daß er tatsächlich der Tulku war, den sie suchten, wurde er offiziell als solcher anerkannt und sie nahmen ihn nach Shey mit. Da er aber erst acht Jahre alt war, durfte er jedes Jahr eine Zeitlang nach Manang zurückkehren, um dort bei seinem Bruder, dem Lama Pamawongal, religiöse Unterweisung zu erhalten.
Der Glaube an das Tulku-Phänomen ist erst jüngeren Datums und wurde auch rückwirkend angewandt: So gelten die Dalai Lamas, die es als Institution erst seit dem sechzehnten Jahrhundert gibt, als Tulkus von Tschenrezigs. Karma Tupjuk wird als echte Wiederverkörperung einiger großer Kargyütpa-Lamas angesehen, deren Inkarnationslinie von dem weisen Inder Tilopa über den Lama Marpa, und von Lama Marpa durch neun Jahrhunderte hindurch bis Tuptok Sang Hisay verläuft. Wie Milarepa und viele andere Kargyütpa-Lamas hat er ein Einsiedlerleben in 229einsamer Meditation gewählt, welches als »kurzer Pfad« zur wahren Erkenntnis die höchste Daseinsform darstellt. Aber der Welt auf diese Weise völlig zu entsagen, erfordert nicht nur äußerste Disziplin, sondern auch außerordentliche innere Kräfte und Begabung, und in meine Bewunderung für den Lama mischt sich Bedauern darüber, daß im Vergleich zu ihm mein eigener Einsatz nur halbherzig und zu spät erfolgt ist.
Vor vielen Jahren zog Karma Tupjuk sich nach Tsakang zurück, wo er den Rest seines Lebens zu verbringen gedenkt. Bis vor zehn Jahren ging er oft den Pilgerpfad um den Berg herum, bis ihn die Krankheit, wohl Arthritis, derart in seiner Bewegungsfähigkeit hemmte, daß er sich heute nur noch mit verdrehten Füßen unter großen Schmerzen auf Krücken fortbewegen kann. Trotzdem ist er fröhlich, offen und gütig, natürlich und fest geblieben und sieht während des Gesprächs oft lächelnd zum Kristall-Berg hinüber, der am westlichen Himmel über unseren Köpfen schwebt.
Das Kloster müsse sehr alt sein, viel älter als die gegenwärtigen Gebäude, schließt der Lama aus dem Alter und der Anzahl der Gebetssteine in der Nähe. Die meisten Gebetsfahnen im Dolpo-Gebiet sind mit uralten hölzernen Druckstöcken bedruckt worden, die in Shey aufbewahrt werden. Wie die alten Schriften berichten, soll vor tausend Jahren ein großer Yogi namens Drutob Senge Yeshe[80] auf einem fliegenden Schneeleoparden reitend hierhergekommen sein, um das wilde Bergvolk, das an einen schrecklichen Berggott glaubte, zum Buddhismus zu bekehren. Von Schlangenwesen unterstützt, widersetzte sich der Berggott den Bekehrungsversuchen, aber der Schneeleopard vermehrte sich hundertachtmal und besiegte den Berggott. Drutob Senge Yeshe machte den Berggott zu einem Beschützer des Dharma und ließ einen Berggipfel wie viele andere zu dem Kristall-Berg werden, der heute als heiliger Ort in ganz Dolpo und darüber hinaus verehrt wird.
Der Lama zeigt uns das lange Horn einer Tibet-Antilope, das er vor Jahren aus dem Norden der Tibetischen Ebene, der Khang genannt wird, mitgebracht hat. Der Sikkim-Hirsch, dessen Geweih Shey Gompa schmückt, lebt ebenfalls in Khang, sagt der Lama, auch gebe es dort ein gewisses »pferdeartiges« Tier, vermutlich 230 eine Art Wildesel. Was das Argalis betrifft (Ovis ammon, die am besten bekannte Rasse ist das Marco-Polo-Schaf), so habe es hier noch vor ein paar Jahren solche Tiere gegeben, und er deutet auf den Berghang über Somdo. Am liebsten würde ich all diese Neuigkeiten über die Täler hinweg GS zuschreien. Auch hat der Lama häufig einen Sao, wie der Schneeleopard hier genannt wird, auf den Wegen unterhalb von Tsakang gesehen, das seinen Namen dem roten Lehmanstrich seiner Wände verdankt. Die kleine Einsiedelei weiter nördlich heißt Dölma-jang, die Grüne Tara – »Göttin der Mädchen«, klärt Jang-bu mich auf. (Die Grüne Tara ist der Ehrenname einer nepalesischen Prinzessin, die zusammen mit einer anderen Frau, der Weißen Tara, im siebten Jahrhundert den großen König Srongtsen Gampo von Tibet zum Buddhismus bekehrte.) In Dölma-jang wohnt ein einsamer Trapa, der jetzt auf einer Bettelfahrt um Lebensmittel ist. Die Einsiedelei Dölma-jang, hinter der die Meditationshöhle von Drutob Senge Yeshe versteckt liegt, soll das älteste Gebäude in dieser Gegend sein. Dort wurde letztes Jahr von durchziehenden Khampas eine schöne Statue der Grünen Tara gestohlen, woraus sich das mißtrauische Verhalten der Leute von Shey gegenüber uns Fremden erklärt.
Der Lama erhebt sich unter Schmerzen und humpelt zu einer kleinen Plattform über dem Abgrund, wo er sich hinhockt und durch einen Spalt in die Schlucht uriniert; als freue er sich an der minimalen Verschiebung seines Blickwinkels, schaut er sich dabei lächelnd um. Ein Tropfen Tulku-Pipi funkelt auf den Steinen vor ihm in der Sonne.
Sodann dürfen wir das Gompa besichtigen. Der Lama führt uns durch mehrere dunkle Kammern, die mit Gerste, Öl, rotem Pfeffer und anderen Geschenken der Gläubigen für Karma Tupjuk angefüllt sind. Das Kloster besitzt auch Ackerland in Saldang, dessen Pächter die Hälfte ihres Ertrages an das Kloster abgeben, der größte Teil der Yakbutter, des Tees und des Tsampa stammen jedoch aus Opfergaben. Eine roh aus einem Baumstamm gehauene Leiter führt in einen Raum des Obergeschosses, wo eine große Kohlenpfanne und mehrere Kupfertöpfe und -urnen stehen. Karma Tupjuk hebt den Deckel eines Wasserbehälters ab 231und legt ihn auf einen Haufen getrocknete Dungfladen, während er sich die Hände abspült. Dann erst betritt er das kleine Gebetszimmer, das durch ein hellblaues Fenster einen weiten Ausblick über die Schneefelder bietet. An den Wänden hängen zwei schöne Thangkas, auf Stoff gemalte Rollbilder, und an der Altarwand stehen Bronze- und Messingstatuen von Karmapa, dem Gründer der Seitenlinie der Kargyütpas, zu der der Lama gehört, ferner von Dorje-Chang, Shakyamuni und Tschenrezigs. Überraschenderweise steht in der Mitte eine große Figur des Padmasambhava, vor der sich die Opfergaben, bunt gefärbte Kekse, Blumen aus Wachspapier und mit Gerste gefüllte Messingkörbchen häufen. An beiden Seiten des Raumes befinden sich Regale mit alten Schriftrollen oder »Büchern« und mehreren zusammengerollten Thangkas (die vermutlich in noch schlechterem Zustand sind als die ziemlich zerschlissenen Thangkas an der Wand). Die Wände sind mit Fresko-Bildern und religiösen Darstellungen bemalt, in den Ecken häufen sich alte Kostbarkeiten, die vor Staub im Dunkeln kaum zu erkennen sind. Der Lama entzündet Räucherwerk und öffnet eine kleine Truhe. Er entnimmt daraus einige kleine, geweihte Kuchen, die er uns schweigend, mit einem Lächeln, darbietet.
Die letzten zwei Wochen hatten wir Tag für Tag klares, warmes Wetter, heute morgen jedoch künden Wolkenfahnen einen Wetterumschwung an. Eine Stunde nach Sonnenaufgang stehen Sonne und Mond in genau gleicher Höhe einander im Osten und Westen gegenüber. Die Temperatur beträgt minus elf Grad, der Wind von den Bergen über Somdo ist scharf und beißend, und die Eidechsen haben sich in ihre Erdlöcher verkrochen.
Den ganzen Tag über verfolge ich eine Herde, zu der sich in den letzten Tagen die Böcke von neulich gesellt haben. Die Herde grast dicht unterhalb der Schneegrenze östlich von Shey am Hang des Somdo-Berges, dessen Gipfel um die 5100 Meter hoch sein dürfte. Ich klettere im erprobten Zickzackkurs den Berg hinauf, immer wieder anhaltend und mich bückend, damit die 232Schafe mich für einen harmlosen Dungsucher halten, wie es die anderen Homo sapiens sind, die sie kennen. Als ich die Schneegrenze erreiche, beginnen sie gerade, sich hinzulegen. Nach dieser Pause fressen die Blauschafe im allgemeinen am späten Vormittag weiter, halten dann ausgiebig Mittagsruhe und grasen dann weiter bis Sonnenuntergang. Ich mache es mir auf einer kleinen Bergkuppe bequem, von der aus ich sie im Auge behalten kann.
Kurz nach zehn Uhr beginnen die Tiere wieder zu grasen und zeigen dabei auffälliges Interesse für ihre Nachbarn. Obwohl hin und wieder auch zwei Weibchen einander jagen, sind vor allem die Böcke aktiv, sie besteigen einander, reiben sich derb und stoßen sich gegenseitig, wobei man eine gewisse »Partnerwahl« feststellen kann, wenn man eine Gruppe lange genug beobachtet: die Böcke, die aneinander ihre Kräfte messen, grasen und ruhen auch nebeneinander, wobei jedes »Paar« sich in bezug auf die Größe der Hörner, die Ausprägung der dunklen Fellmarkierungen und den sozialen Rang innerhalb der Gruppe sehr ähnelt; fast nie kommen derartige Annäherungen und Vorgeplänkel unter sehr verschiedenen Tieren vor.
Unterdessen sind mir ein paar Tiere so nahe gekommen, daß ich ihre orangefarbenen Augen und das hübsche Muster der gewundenen Hörner betrachten kann. Es entgeht mir auch nichts von den sonderbaren Aktivitäten, die sich auf die Hinterteile beider Geschlechter konzentrieren. In diesem frühen Stadium der Brunft zeigen sich die umworbenen Tiere nicht sonderlich beeindruckt von ihren Verehrern, die sich an ihnen reiben und ihr Urin untersuchen. Die Jährlinge springen beiseite, um den aufgeregten erwachsenen Böcken nur ja aus dem Weg zu gehen. Noch gibt es keine richtigen Kämpfe oder Anzeichen jenes eindeutig sexuellen Verhaltens, das bei den westlichen Herden schon begonnen hat. Nur hin und wieder verfolgt ein Bock ein weibliches Tier mit gesenktem, weit vorgestrecktem Kopf, ein Vorspiel der Kopulation, das GS »Tiefstrecken« nennt. Die Somdo-Herde hat sich mittlerweile so an mich gewöhnt, daß ich sie aus unmittelbarer Nähe ohne Fernglas beobachten kann; ein Jammer, daß ich von hier fort muß, ehe die Brunft in vollem Gang ist.
233
Gegen Mittag kommt kalter Wind aus Südosten auf, der sich hier auf dem Hang ziemlich unangenehm bemerkbar macht. Ich stehe auf und treibe die Herde sacht vor mir her zu einer Terrasse weiter westlich, wo sich die Tiere zum Wiederkäuen hinlegen, während ich mich an meinen Rucksack gelehnt in einer Mulde unter dichtem Geißblattgebüsch ausstrecke. Tief unter mir liegt das Kristall-Kloster, von seinen Hausbergen umgeben. Und während die Schafe in der Sonne dösend wiederkauen, kaue ich an trockenem Brot und genieße mein wunderbares Eintauchen in reines Schafstum.
Am Spätnachmittag versuche ich, die Schafe weiter hangabwärts zu treiben, wo GS sie auf dem Rückweg von Tsakang beobachten kann, ohne nochmals viel steigen zu müssen. Aber die alte Sonam kommt mir mit ihrem Dungsack in die Quere und verscheucht die Herde wieder nach Osten. Jetzt sind die Tiere unruhig geworden und machen Anstalten zur Flucht, so daß ich mich nun doch sehr vorsichtig wieder anschleichen muß. Ich schlage einen Haken um die Herde herum und robbe dann hinter einem Bergrücken bis auf fünfzig Meter an den Vorsprung heran, auf dem die Tiere in Hab-Acht-Stellung stehen und in der falschen Richtung Ausschau halten. Hin und wieder dreht sich ein Kopf in meine Richtung, aber die Tiere scheinen mich nicht zu bemerken – ich liege regungslos, ihre Körper sind so angespannt, daß selbst die schweren Hörner vor Kraft zu bersten scheinen, kein Muskel regt sich. Sie stehen wie Statuen, nur der Wind zaust ihr Fell.
Um sie wieder nach Westen in Gang zu setzen, richte ich mich langsam zu voller Größe auf, und alle drehen sich zu mir um. Aber die widerspenstigen Tiere, die so oft wegen nichts geflüchtet sind, erstaunen mich aufs neue. Als plötzlich unmittelbar über ihnen ein Mann auftaucht, entspannen sie sich und beginnen zu grasen, als hätte sie nur die Ungewißheit darüber, wo ich mich verborgen hielt, in Alarmbereitschaft gehalten. Manche legen sich sogar wieder hin. Durchgefroren und von ihrem ungehörigen Benehmen irritiert, lasse ich alle Hoffnung fahren, noch irgendwelche der Wissenschaft unbekannten Ziegen-Extravaganzen zu beobachten und scheuche die Tiere unsanft auf das Dorf zu, wo sie sich nicht weit von den ersten Häusern seitwärts ins Geröll verziehen.
234
Ich steige zum Weg hinab, der bereits im Schatten liegt, während die Blauschafe, kaum dreißig Meter über und hinter mir, noch in der vollen Sonne stehen. Und jetzt, bei sinkender Sonne, liefern die Schafe mir das Schauspiel, auf das ich den ganzen Tag gewartet habe. Die alten Böcke springen von ihren Felsen herab und fordern einen Gegner zum Kampf heraus, die jüngeren Böcke tun dasselbe gegenüber den Weibchen und Jungtieren und jagen sie davon, und sogar Weibchen untereinander beginnen, sich mit dem Gehörn zu rammen. Im Gegensatz zu den echten Schafen, die sich mit dem Kopf voran geradewegs auf den Gegner stürzen, bäumen die Blauschafe sich auf, laufen einige Schritte auf den Hinterbeinen und lassen sich dann zu einem krachenden Zusammenprall nach vorne fallen, genau wie die echten Ziegen: Hier ist der Beweis, für den GS den ganzen langen Weg zurückgelegt hat. Die ganze Herde aus einunddreißig Tieren ist in die Rauferei verwickelt. Auch in ihren raschen Sprüngen von Fels zu Fels zeigt sich unverkennbar ihre Ziegennatur. Ein großer Stein löst sich und fällt mit dumpfem Gepolter den Hang hinab. Die Herde erstarrt.
Goldäugige, gehörnte Köpfe sehen mich aus dem blauen Himmel an, während der Stein dicht vor meinen Füßen zur Ruhe kommt.
Die Bharals betrachten mich mit gelassenem Blick.
Hast du uns jetzt gesehen? Hast du uns erkannt?
Der Schatten wandert den Hang hinauf, aber immer noch stehen die schönen Geschöpfe regungslos wie Standbilder.
Rasch gehe ich zurück zum Kloster und will GS sagen, er könne seine Pseudois studieren, wenn er bloß den Kopf zur Zeltklappe heraussteckte. Aber ich finde nur eine Botschaft vor, die besagt, daß er diese Nacht in der Hoffnung, einen Schneeleoparden fotografieren zu können, am anderen Ufer nahe dem Weg nach Tsakang verbringen will; bei einem so scheuen Tier wie dem Schneeleoparden seien zwei Beobachter zuviel.
Wenn alle anderen Versuche fehlschlagen, will GS Jang-bu nach Saldang schicken, um eine alte Ziege als Köder für den Leoparden zu kaufen. Auch ich möchte allzu gern den Schneeleoparden sehen, jedoch bei Nacht, im Blitzlicht der Kamera einen Blick auf ihn zu erhaschen, wie er über einem Köder kauert – 235das heißt nicht, ihn zu sehen. Sollte sich der Schneeleopard von selbst manifestieren, dann bin ich bereit, den Schneeleoparden zu sehen. Wenn nicht, dann bin ich (und ich habe diesen Instinkt bis heute nicht recht verstanden) einfach nicht so weit, ihn zu erkennen, so wie ich nicht bereit bin, mein Koan zu lösen – und so, wie es ist, bin ich zufrieden. Ich sage mir, eigentlich müßte ich ja enttäuscht sein, nach dieser langen Reise, aber so empfinde ich nicht. Ich bin enttäuscht und gleichzeitig bin ich nicht enttäuscht. Daß der Schneeleopard ist, daß er hier ist und daß seine frostigen Augen uns von den Bergen herab beobachten – das ist genug.
Beim Abendessen versuchen mich die gutgelaunten Sherpa in ihr Gespräch einzubeziehen, aber bald ziehe ich mich mit meinen Notizen zurück, so daß sie sich ungezwungen miteinander unterhalten können. Meist bedeutet das, daß sie Tukten zuhören, der sie stundenlang mit seiner tiefen, weichen Stimme gefangen hält, wobei er seine Guru-Hände in einer hypnotisierenden Geste über das Feuer ausstreckt. Ich beobachte gern unseren unheimlichen Mönch mit den gelben Mongolenaugen und den wachsamen Ohren, und nur selten, wenn ich aufblicke, ihn zu betrachten, ruht sein Blick nicht auf mir. Einmal werde ich diesen Tukten fragen, ob er in einem früheren Leben nicht ein Schneeleopard oder Blauschaf auf den Hängen über Shey gewesen ist, er wäre sicher nicht um eine Antwort verlegen. Während des Essens sieht er mich mit seinem Bodhisattva-Lächeln an, einem Ausdruck, mit dem er gleichmütig auf Vergewaltigung wie Wiederauferstehung herabblicken würde – dies ist der Blick, den er mit den wilden Tieren gemein hat.
Wieder einmal klettere ich am Westufer des Schwarzen Flusses aus dem dunklen Canyon der Sonne entgegen. Im flechtenbehangenen Wacholder rührt sich ein kleiner Vogel, eine tibetische Grasmücke mit blaugrauem Gefieder und rötlicher Kappe.
Im hellen Morgenlicht sind frische Leopardenabdrücke sichtbar, wie Blütenblätter auf den Weg gestreut, aber sie hören etwa zweihundert Meter vor dem Stolperdraht der Kamera auf, so 236plötzlich, daß es scheint, als sei die Katze mit einem Satz seitwärts ins Wacholdergebüsch gesprungen. Eine Spur näher am Stolperdraht stammt vom Vortag. Hinter dem nächsten Bergvorsprung sind die Spuren wieder da, so als sei der Leopard quer über den Bergkamm gestiegen, um den Stolperdraht zu umgehen.
Von Tsakang tönt der durchdringende Laut einer Damaru oder Gebetstrommel herab, die manchmal aus zwei menschlichen Schädelschalen angefertigt ist. Zusammen mit der Kang-ling-Trompete aus einem menschlichen Schenkelknochen dient sie im Tantrismus dazu, den Meditationszustand zu vertiefen, nicht indem sie morbide Gedanken befördert, sondern weil sie daran erinnert, daß unsere Zeit auf Erden dahinfliegt. Oder ist es nur der Laut von Wassertropfen, die in der Höhle bei Tsakang in ein Kupfergefäß fallen, genau kann ich es nicht sagen. Aber der ungewohnte Ton läßt die wilde Landschaft aufhorchen: Irgendwo hier am Berghang horcht auch der Schneeleopard.
Auf dem Kamm hoch über Tsakang sehe ich den blauen Anorak von GS, in der nächsten Stunde habe ich ihn eingeholt. »Er hat mich zum Narren gehalten«, ruft er mir statt einem Gruß zu, »kam genau auf dem Pfad auf mich zu, ist dann über den Vorsprung gestiegen und an die hundert Meter hinter mir wieder hinunter, typisch.« Er hebt das Fernglas zu der Blauschafherde über Tsakang, zu der sich jetzt die kleine Herde vom Westhang gesellt hat. »Ich habe seine Spur verloren, aber ich bin sicher, daß der Leopard jetzt ganz in unserer Nähe kauert und uns beobachtet.« Er unterbricht sich, denn die Blauschafe bestätigen seine Worte: Sie fliehen mit großen, langen Sätzen über Felsen und Gebüsch, brechen tief in die Firnkruste alter Schneezungen ein und halten nicht an, bis sie hoch oben am Kristall-Berg angelangt sind. Blauschafe fliehen nicht so vor einem Menschen, auch nicht, wenn er sie aufscheucht.
Wir spüren die Gegenwart des Schneeleoparden, mit seinen senkrechten Pupillen und verhaltenen Atemzügen ist er vielleicht nur einen Steinwurf entfernt. GS murmelt: »Solange er sich nicht bewegt, ist er nicht einmal im Schnee zu erkennen, diese Geschöpfe sind wirklich unglaublich.« Mit unseren Ferngläsern suchen wir jeden Fußbreit des Hanges ab. »Weißt du was?« sagt 237GS. »Wir haben hier so viel gesehen, vielleicht ist es besser, es gibt ein paar Dinge, die wir nicht zu Gesicht bekommen.« Er scheint von seinen eigenen Worten überrascht, und ich frage mich, ob er sie so gemeint hat, wie ich sie verstehe: Vielleicht bleibt uns die Trostlosigkeit des Erfolges erspart, der Zweifel: Ist das nun wirklich, weshalb wir so weit gereist sind?
»Jetzt hat der Haiku-Dichter gesprochen«, sage ich. GS weiß sofort, was ich damit meine, und wir lachen beide auf. GS erscheint mir weit weniger dogmatisch und dem Unerklärlichen gegenüber aufgeschlossener als noch vor zwei Monaten. In Katmandu wäre ihm das Haiku verdächtig gewesen, das er später auf der Reise selbst geschrieben hat:
Wolken-Männer unter Lasten.
Eine dunkle Spur im Schnee.
Mit einemmal: nichts.
Da seine Schafe, vom Leopard erschreckt, auf die hohen Schneefelder entflohen sind, begleitet mich GS begleitet mich GS bei meinem letzten Besuch in Tsakang. Wir treffen dort Jang-bu, den ich als Dolmetscher hinbestellt habe, und Tukten, der als einziger der Sherpa neugierig genug ist, um aus eigenem Antrieb nach Tsakang hinaufzusteigen. »Nicht einmal dieser fröhliche und liebenswürdige Bursche«, sagte GS einmal über Phu-Tsering, »interessiert sich im mindesten für meine Arbeit; er kann zwei Stunden lang hinter mir stehen, während ich mich umschaue und Notizen mache, und nicht eine einzige Frage stellen.«
Wieder läßt uns der Lama von Shey warten, aber diesmal – denn wir sind eingeladen worden – hält der Mönchsanwärter Takla getrockneten grünen Yakkäse für uns bereit sowie Tsampa und gebutterten Tee, So-cha genannt, den er uns in blauen Porzellantassen serviert. Der scharfe grüne Käse und der bittere, mit Salz und ranziger Yakbutter gewürzte Tee verleihen dem Tsampa Geschmack, so daß uns die Einsiedlermahlzeit hier oben in der Kälte ausgezeichnet schmeckt.
Takla legt rotgestreifte Teppiche aus, auf die wir uns setzen. Bald erscheint auch der Lama, in sein Wolfsfell eingehüllt. Jang-bu ist verlegen in der Gegenwart des Lama, während Tukten 238ruhig und entspannt wie immer dreinschaut, aber dennoch eine gewisse Ehrfurcht bezeugt, denn zum erstenmal seit ich ihn kenne, nimmt er seine schmierige Kappe ab und entblößt eine inzwischen nachgewachsene Mönchs-Tonsur. Tukten übernimmt auch den Löwenanteil des Übersetzens, während wir dem Lama Bilder aus unseren Büchern zeigen und uns mehrere Stunden lang angeregt mit ihm unterhalten. Lama Tupjuk erkundigt sich nach tibetischen Lamas in Amerika, und ich erzähle ihm von Chögyam Trungpa Rimpotsche (Rimpotsche bedeutet der »Kostbare« und ist der Titel eines hohen Lamas). Dieser Lama seiner eigenen Karmapa-Sekte hat Tibet im Alter von dreizehn Jahren verlassen und lehrt jetzt in Vermont und Colorado. Für GS wiederholt der Lama, was er mir über den Schneeleoparden und die Argalis erzählt hat, und zeigt dabei über den Schwarzen Fluß auf die Hänge von Somdo.
Am Kristall-Berg haben inzwischen die geflüchteten Schafe mit erhobenem Gehörn und ruhigen Flanken den Abstieg begonnen, wie wir durch das Glas erkennen. Der Leopard ist fort, vielleicht haben sie ihn abziehen gesehen. Hin und wieder steigt ein Bock auf die Hinterbeine hoch, als würde er vor Freude im Schnee tanzen, und läßt sich dann nach vorne fallen, um mit seinen Hörnern auf die eines Rivalen zu krachen.
Der Schnee unter der hochstehenden Sonne scheint in Wellen zu fließen und erfüllt unseren Geist mit demantenem Licht. Tupjuk Rimpotsche erzählt nun vom Schneeleoparden, den er häufig und, nach seinen genauen Angaben zu schließen, sehr aufmerksam beobachtet hat; er weiß, daß er am häufigsten zur Zeit der Paarung schreit, im Frühjahr, welche Höhlen und Bergsimse er bevorzugt, wie er seine Kratzspuren hinterläßt und seinen Kot absetzt.
Ehe wir gehen, zeige ich ihm den Pflaumenkern mit der Inschrift des Tschenrezigs gewidmeten Sutra, den mir Soen Roshi gegeben hat, und verspreche dem Lama, ihm meinen Hocker aus Weidenruten zu schicken, den ich im Teehaus am Yamdi-Fluß erstanden habe. Der Lama schenkt mir eine weiße Gebetsfahne – Lung-p'ar nennt er sie, »Windbilder«. Die Bilder und Schriftzeichen darauf sind mit den alten Holzstöcken von Shey gedruckt. Unter den buddhistischen Symbolen befindet sich auch ein Bild 239von Nurpu Khonday Pung-jun, dem großen Gott der Berge und Flüsse, der, so sagt der Lama, hier lange vor den Bönpos und Buddhisten herrschte. Vielleicht ist er der Gott, den Drutob Senge Yeshe und seine einhundertacht Leoparden besiegten. Jetzt gehört Nurpu zu den Beschützern des Dharma, und sein Bildnis auf Fahnen wie dieser wird oft auf Brücken und Pässen zum Schutz der Reisenden aufgehängt. Der Lama faltet die Fahne mit großer Konzentration zusammen und überreicht sie mir mit segnendem Lächeln.
Der Lama des Kristall-Klosters ist offensichtlich ein äußerst glücklicher Mensch; trotzdem frage ich mich, wie er wohl zu der Einsamkeit und dem Schweigen von Tsakang steht, das er seit acht Jahren nicht mehr verlassen hat und seiner kranken Beine wegen auch wohl nie wieder verlassen wird. Da Jang-bu sich als Übersetzer nicht wohlzufühlen scheint, bedeute ich ihm, diese Frage nicht zu übersetzen, falls sie ihm ungehörig erscheint; schließlich tut er es doch. Aber der heilige Mann in all seiner spontanen Einfachheit stimmt lauthals ein ansteckendes Gelächter an. Ohne eine Spur von Selbstmitleid oder Bitterkeit zeigt er auf seine verkrüppelten Beine, als gehörten sie uns allen, und breitet dann die Arme zum Himmel und zu den Schneebergen, zur Sonne und zu den tanzenden Schafen aus: »Natürlich bin ich hier glücklich! Es ist wunderbar! Besonders, da ich keine andere Wahl habe!«
In ihrer uneingeschränkten Bejahung dessen, was ist, könnte diese Antwort auch von Soen Roshi stammen. Mir ist, als hätte es mir einen Schlag in die Brust versetzt. Ich danke ihm, verbeuge mich und gehe dann langsam den Berg hinunter, die zusammengefaltete Gebetsfahne unter meinem Anorak glüht wie Kohle. Buttertee und Windbilder, der Kristall-Berg und auf den Schneefeldern tanzende Schafe – es ist übergenug!
Hast du den Schneeleoparden gesehen?
Nein! Ist das nicht wunderbar?
240
Der Mond hängt wie ein Eiszapfen am Himmel, und die Windglocke verklingt ungehört im scharfen Ostwind. Die kleine Braunelle hat den Kälteeinbruch nicht überlebt oder ist nach Süden über die Berge entflohen, denn sie besucht mich morgens nicht mehr. Sogar Namu hat sich eine Decke über den Kopf gelegt, bisher ließ sie die Haare frei im Wind wehen. Die Tage sind merklich kürzer geworden. Immer früher am Nachmittag stößt Namu ihren wilden Ruf aus, mit dem sie ihr schwarzes Dzo heimruft und die Wölfe vertreiben will.
Ich steige zum Nordwest-Grat des Somdo-Berges auf, von wo aus ich alle Hänge und Schluchten im westlichen Flußtal überblicken kann. Falls sich der Leopard drüben aufhält, müßte ich ihn sehen oder zumindest an den Vögeln erkennen, ob und wo er Beute gerissen hat. GS ist frühmorgens auf die Suche nach frischen Spuren gegangen, er möchte sich zwar durch den Leoparden nicht in seiner Arbeit über die Blauschafe stören lassen, aber die Großkatzen haben es ihm angetan und der Schneeleopard ist eines der seltensten Tiere der Familie. Es ist wunderbar, wie die Gegenwart dieser Kreatur die gesamte Landschaft in einen Punkt konzentriert, sei es ein Lichtschimmer auf dem alten Gehörn eines Schafes oder das Klirren eines Kiesels auf dem hartgefrorenen Boden.
Da es zu kalt zum Stillsitzen ist, gehe ich auf der Gratkante auf und ab, immer wieder die Westhänge mit dem Fernglas absuchend. Dabei behalte ich auch die Somdo-Herde im Auge, die mit der Brunft etwas später dran ist als die Blauschaf-Herde bei Tsakang. Auf diesem Hang gibt es viele Fossilien im Gestein, meist spiralige Ammoniten, und im Fluß liegen bizarr geformte Steine von großer Schönheit. Ich liebe solche natürlichen Steine, möchte sie gerne mitnehmen, aber sie sind zu schwer, als daß wir sie über die Pässe schleppen könnten. Aber einige Scherben von Gebetssteinen werde ich einstecken, die Flußsteine müssen bleiben, wo sie hingehören.
Mit dem Wind und der Kälte ist auch meine Unruhe wiedergekommen. Ich ertappe mich dabei, daß ich mit meiner letzten Schokolade knausere, um auf dem Rückweg über die Berge noch 241welche zu haben – dieses ewige Sich-auf-das-Leben-Vorbereiten, anstatt es Tag für Tag zu leben! Meine Ruhelosigkeit wird durch die Anwesenheit der zusätzlichen Sherpa noch verstärkt, die wenig mehr zu tun haben, als unsere kostbaren Nahrungsmittel aufzubrauchen. Sie schlafen, sitzen herum, warten auf den Aufbruch. Wie Sendboten der Außenwelt sind Tukten und Gyaltsen bei Vollmond eingetroffen. Nun hat der Mond schon deutlich abgenommen, und die klare Wachheit der Vollmondtage in Shey schwindet rasch dahin. Es gab aufregende Tage seit ihrer Rückkehr, aber jetzt scheint eine vorher spürbare Kraft abzunehmen, ein Bann ist gebrochen.
Und so bereite auch ich mich darauf vor, diesen Ort zu verlassen, obwohl ich andererseits so gerne bleiben würde. Der Teil von mir, der sich fragt, was wohl in den ungeöffneten Briefen stehen mag, der sich nach meinen Kindern sehnt, der Wein trinken und lieben will, der wieder sauber und gepflegt sein möchte, schaut längst nach Süden über die Berge. Das stimmt mich traurig, und traurig schaue ich mich um, um so viel wie möglich von Shey in diesem Tagebuch festzuhalten, wohl wissend, daß alle solche Mühe vergebens ist. Diesen schönen Ort muß man fröhlich verlassen, wie das helle Wasser der Flüsse über die Klippen dahineilt. Immer wieder treibt mich meine Frustration über die Armseligkeit der Wörter zum Schreiben, obwohl mehr von Shey in einem einzigen Schafshaar oder in einem vertrockneten Zweig Immergrün enthalten ist, als in all diesen Notizen. Festhalten zu wollen, was ich glaube wahrgenommen zu haben, heißt das Wesen von Shey zu verpassen.
In der Nähe meines Ausgucks entdecke ich eine windgeschützte Nische zum Meditieren. Bald klärt sich mein Kopf in der kalten Bergluft, und ich fühle mich wieder besser. Wind, wehendes Gras, Sonne: Der Fels selbst ist nicht weniger vergänglich als das sterbende Gras, der Schrei der nach Süden ziehenden Vögel, nicht weniger und nicht mehr – alles ist dasselbe. Der Berg zieht sich in seine Stille zurück, mein Körper geht auf ins Sonnenlicht, Tränen fallen, die nichts mit einem »Ich« zu tun haben. Was sie hervorruft – ich weiß es nicht.
Früher verstand ich Berge anders, ich sah sie als etwas Dauerndes. Auch wenn ich mich ihnen respektvoll näherte (sie wie 242die Bergsteiger bezwingen zu wollen, ist eine andere Sache), erschreckten sie mich durch ihre »Unvergänglichkeit«, durch ihr fürchterliches, »felsenfestes« Beharren, das mir meine eigene Vergänglichkeit erst so recht vor Augen führte. Vielleicht erklärt diese Furcht vor dem Vergehen unsere Gier nach den wenigen intensiven Erfahrungen des modernen Lebens, erklärt, warum Gewalt uns Wollust verschafft, warum Lust uns vernichtet, warum alte Soldaten ihre schrecklichen Kriegserinnerungen nicht vergessen wollen: Wir klammern uns an die extremen Augenblicke, in denen wir zu sterben scheinen, aber wiedergeboren werden. In Gefahr und in der sexuellen Hingabe sind wir, wenn auch nur kurz, ganz der lebendigen Gegenwart anheimgegeben, wir sind Leben, unser Sein erfüllt uns; in der Ekstase mit einem anderen Wesen fällt die Einsamkeit von uns ab. Zu anderen Zeiten war solche Einswerdung durch einfache Ehrfurcht erreichbar.
Auf einem steilen Grat rutscht mein Fuß ab; in dem Sekundenbruchteil, in dem die Nadeln der Angst mir Herz und Schläfen durchbohren, dringt Ewigkeit in die Gegenwart ein. Denken und Tun unterscheiden sich nicht, Steine, Luft, Eis, Sonne, Angst und mein Ich sind eins. Worauf es ankommt, ist, diese geschärfte Wachheit in ganz gewöhnliche Momente hinüberzuretten. Augenblick für Augenblick zu erfahren, so wie Lämmergeier und Wolf, die sich selbst im Zentrum der Dinge finden und deshalb kein Bedürfnis haben, irgendein »Geheimnis des wahren Seins« zu ergründen. In dem Atemzug, den wir in diesem Augenblick tun, liegt das ganze Geheimnis, zu dem alle großen Lehrer uns führen wollen oder wie ein Lama sagte, »die Präzision, Offenheit und Intelligenz des Gegenwärtigen«.[81] Das Ziel der Meditationspraxis ist nicht die Erleuchtung, sondern die Fähigkeit, zu jeder Zeit nur der Gegenwart und nichts außer der Gegenwart Beachtung zu schenken, die Bewußtheit des Jetzt in jedem Moment des Alltagslebens zu bewahren. In Gedanken irgendwo anders zu sein, heißt »Augäpfel auf das Chaos zu malen«.[82] Wenn ich Blauschafe beobachte, muß ich auf die Blauschafe achten und darf nicht über Sex, Gefahr oder die Gegenwart nachdenken, denn diese Gegenwart ist, während ich noch daran denke, bereits vergangen.
243
Der Schneeleopard war heute nacht auf der Jagd, denn ein Teil der Tsakang-Herde ist nach Norden in den Hof von Dölma-jang geflohen, der Rest ist über die Bergkämme nach Westen entkommen. Von Somdo aus sieht man die kalligraphischen Spuren am Berghang hoch oben am Rand verschwinden. Nachdem er die Tsakang-Herde zerstreut hatte, ist der Leopard offenbar über den Schwarzen Fluß herübergekommen – oder es ist ein zweiter Leopard aufgetaucht -, denn die große Herde über Somdo hat sich ebenfalls geteilt, und die Böcke und Weibchen grasen wieder getrennt. Als wir den Berg über Somdo hinaufsteigen, ist nur eine einsame Gruppe von neun Böcken zu sehen.
Kaum dreihundert Meter über unseren Zelten, auf demselben Weg, den ich gestern gegangen bin, hat ein Leopard seine Kratzspuren genau über meine Stiefelabdrücke gesetzt, als wolle er mir bedeuten, daß ich nicht aufbrechen darf. Vielleicht ist das Tier noch in der Nähe, denn die Böcke sind sehr scheu. Aber die Brunft steht nun unmittelbar bevor und die Anzeichen dafür sind nicht mehr zu übersehen. GS kritzelt in sein Notizbuch: »Da, wieder ein Penis-Lecken, ein Prachtexemplar!« ruft er begeistert. Das Onanieren geht stellenweise in Kämpfe über, besonders unter den älteren Böcken, die sich immer wieder auf die Hinterbeine stellen. Und mit erstaunlicher Präzision steigt im selben Moment ein anderer Bock hoch, und die beiden rennen wie trainierte Partner aufeinander zu und kommen mit zusammenkrachenden Köpfen herunter. Für andere Tiere hätte ein solcher Zusammenstoß fatale Folgen, aber die Bharals sind mit einem rund zwei Zoll dicken Schädelbein zwischen den Hörnern ausgerüstet und haben ein dickes, schwammiges Knochenkissen über den Stirnhöhlen, dazu ein dichtes Wollfell auf dem Kopf und einen starken Nacken, der den Stoß auffangen kann. Auch die Hörner selbst sind an der Aufprallseite sehr dick und stark. Weshalb die Natur Jahrtausende zu einer natürlichen Auslese verwandt hat, die den Gebrauch eines dicken Rammschädels über den des Gehirns stellt, mag eine gute Frage sein; allerdings habe ich in diesen Tagen oft das Gefühl, daß weniger Nachdenken und ein herzhafter Kopfsprung gerade das richtige sein könnten.
244
Es ist ein Vergnügen, die Blauschafe in der Sonne und Windstille zu beobachten, ein Vergnügen, welches uns in Erinnerung ruft, daß es bald ein Ende haben wird. Wir besprechen kurz unser weiteres Vorgehen, unsere bisherigen Ergebnisse und unser großes Glück bei allem, was uns begegnet ist. Gestern abend sagte GS während des Essens, es sei eine der besten Reisen, die er je gemacht habe: »Anstrengend genug, um uns das Gefühl zu geben, wir hätten wirklich etwas geleistet, aber nicht so anstrengend, daß es uns fertiggemacht hätte.« Ich bin derselben Ansicht.
Heute morgen gibt GS seiner Erleichterung darüber Ausdruck, daß wir so viele Daten sammeln und einen so guten Einblick in das Leben der Blauschafe gewinnen konnten. Dabei kommt er wieder auf seine Angst zu sprechen, zu versagen oder seinen Kollegen Gelegenheit zu geben, ihm einen großen Fehler nachweisen zu können. Nach zwei Monaten meine ich, ihn gut genug zu kennen, um ihn darauf aufmerksam machen zu dürfen, wie oft dieser Refrain in seinen Äußerungen auftaucht und wie grundlos diese Angst ist: Auch wenn er ohne Ergebnis von einer Expedition heimkäme, wären seine Fähigkeiten und sein guter Ruf über jeden Zweifel erhaben. GS gibt seine leichte Paranoia zu und spricht offen darüber, während er mit seinem Glas die Hänge absucht. Mit jedem Tag wird er offener und entspannter. Als ich das bemerke, schaut er zweifelnd drein, und ich erinnere ihn an seine Bemerkung über den Schneeleoparden: »Vielleicht ist es besser, wenn wir ein paar Dinge nicht zu sehen bekommen.« Er knurrt zustimmend, weist aber später die in Tsakang mehrmals geäußerte Beobachtung von sich, daß sich die Berge bewegten. »Na ja, von einem bestimmten Standpunkt aus, einem geologischen natürlich, könnte man das sagen«, brummelt er. »Man weiß, daß der Himalaja sich immer noch hebt, und die Abwärtsbewegung erfolgt durch Erosion …« Ich schneide ihm das Wort ab: »So hast du das nicht gemeint. Jedenfalls nicht in Tsakang.« Angestrengt in sein Teleskop starrend, kann er ein Grinsen nicht unterdrücken.
Nach der Meinung von GS ist unsere Reise ein echtes Abenteuer, da wir völlig auf uns selbst gestellt sind; eine Expedition des guten alten Stils, da wir von jedem Kontakt mit der modernen Außenwelt völlig abgeschnitten sind, ohne Radio, ohne Arzt, 245ohne Fahrzeuge, von Fallschirmabwürfen und Versorgungsmannschaften ganz zu schweigen. »Das ist eine Expedition, wie ich sie mag«, sagt GS. »Man nimmt nicht ständig die ganze verdammte Gesellschaft für die eigene Sicherheit in Anspruch, man muß die Verantwortung für seine Fehler selbst tragen und kann keine ›Organisation‹ dafür verantwortlich machen – und, da man unweigerlich Fehler macht, kann man dabei nur hoffen, daß sie nicht zu schwer wiegen.« Auch mir macht unser Unternehmen Spaß, aus den gleichen Gründen und weil die Tatsache, daß jedem Fehler hier die Strafe auf dem Fuß folgt, mich besonders achtsam gemacht hat, als ich hier in den Bergen herumgeklettert bin.
Später am Vormittag, als die Schafe sich hingelegt haben, überqueren wir einen langen Osthang und wenden uns dann wieder nach Westen in der Hoffnung, den Leoparden irgendwo aus seinem Versteck aufzuscheuchen. Die wenigen Spuren sind auf dem steinigen Boden nicht deutlich genug zu erkennen, um ausmachen zu können, wo sich das Tier jetzt befindet. Wenn es die Katze von Tsakang ist, muß sie sehr hungrig sein. Es wäre also gut möglich, daß sie diese Nacht Beute macht; sie würde dann nah genug bei ihrem Opfer bleiben, um es gegen die Raubvögel zu verteidigen: Das wäre meine letzte Chance, den Schneeleoparden doch noch zu sehen.
Da die Herden sich wieder nach Geschlechtern getrennt haben, dürfte der Höhepunkt der Brunft kaum innerhalb der nächsten vierzehn Tage eintreten, und wenn der Leopard fort ist, kommt er nicht vor einer Woche zurück. So bleibt es denn dabei, übermorgen verlasse ich Shey mit Tukten, dem ich aufgetragen habe, einige Vorräte und die nötigsten Utensilien von Phu-Tsering zu erbitten. Viel können wir nicht mitnehmen, denn die Vorräte werden knapp, und vermutlich können wir in Saldang etwas Tsampa oder Kartoffeln kaufen.
GS, der meint, daß ich Tuktens spirituelle Fähigkeiten überschätze, erinnert mich, wie auch Jang-bu, mich vor ihm in acht zu nehmen. Vielleicht hat er recht. Trotzdem freue ich mich über Tuktens Begleitung, denn er ist der einzige der Sherpa außer Jang-bu, der Probleme voraussieht und danach handelt, ohne daß man ihn gebeten hat. Und da Gyaltsen keine Lust hat, nochmals 246mit Tukten zu reisen, und lieber bei Jang-bu in Shey bleiben will, wird uns Dawa an seiner Stelle begleiten. Seitdem ihn zweimal die Schneeblindheit ereilt hat, war er gedrückter Stimmung; er scheint seither am glücklichsten zu sein, wenn er mit sich allein ist; ich höre ihn singen, wenn er zum Fluß hinuntergeht, um Wasser zu holen. Aber er setzt sich selten zu den anderen Sherpa ans Feuer, kauert lieber in einer dunklen Ecke an der Wand. Obwohl die anderen ihn mögen, ziehen sie ihn auf und kommandieren ihn herum, was er mit einem scheuen Lächeln quittiert, so als sei er dankbar, daß sie ihn nicht ganz ignorieren.
In der vorigen Nacht hat der Leopard seine Spuren auf dem Weg nach Saldang hinterlassen, den ich morgen einschlagen werde. So man will, kann man auch dies als Zeichen deuten, wie gestern seine Kratzspuren über meinem Stiefelabdruck. Danach ist die Katze entweder zur anderen Flußseite übergewechselt oder es sind doch zwei Leoparden da, wie wir vermutet haben, denn auch auf dem Pfad nach Tsakang finden sich frische Spuren, dazu eine einsame Wolfsfährte, vielleicht ist der Einzelgänger, der vorige Woche die Gebetsmauer umkreiste, wiedergekommen. Die Sonne steigt über den eisigen Horizont. Heute, an meinem letzten Tag in Shey, klettern wir nochmals zusammen auf die Westhänge über dem Fluß in der Hoffnung, eine vom Leoparden gerissene Beute zu finden. Ein Teil der großen Herde ist zurückgekommen, um vorsichtig oberhalb von Tsakang zu grasen, eine kleinere Gruppe Blauschafe klettert auf den steilen Felsvorsprüngen unterhalb der Einsiedelei herum, aber viele Tiere fehlen. Nur einmal haben wir die Tiere auf den Klippen unterhalb von Tsakang gesehen, nämlich als sie von den Wölfen dorthin gejagt wurden, doch scheinen sie diesmal aus eigenem Antrieb gekommen zu sein, denn einige lecken an den salzigen Eiszapfen in einer kleinen Höhle, während andere an den verkrüppelten Berberitzen in den Felsspalten knabbern.
Obwohl ein junger Bock zaghaft ein weibliches Tier zu besteigen versucht, ist nun klar, daß die Weibchen nicht vor Anfang 247Dezember voll in den Östrus kommen, womit der Höhepunkt der Brunft eintritt. Nach den vielen Wochen Herumgebalge und Vorspiel werden nur wenige dominante Männchen die Kopulation durchführen, die jedesmal nur wenige Sekunden dauert.
Das bisher gesammelte Material hat GS davon überzeugt, daß die Bharals tatsächlich weder Schafe noch Ziegen sind, sondern ihrer schon vor zwanzig Millionen Jahren lebenden gemeinsamen Urform sehr ähnlich sind, aus der sich die Gattungen Ovis und Capra entwickelten. (»Die Verhaltensweise«, schrieb GS später, »bestätigt die morphologischen Hinweise, daß die Bharals den Ziegen zuzuordnen sind. Viele schafartige Eigenschaften des Bharal kann man der konvergenten Evolution zuschreiben als Ergebnis der Tatsache, daß die Spezies ein Habitat besiedelt, das gewöhnlich von Schafen besetzt ist … Die Spezies ist gewissermaßen evolutionär nicht festgelegt, vor die Wahl gestellt, sich entweder als Ovis oder als Capra zu entwickeln, wäre dies in beiden Fällen ohne große Änderungen möglich. Ähnlich dem Mähnenschaf hat sich das Bharal vermutlich sehr früh vom Stammbaum der Urziegen getrennt. Wenn ich eine hypothetische Urform konstruieren müßte, von der aus sich die Entwicklungslinien der Ziegen und Schafe trennen, so würde diese in Erscheinung und Verhalten vielfach den Bharals ähneln.«[83]
Während GS weiterhin der Herde entlang der Schneegrenze folgt, kehre ich um, da ich noch einmal die vertrauten Stätten besuchen will. Die kleinen Stupas an den Bergvorsprüngen sind mit feuerfarbenen Flechten bewachsen; die alten, gemeißelten Gebetssteine, die Leopardenfährte und der schwere Wacholdergeruch machen mir den Abschied schwer. Noch einmal schaue ich nach Tsakang hinüber, nach den Klüften und tiefen Schatten des Schwarzen Canyon und dem dunklen Berg, der über Samling aufragt, das ich nie sehen werde. Im Westen ragen die kahlen Felsen des Kristall-Berges über den Schneefeldern zum Himmel, von Süden her windet sich der dunkle Bergbach vom Kang-La herab. Und vor mir auf den niedrigen Felskuppen über dem Fluß, sich mit seiner Silhouette scharf gegen den Schnee im Hintergrund abhebend, liegt das Dorf, das von seinen Bewohnern Somdo genannt wird, und läßt seine weißen Gebetsfahnen im Wind flattern.
248
Das Wintereis hat die Gebetsmühlen auf den Inseln im Fluß verstummen lassen, aber unter der Brücke gurgelt und strudelt noch das graue Wasser nach Westen zum großen Karnali. Zum letztenmal bezeuge ich den weißen Stupas meine Verehrung und verbeuge mich vor dem hellblauen Dorje-Chang. Ich würde gern hineingehen und die Gebetszylinder mit einem Stoß in Bewegung setzen, damit sie ihr om mani padme hum in alle zehn Richtungen senden, aber wie ich sehe, ist der Händler Ongdi zurückgekehrt und hat die Tür verschlossen in der Hoffnung, noch etwas an uns zu verdienen, indem er ein Eintrittsgeld von uns verlangt. Mit Ongdi zusammen ist auch der Eigentümer des Hauses heimgekehrt, in dessen Hof ich mein Zelt aufgeschlagen habe, offenbar will er keine Miete von mir verlangen, er inspiziert nur seine Mauer, legt da und dort einen Gebetsstein zurecht und gibt mir damit zu verstehen, daß ich seine Dunghaufen mit Respekt zu behandeln habe. Der ganze Hof ist voller Dung, wie mir scheint, seit Jahrhunderten angesammelt, mein Zelt steht mitten darin. Trotzdem zeigt der Hausbesitzer auf ein steinartiges Häufchen, hartgefroren in einer Ecke des Hofes, und ich bin in meinem Innersten peinlich berührt, vor allem, da ich ihm nicht erklären kann, daß es zu diesem Ding auf dem Dung nur ein einziges Mal gekommen ist, in einer Situation plötzlicher Bedrängnis in bitterkalter Nacht. Mehr als das, ich bin zutiefst beleidigt, mich packt eine sinnlose Wut: Was zum Teufel hat dieses klägliche Häufchen mit jenen durchscheinenden Geisteszuständen auf den Bergen zu tun?
Im Wind und in der Stille stehen der Fremde und ich Schulter an Schulter und starren vor unsere Füße, als läge dort der Dorje vor uns, der unzerstörbare Diamant, der uns die tantrische Lehre offenbaren könnte: Gib acht, o Pilger, daß du die sogenannten niedrigen körperlichen Funktionen nicht verachtest, denn auch in diesen offenbart sich das Wunder des Seins. Hat nicht einer der großen Meister Erleuchtung erlangt, als er seinen Kot im Wasser aufklatschen hörte? Auch die Transparenz des Geistes, o Pilger, kann ein Hindernis werden, wenn du daran festhältst. Du darfst nicht beim kristallenen Berg verweilen …
249
Genug! Ich bin noch nicht so weit auf dem Pfad vorangekommen, daß ich das Absolute in einem Haufen Kot, vor allem nicht in meinem eigenen, wahrnehme. Scheiße ist Scheiße, würde es im Zen heißen oder vielmehr: Scheiße! Mit einem Fußtritt befördere ich diese Spur meines Vorüberziehens aus dem Hof. Dann bedanke ich mich bei dem Mann für seine Gastfreundschaft und zeige ihm einen Stein, der ein hübsches Fossil enthält. Er versteht nicht, was ich will, macht sich nichts aus meinem Dank und meinen Steinen.
Langsam schreite ich am Feld der Gebetssteine entlang zur niedrigen Tür des Kristall-Klosters. Zu beiden Seiten des Eingangs stehen alte Gebetsmühlen, eine aus Kupfer, die andere aus Holz, und in einer Nische darüber sitzt ein kleiner Buddha, rot und blau bemalt in den Farben von Erde und Himmel. Wenn Tundu heute nachmittag den Schlüssel nicht bringt, werde ich nie durch diese kleine Tür in das Kloster Shey Gompa eintreten. Die Eingangsstupas und die Kapelle des Lama Tupjuk in Tsakang haben mir zwar eine Vorstellung davon gegeben, wie es im Kloster aussehen könnte, und morgen werde ich mit etwas Glück fünf Wegstunden von hier den Tempel zu Namgung besichtigen, ebenfalls ein Heiligtum der Karma-Kargyütpas. Dennoch bin ich sehr enttäuscht, daß ich nach der langen Reise das Innere des Kristall-Klosters nicht sehen kann.
(Kurz nach meiner Abreise brachte Tundus Frau den Schlüssel und forderte hundert Rupien für das Öffnen der Tür; GS ignorierte sie einfach, worauf sie ihn schließlich am letzten Abend für fünf Rupien einließ. Nach den Notizen und dem Grundriß von GS enthält Shey Gompa eine Anzahl schöner Bronze-Buddhas, Hängetrommeln, alte Schwerter und Vorderlader aus der Zeit, in der die Gegend von Banditen heimgesucht wurde, sowie die schweren Druckstöcke, mit denen die »Windbilder« der Gebetsfahnen hergestellt werden. Ansonsten unterscheidet sich das Kloster vor allem durch seine Größe von den anderen der Gegend, von einem bizarren und unvermuteten Detail abgesehen: Auf einem Wandteppich ist neben einem Wolf, tibetischen Wildeseln und einer Eule auch ein weiblicher Yeti abgebildet.
Es wird zwar von Yeti-Bildern in abgelegenen Lamaklöstern 250berichtet, doch sind sie in Wirklichkeit äußerst selten, in Nepal soll es außer diesem Bild nur noch ein einziges im Tengboche-Kloster unterhalb des Mount Everest geben. Daß in einer Gegend, die so weit westlich von jenen Regionen liegt, in denen bisher Yeti gesehen wurden, eine solche Zeichnung existiert, vertieft noch den unheimlichen Eindruck, den der seltsame dunkle Schatten in den Wäldern am Suli Gad auf mich gemacht hat.)
Noch einmal steige ich zu meinem Ausguck hinauf, glücklich und traurig zugleich in dem dumpfen Gefühl, daß diese Berge meine Heimat sind. Aber »nur die Erleuchteten erinnern sich ihrer vielen Geburten und Tode«[84], und mir tut sich kein Einblick in andere Leben auf. Vermutlich habe ich »Heimat« mit Kindheit verwechselt und die Fahnen, wilden Tiere und verschneiten Festungen von Shey mit einem altertümlichen Ort aus vergessenen Märchen, dessen mythische Atmosphäre das Leben in eine andere Dimension entrückte.
In der Sehnsucht, die uns dazu treibt, uns auf den geistigen Weg zu machen, ist auch eine Art Heimweh, und irgendwie habe ich mich auf dieser Reise auf den Weg nach Hause gemacht. Die Heimkehr ist das Ziel meiner Übungen, meiner Meditationen auf dem Berg und meiner morgendlichen Rezitationen. Auch bei meiner Koan-Praxis geht es darum: Alle Gipfel sind mit Schnee bedeckt, warum ist dieser eine nackt? Diese alogische Frage zu lösen, würde heißen, aufzuplatzen, alle vorgefaßten Meinungen und alle Stützen fallenzulassen. Aber ich bin noch nicht bereit dazu, loszulassen, und deshalb werde ich mein Koan nicht lösen, werde den Schneeleoparden nicht sehen, das heißt, ihn wirklich erkennen. Ich werde ihn nicht sehen, weil ich nicht bereit dazu bin.
Zum letztenmal meditiere ich auf diesem Berg, der nackt ist, während alle anderen darum herum mit Schnee bedeckt sind. Wie der nackte Gipfel meines Koan unterscheidet er sich nicht von meinem Selbst. Ich kenne diesen Berg, denn ich bin der Berg und fühle ihn atmen. Sollte der Schneeleopard jetzt von dem Felsen über mir herabspringen und sich vor mir manifestieren – S-A-A-O! -, so könnte ich ihn in diesem Augenblick der reinen Furcht, völlig von Sinnen, vielleicht wahrhaft erkennen und frei sein.
251
O Jünger, wo suchst du mich?
Siehe, ich bin neben dir.
Ich bin weder im Tempel noch in der Moschee,
nicht in den Riten und Zeremonien,
und nicht im Yoga oder im Verzicht.
Bist du ein wahrhaft Suchender, sollst du sofort mich schauen.
Du sollst mir begegnen in einem Augenblick.
Sei nicht verblüfft von dem wahren Drachen.
253
Bei Tagesanbruch bin ich mit Tukten und Dawa unterwegs; am Weißen Fluß entlang wandern wir aufwärts der Sonne entgegen. GS begleitet uns bis zur Paßhöhe, um sich dort nach Schafen umzusehen, und Jang-bu und Gyaltsen kommen mit, um in Saldang eine Ziege zu kaufen. Der immer wieder vom Leoparden genarrte GS will es mit einem lebenden Köder versuchen, der, wenn er auch nicht wirkt, wenigstens für einen Fleischvorrat sorgt. Sollten sich Wölfe in der Gegend herumtreiben, so wird die Ziege nicht ausgesetzt, denn Wölfe lassen nichts übrig.
(Eine Woche später zogen zwei Schneeleoparden an Shey Gompa vorbei. Die Ziege wurde draußen angebunden, und GS legte sich zwei Nächte lang auf die Lauer, aber die Leoparden kamen nicht wieder. Also wurde die Ziege geschlachtet und von Menschen verzehrt. Einen Schenkel erhielt Lama Tupjuk als Geschenk, dazu eine Hose von Phu-Tsering. Jang-bu, der seine Stiefel als Opfergabe darbieten wollte, wurde von GS daran gehindert, der daran denken mußte, seine Expedition heil über die Berge zurückzubringen.)
Phu-Tsering bleibt allein zurück, ich werde ihn vermissen.
Gestern abend überraschte er uns mit einem Stoß flotter Zeichnungen: Flugzeuge, Mädchenköpfe, typisch europäische Szenen. Eine davon ließ unser Gastgeber Ongdi mitgehen, sicher in der Hoffnung auf einen Tauschhandel. Beim Abschied heute morgen fragte ich Phu-Tsering, ob er mich begleiten würde, falls ich einmal eine Reise zu den Klöstern in Ostnepal machen würde. Und Phu-Tsering, der fröhliche Koch und gute Freund, schluchzte genauso gerührt wie ich: »Danke, ja!«
Kaum hundert Meter vom Dorf entfernt ziehen drei frische Wolfsfährten über den Hang. Weiter oben an der Schneegrenze stehen regungslos die großen Böcke der Somdo-Herde. Als letzter der Gruppe gehe ich, als das Kloster außer Sicht gerät, einige Schritte rückwärts und beobachte, wie die durchscheinenden Gebetsfahnen des Kristall-Klosters sich in den Berg von Somdo zurückziehen … om! Ich ziehe den Riemen meines Rucksacks fester und schreite vorwärts. In einem eisverkrusteten Bach finde ich einen Stein von der Gestalt eines Berges mit eingeschlossenen 254fossilen Muscheln. Er ist sehr schön, aber zu schwer, und ich werfe ihn in das Bachbett zurück.
Rings um eine Gebetswand auf der nächsten Anhöhe ist alles voller Wolfsspuren und gelber Flecken. Der Weg steigt jetzt nach Norden an, entlang dem felsigen Bett eines Nebenflusses, wo am Ende eines langen, allmählichen Anstieges Himmelblau zwischen den weißen Wänden aufschimmert. Doch was wie der Paß aussieht, versinkt im Gestein, während wir uns nähern, und ist nur der Durchgang zu einem weiteren steilen Aufstieg über tückisch vereiste Felsen zwischen großen Schneewehen. Die Luft ist dünn, und immer wieder, wenn ich zum Atemholen stehenbleibe, schaue ich über eine Welt reinsten Weißes ohne Tierspuren im Schnee oder einen vorbeiziehenden Vogel in der Luft.
Auf dem 5150 Meter hohen östlichen Paß steht wieder ein großer Steinhaufen, durch Jahrhunderte von Reisenden aufgeschichtet. Vor uns erstreckt sich eine nackte, braune Mondlandschaft bis nach Tibet hinein. In dieser öden Bergwüste, einer Welt über den Wolken, tragen nur die Spitzen der höchsten Gipfel eine weiße Mütze. Die zackigen Grate und Schluchten des Himalaja runden sich zu Bergkuppen und runden Tälern, und im Osten jenseits der Berge liegt die endlose Weite von Mustang, dem alten Königreich von Lo.
Bald tauchen hinter uns Tukten und Dawa mit ihren Lasten auf und setzen sie in den Schnee neben den Steinhaufen. Die Sherpa sind sichtlich beeindruckt von dem riesigen Horizont, der sich vor ihnen auftut, denn sie sehen sich minutenlang schweigend um, ebenso wie Jang-bu und Gyaltsen, die mittlerweile herangekommen sind.
In der Richtung, aus der wir gekommen sind, ragen die Nordwände der Himalaja-Kette auf (von hier aus haben nur wenige Abendländer ihren Anblick genossen) und bilden eine eisige Festung aus schimmerndem Weiß. Unvorstellbar, daß an solchen Orten Menschen leben können, und doch wissen wir, oder glauben zu wissen, daß dort unter dem Kristall-Berg Shey Gompa in den Schluchten verborgen liegt.
Es wird Zeit zu gehen. GS schüttelt Tukten und Dawa, die er nicht wiedersehen wird, die Hand, und die vier Sherpa ziehen hangabwärts im Gänsemarsch durch den Schnee.
255
Ich bleibe noch ein wenig. In der windlosen Stille platzt George plötzlich heraus: »Es tut mir verdammt leid, daß du da hinunterziehst.« Ich erwidere, daß es mir ebenso verdammt leid täte, ziehen zu müssen, und versuche, das nicht Ausdrückbare in Worte zu fassen, als wir uns zum Abschied die Hand geben. »Das alles hat mich sehr, sehr bewegt …«, sage ich und halte inne. Solche Worte sind nur Gebrabbel, sie sagen ohnehin nicht, was ich meine. Diese Reise hat mich fortbewegt von dem, was ich bisher war, und ich werde niemals dahin zurückkehren können.
Beide freuen wir uns für den anderen über den glücklichen Verlauf unserer Expedition. Wir hatten unterschiedliche Ziele und Aufgaben, und meist hat jeder von uns den Tag für sich verbracht, was unser beider Temperament entspricht; auch abends wurde nur wenig geredet. Ich habe nie mit George über die Vorgänge in meinem Kopf gesprochen, aus Angst, er könnte mich für verrückt halten, aber wer weiß, was alles in seinem Kopf vorgegangen ist. Und doch haben wir uns am Abend immer gefreut, uns zu sehen, was nach zweimonatigem erzwungenen Zusammensein unter harten Bedingungen schon sehr viel bedeutet.
Wortlos schütteln wir uns noch einmal die Hand, wohl wissend, daß uns bei unserer nächsten Begegnung, wieder im zwanzigsten Jahrhundert, wahrscheinlich wieder die Schutzmauern der modernen Gesellschaft umschließen. Dann drehe ich mich um und stapfe nordwärts den Schneehang hinunter. Als ich stehenbleibe, um zurückzuwinken, erkenne ich nicht mehr den blauen Anorak und das braune Gesicht, sondern nur eine dunkle Männersilhouette gegen das grelle Gegenlicht, wie in einem Traum, die ebenfalls langsam die Rechte hebt. Und wieder wende ich mich nach Norden und sehe vor mir im Schnee frische Wolfsspuren, aber als ich mich umdrehe, um GS zuzurufen, ist der Himmel leer; nur um den alten Steinhaufen stiebt funkelnder Schnee.
Der Pfad steigt in grau zerklüftete Täler hinab. Ich habe meinen Stock auf dem Paß vergessen, aber es ist schon zu spät, um ihn zu holen. Die Sherpa sind längst außer Sicht, aber Tukten wartet auf mich an der ersten Stelle, an der ich eine falsche Richtung einschlagen könnte. Er macht mich nicht darauf aufmerksam, wie vorausschauend er war, er steht einfach da. Während er wartete, 256hat er Wolfsfährten entdeckt, von denen die eine wesentlich kleiner ist als die andere: ein Muttertier mit einem Welpen. Weiter unten im Tal bestätigen uns zwei Hirten, daß es viele Jangu hier gibt und auch Sao, die nicht nur die Na jagen, sondern auch Tiere aus den Haustierherden reißen. Obwohl es vor allem die Wölfe sind, die unter den Haustieren Beute machen, sei es ein Sao gewesen, der noch in der letzten Nacht eine Ziege geholt habe. Am frühen Nachmittag sehen wir eine Herde von etwa zwanzig Blauschafen, die wohl von den Schaf- und Ziegenherden über Namgung angezogen wurden. Die Tiere sind sehr scheu, da die Leute von Namgung ihnen nachstellen. Nur in Shey wird dank der Gegenwart von Lama Tupjuk nicht gejagt.
Das Dorf Namgung liegt höher als Shey, um die 4800 Meter hoch. Das rote Steingebäude von Namgung Gompa ist in den Nordhang der Schlucht gebaut, in der die Bewohner beiderseits des Flusses Namgung Terrassenfelder angelegt haben. Während die anderen auf dem Pfad warten, steige ich mit Jang-bu zu dem ersten Haus in der Schlucht hinab, wo uns eine wütende Dogge an einer dünnen Kette zurücktreibt. In diesem baumlosen Land bedaure ich bitter den Verlust meines guten Stockes. Vom Dach seines Hauses aus betrachtet uns der Besitzer mißtrauisch und macht keinerlei Anstalten, den tobenden Hund zu beruhigen. Erst nach einer Weile kommt er heraus, zu unserem Glück, denn er hat die Schlüssel zur Namgung Gompa.
Die rotweiße Gompa und die Stupas sind die einzigen Farbtupfer in dieser fahlen, öden Landschaft. In der Gompa klettern wir über roh gehauene Leitern in einen kleinen Raum im dritten Stock, der von einem einzigen, staubdurchtanzten Lichtstrahl durch ein schmales Fenster erhellt wird. Die Kapelle ist mit verschlissenen Wandteppichen, Lederbehältern, Trommeln, Kupferkesseln und Schneckenhörnern, mit Holzkästen, zwischen Holztafeln gebundenen Büchern und einer Anzahl Terrakotta-Figuren von Karmapa, Shakyamuni und Padmasambhava vollgestopft. Über dem Durcheinander thront eine herrliche Bronzestatue von Dorje-Chang auf ihrem Sockel, so voller Leben, als würde sie im nächsten Augenblick zu sprechen anheben. Ich kann den Blick kaum von ihr wenden.
Befremdet von der Unordnung und dem Schmutz erkundige 257ich mich, ob es denn keinen Lama in Namgung gäbe. Stolz gibt sich der Schlüsselverwahrer als »Lama« zu erkennen, obwohl ein Lama wie er eher ein Tempelwächter als ein echter Lama sein dürfte und schon gar kein Tulku wie der Lama von Shey. Jang-bu erzählt mir, sein Vater sei auch ein »Lama«, wahrscheinlich ist er ein Laie wie dieser Tempelwächter. Unser Führer zündet zwei Butterlampen an, um seine Zuständigkeit zu beweisen, gibt aber zögernd zu, daß der Tempel vernachlässigt ist und daß deshalb die wertvolleren Thangkas bereits weggeschafft worden sind.
Hinter Namgung windet sich der Pfad in großen Kehren um einen Berg nach dem anderen hinunter nach Saldang. Auf einem Vorsprung sehen wir abermals eine Blauschafherde von etwa dreißig Tieren. Als wir auf einen Schwarm tibetischer Schneehühner stoßen, lassen Jang-bu und Gyaltsen ihre buddhistischen Gelübde wie ihre Lasten fallen und versuchen, mit Steinwürfen Beute zu machen, allerdings ohne Erfolg. Wir ziehen weiter. Tukten trägt die Lebensmittel und das Kochgeschirr, Dawa mein persönliches Gepäck, Gyaltsen hat einige von GS aussortierte Gegenstände dabei, die er gegen die Ziege tauschen soll, und Jang-bu schleppt ein großes Bündel Wacholderzweige, denn hier in der Trockenzone ist Brennstoff rar. Ich selber trage außer dem Zelt und dem Schlafsack meinen mit Büchern und Fossilien vollgestopften Rucksack. Nach hartem neunstündigen Marsch erreichen wir in der Dämmerung Saldang, das auf einem Plateau über dem Flußtal des Nam-Khong liegt.
Jang-bu geht geradewegs auf ein Haus zu, mit dessen Bewohnern er bei seinem ersten Besuch in Saldang Freundschaft geschlossen hat. Unsere Namu heißt Chirjing, sie lebt hier mit ihrer alten Mutter und überläßt mir als Nachtquartier den Vorratsraum im oberen Stock des Hauses, der auch als Gebetsraum benutzt wird. Er ist fast so groß wie die Kapelle in Namgung Gompa und weitaus sauberer. Hier gibt es keine Statuen, aber ein paar grellbunte, moderne Thangkas an den Wänden und alte, schöne Butterlampen und Opferschalen aus Messing künden von dem festen Glauben der Hausbewohner.
In einer Ecke des Vorratsraumes lehnt ein gefährlich aussehender Speer; wie Chirjing erzählt, wurde er hier in Saldang angefertigt und stammt aus der Zeit, als nomadisierende Räuberhorden 258aus Tibet nach Saldang einfielen, bis sich die Dorfbewohner schließlich gegen die plündernden und mordenden Banden bewaffneten und zur Wehr setzten.
Tukten bringt heißen Tee auf das offene Dach, von wo ich im letzten Abendlicht über das Tal des Nam-Khong nach Tibet ausschaue, das hier einfach Byang, der Norden, genannt wird. Die erodierte Landschaft, deren Boden von scharfen Ziegen- und Schafshufen zu Staub zermahlen ist, gehört zur Trockenzone im Norden Nepals, einer Wüstenlandschaft aus ausgelaugten Hügeln und tief eingegrabenen Spalten, die acht Monate nichts als braune Dürre ist. Sogar die spärlichen Schnee- und Regenfälle setzen das Zerstörungswerk der Erosion fort, durch das ständige Auftauen und Wiedergefrieren zerbröckelt die Erdoberfläche immer mehr. Im Verlauf der Jahrhunderte kamen die Regenwolken aus dem Süden immer seltener über das Gebirge; der Boden ist karg, die Wachstumsperiode kurz, und neuerdings lohnen sich auch die Karawanenzüge mit Salz und Wolle nach Süden nicht mehr, da die billigeren Waren von Indien nach Norden vordringen. Irgendwann einmal wird auch diese kleine Stadt der Wüste überlassen werden wie die alten Städte in Westtibet.
Ich gebe Jang-bu den Auftrag, Fleisch zu kaufen, aus dem unsere Wirtin eine Mahlzeit bereitet, wie wir sie seit September nicht mehr gegessen haben: gekochtes Ziegenfleisch mit Kartoffeln, Rüben und ein wenig Reis und dazu viele Becher Gerste-Chang. Jang-bu ist mein Zechkumpan, Dawa und Gyaltsen wollen nicht trinken; Tukten nimmt zwar ein oder zwei Becher, scheint sich aber, trotz seiner Reputation, nicht viel daraus zu machen. Wir feiern bei einem rauchigen Dung- und Reisigfeuer im fensterlosen Untergeschoß des Hauses, hinterher bietet uns die hübsche Chirjing heiße Weizenfladen mit Salz und Butter an. Während wir essen, kommen immer mehr Dörfler herein, und bald ist das Feuer von einem Kreis herrlich lebhafter, alter und junger Gesichter umringt. Ich frage mich, ob ich jemals in einem einzigen Kreis von Menschen so viele Gesichter gesehen habe, die mir so sympathisch waren, und mit vollem und warmem Bauch ziehe ich mich glücklich in meinen Schlafsack zurück. Bald jedoch ruft Jang-bu mich wieder nach unten. Ein Mann hat eine Danyen, 259eine schöne, schlankhalsige Laute, mitgebracht, zu deren Klängen die jüngeren zu tanzen beginnen. Immer mehr Leute drängen sich in den Raum, und in den scharfen Rauch mischt sich Schweiß- und Tabakgeruch. Unsere alte Wirtin bereitet einen neuen Topf Chang, indem sie die Flüssigkeit von der vergorenen Gerste durch einen Korb abgießt. Eine hübsche pausbäckige junge Frau hat ihre ebenso pausbäckige kleine Tochter, Chiring Lamo, mitgebracht. Während die junge Mutter tanzt, nimmt unsere alte Hausmutter die Kleine auf den Schoß. Beide, die Alte und das Kleinkind, sind reich mit Perlen- und Metallschmuck behängt, und auf beiden Gesichtern, dem zerknitterten und dem straffen rotbackigen, liegt derselbe Ausdruck kindlichen Staunens. Nicht lange darauf stellt sich Chiring Lamo hin und pinkelt auf den schmutzigen Boden, wobei sie neugierig auf ihre nassen fetten Beinchen hinunterschaut.
Lachend hat ihre Mutter unsere Wirtin, die katzengesichtige Chirjing, an den Händen gefaßt und tanzt mit ihr herum. Der Lautenspieler, ein überraschend hübscher junger Bursche, strahlt mich so herzlich an, als sei ich sein bester Freund auf Erden. Nun kommt ein Mann herein, der offenbar Chirjings Freier oder Verlobter ist. Jang-bu zieht seine Harmonika heraus und begleitet die Laute, Dawa und Gyaltsen lachen unterschiedslos über alles, was sie sehen, aber der einzige von uns, der sich unter die Tanzenden mischt, ist Tukten – Tukten Sherpa, Koch und Träger, angeblicher Dieb, Trunkenbold und alter Gurkha, ist auch ein Tänzer, und beim Tanzen lächelt er und lächelt. Der Tanz besteht aus einem kurzen, rhythmischen Stampfen und Schreiten, das nicht viel Platz benötigt, ähnlich den Iglu-Tänzen der Eskimos. Als die Tanzenden zu singen beginnen, stimmt Tukten mit ein, nicht aber Dawa, der zu scheu ist, um seine schöne Stimme erklingen zu lassen. Die Lieder sind melodisch und wehmütig und erinnern mich wieder an die Huainus der Anden. Wie Jang-bu übersetzt, heißt das eine Lied »Bring dem Lama Blumen«, während ein alter Gesang, »Höchste Berge« genannt, mit den Worten beginnt »Auch der höchste Berg kann mich nicht daran hindern, Nurpu zu erreichen«, und Jang-bu sieht mich aus den Augenwinkeln an, ob ich über die sehnsuchtsvolle Anrufung des alten Berggottes lache.
260
Wir bechern weiter, Jang-bu und ich, und er erzählt mir beiläufig, daß auf dem Rückweg von Jumla Tuktens wenige Habseligkeiten in Ringmo gestohlen wurden; Tukten selbst hat das mit keinem Wort erwähnt. Gesprächig geworden, erzählt Jang-bu mir auch, daß er von Mitgliedern einer japanischen Bergsteigergruppe nach Japan eingeladen wurde, um dort Ackerbau zu studieren. Der Gedanke fasziniert ihn zwar, aber er liebt das Wanderleben zu sehr, das Chang und den Arrak, und er wird der Einladung wohl niemals folgen.
Ich sitze da, friedlich wie ein Buddha, und von jenseits des Feuers lächelt Tukten mir zu, als hätte ich die Lotusblüte hochgehalten. Der Tanz ist vorüber, und nun sitzt dieser bescheidene Tulku des Kasyapa Knie an Knie mit der helläugigen Alten und bringt sie mit seinen Tukten-Witzen zum Lachen, während er das kleine Mädchen wiegt, das verschlafen in seinen Schoß geklettert ist. Für diesen Mann gibt es keine Grenzen, er liebt uns alle.
Mit einem Glücksgefühl wache ich beim ersten Dämmerschein auf und rezitiere meine Morgensutren in Chirjings Hauskapelle, bis die Sonne den Himmel hinter den Bergen erhellt und Tukten mir den Tee bringt. Dann kommen Jang-bu mit den glitzernden Fingerringen und Gyaltsen in seinen kurzen Hosen, um Abschied zu nehmen. Ich bedanke mich bei Jang-bu für die Geduld, mit der er so viele dumme Fragen für mich gestellt hat und ziehe Gyaltsen ein letztes Mal mit der verunglückten Ausweitung meiner Stiefel auf. Danach verabschiede ich mich von Chirjing und ihrer Mutter. Als ich sage, wie geehrt ich mich fühle, daß ich die Nacht im Heiligtum des Buddhas verbringen durfte, nimmt die alte Frau mit Tränen in den Augen meine Hand und drückt ihre Stirn segnend an meine Brust, während sie etwas murmelt wie »Tuchi churochi«, was wohl so viel wie »Vielen Dank« heißt, oder auch »Tashi shok!«, »sei gesegnet«, oder gar (ich hoffe, das war es nicht) »Tanga cheke«, »eine kleine Münze«. Dann verlasse ich das Haus, um mir Saldang anzusehen.
Obwohl das Dorf in der gleichen Höhe liegt wie Ringmo, so 261um die 3700 Meter, unterscheidet es sich in seinem Aussehen völlig von Ringmo. Letzteres ist ein Himalaja-Dorf unterhalb der Baumgrenze, während Saldang in der baumlosen Trockenwüste des Tibetischen Hochplateaus liegt. Die Häuser des Dorfes sind auf einem offenen Hang des Nam-Khong-Tales gebaut und haben dieselbe braungraue Farbe wie der Boden, aus dem sie wie Eruptionen zusammenwachsen. Der Boden ist eine durch Trockenheit und Erosion zusammengebackene rissige Staubschicht, nur auf den mit Schmelzwasser bewässerten Terrassen ist ein wenig Ackerbau möglich. In der Nähe der Häuser stehen kleine verkrüppelte Birken und Weiden, die durch Steinwälle vor dem hungrigen Vieh geschützt werden. Ich habe gehört, daß die Zweige als Futter abgeschnitten werden, aber man scheint sich damit sehr zurückzuhalten. Ich habe das Gefühl, daß die Bäume hauptsächlich hierher gebracht wurden, damit sie die überwältigende Strenge der Landschaft etwas mildern. Die Kargheit von Saldang wird durch seine dünne Besiedlung noch unterstrichen. Jetzt, im späten November, ist aus jeder Familie zumindest ein Mitglied, meist aber mehrere, nach Süden oder Osten gegangen, um dort zu arbeiten. Auch die Herden werden im Winter nach Süden getrieben, während sie früher auf der Hochebene in Tibet überwintern konnten. Die sauber gestrichenen, ordentlichen Häuser und Wände sowie die gepflegten Felder in dieser Einöde künden vom stolzen Lebenswillen der Bewohner, die sich der Banditen erwehrten und die so heiter tanzen können, auch wenn sie kaum noch Lebensmittel haben. Die Vielzahl der Gebetswände, die auf jeder Anhöhe hochragenden Stupas und seltsame, in Reihe aufgestellte Steinplatten zeugen zudem von der Frömmigkeit der Leute. Derartige wie Grabsteine in Reih und Glied stehende Platten, Obo genannt, sind charakteristisch für Nordtibet und die Mongolei.
Die Landschaft ist voller Geheimnisse und Kontraste, in dem klaren, harten Licht mutet bereits der regungslose Schatten eines Pferdes an wie ein Omen. Eines Tages werden die Menschen daran verzweifeln, den hohlen, kalten Ebenen ihr Existenzminimum abzuringen, und auch die letzten Reste einer alten tibetischen Kultur werden im Staub versinken.
Ich gehe bergabwärts zur Saldang-Gompa. Der Tempel ist geschlossen, 262da der Lama sich in einem anderen Dorf aufhält, aber in einem gelben Gebäude nebenan stehen zwei riesige, drei Meter hohe Gebetszylinder mit einem Durchmesser von über einem Meter, die mit Symbolen bunt bemalt sind, wie dem Rad des Asoka, Muschelhörnern, der Kugel des Erbarmens, mit Schlangen, Blumen, Gerstenopfern und dem Mantra om mani padme hum. Saldang ist eine Gompa der Sakyapa, hier werden die Bodhisattvas Manjusri und Tschenrezigs verehrt neben dem historischen Buddha Shakyamuni und dem kommenden Buddha Maitreya. Auf den leuchtenden Fresken ist der allgegenwärtige Padmasambhava abgebildet mit einer Laute, die der von gestern abend ähnelt; der Lotusgeborene feiert ein himmlisches Fest mit einem blauen Herrscher des Totenreiches, der uns eines Tages den klaren Spiegel vorhält, vor dem wir uns nicht verbergen können, und die weißen Kiesel der guten Taten gegen die schwarzen der Missetaten abwiegt.
Tukten hat einige Vorräte eingekauft und kommt mit Dawa zum Kloster nach. Der hübsche Lautenspieler ist in ihrer Begleitung, er will sein Glück in Katmandu versuchen und als Führer und Träger bis Murwa mit uns kommen. Karma, wie er genannt wird, ist weniger spontan als gestern abend bei Chang und Feuerschein, sein Charme wirkt jetzt eher etwas zudringlich. Zum Glück wird dieser Charme aufgewogen durch die ungekünstelte Heiterkeit seiner Frau, der ausgelassenen jungen Tänzerin von gestern abend, und der kleinen Chiring Lamo, die wie ein lächelnder Buddha auf ihrer Traglast sitzt. Die junge Frau trägt außer dem fröhlich jauchzenden Kind die gesamte Habe der kleinen Familie, während Karma den beiden Sherpa etwas von ihrer Last abnimmt. Besonders Dawa braucht Erleichterung; obwohl er nun, da es nach Hause geht, etwas fröhlicher ist, scheint doch etwas mit ihm nicht in Ordnung zu sein, und er macht versteckte Anspielungen auf irgendeine Krankheit.
Parallel zum Fluß führt der Pfad wieder aufwärts zu einer Reihe kleiner Weiler, die zusammen den Namen Namdo tragen. In dieser Gegend sind die Stupas am Eingang von Tempeln und Dörfern mit schönen bunten Fresko-Bildern und Mandalas bemalt, die sehr gut erhalten sind. Außerdem gibt es viele eindrucksvolle 263Gebetsmauern mit eingemeißelten Inschriften und Mantra-Rädern, die Tukten Ling-po nennt. Hinter Namdo steht abseits auf einem einzelnen Felsenturm über dem Fluß ein Nyingma-Tempel, Sal Gompa, mit einer wunderbaren Meditationskammer, die von einer überdachten Galerie umgeben ist und sich oben zum Himmel öffnet. Sal Gompa wird von einer großen, resoluten Frau instand gehalten, die es nicht für nötig hält, sich als »Lama« auszugeben. Für den Lama von Saldang steht immer eine Liegestatt bereit. Die Statuen in diesem Tempel der Alten Sekte sind nicht bemerkenswert, lediglich die bunten Thangkas gehören zu den besten und am schönsten gearbeiteten, die wir bisher gesehen haben. Wir loben die Tempelwächterin für ihre Sorgfalt, durch die sie sich von ihrem Kollegen in Namgung so vorteilhaft unterscheidet.
Vom Weg am Westufer des Nam-Khong sehen wir zwei weitere Gompas, von denen eine am jenseitigen Ufer verlassen scheint. Es gibt viele Wolfsfährten, aber keine Anzeichen für Blauschafe oder einen Leoparden. Als wir an einer sonnigen Gebetswand anhalten, setzt sich die junge Frau hin und gibt Chiring Lamo die Brust. Sie trägt eine rote Wollmütze und plötzlich erkenne ich die runden Wangen und das freundliche Lächeln von Tende Samnug, die die gleiche rote Mütze trug, als sie mir in Shey Gompa die Kartoffeln schenkte. Und Karma ist natürlich niemand anderes als Karma Dorje, der Sohn von Ongdi dem Händer; was ich für übertriebene Freundlichkeit gehalten hatte, war nur sein Ausdruck von Wiedersehensfreude. Damals in Shey hatten sie ihr Kind nicht bei sich und waren der Kälte wegen vermummt, trotzdem tut es mir leid, daß ich sie nicht früher erkannt und ihre Begrüßung am gestrigen Abend nicht herzlicher erwidert habe. Als die hübsche Tende sich erhebt, klingen kleine Glöckchen an ihrer Schärpe und an der buntgestreiften Wollschürze, die zur Tracht der verheirateten Tibeterinnen gehört. Und Karma, der seine Laute oben auf seinen Packen gebunden hat, scheint wie immer der ganzen Welt zulächeln zu wollen. Wie viele Bhotias in Dolpo und Mustang nennt er sich selber »Gurung«, »Karma Dorje Gurung« betont er. Da die in Nepal regierenden Hindu-Stämme die Bhotias als minderwertig ansehen, wählen sie dieses Mittel, um sich mehr Respekt zu verschaffen, 264obwohl keinerlei Verwandtschaft zwischen ihnen und den im Süden des Annapurna ansässigen Gurung besteht.
Bei einem Weiler namens Tcha beenden wir unseren ersten Tagesmarsch. Zuerst protestiere ich dagegen, wir haben Zeit genug, um bis nach Raka zu gelangen, der letzten Ansiedlung vor dem ersten der beiden hohen Pässe, die wir auf dem Weg nach Murwa überqueren müssen. Aber Karma behauptet, die Bewohner von Raka seien feindselige Kamis, und als Tukten das bestätigt, gebe ich nach; zu gut erinnere ich mich de Kamis zwischen Dhorpatan und Yamarkhar, von den Kamis in Rohagaon ganz zu schweigen.
Tcha ist ein düsterer Ort in einer engen Schlucht, an der Mündung eines Nebenflusses unterhalb von einem verlassenen Kloster, Hrap Gompa, gelegen. Nach uns kommt eine Karawane von etwa siebzig Yaks an, die freigelassen werden, so daß sie an den Hängen um Hrap Gompa grasen können; die Hirten kommen aus Nyisal und wollen südwärts nach Rohagaon, um die Tiere dort auf die Winterweide zu treiben. Die dunklen Wolken, die über den Canyon aufziehen, lassen Schlimmes für GS befürchten, der bis Anfang Dezember in Shey bleiben will und dort vom tiefen Winter überrascht werden könnte.
Der Nachtwind im Nam-Khong-Tal schüttelte mein dünnes Zelt wie ein trockenes Blatt; gegen Morgen legt der Wind sich etwas, und am schwarzblauen Himmel kommen die Sterne hervor. Noch vor Tagesanbruch breche ich auf, um etwas warm zu werden. Es ist bitterkalt in dieser Schlucht, viel kälter als in Shey, als hockte der Winter das ganze Jahr in diesem Verlies aus schwarzen Steinen und Eis, das von senkrechten Wänden umschlossen ist. Mit Sonne ist hier wohl erst in den Mittagsstunden zu rechnen. In einer Kehre der Schlucht oberhalb von Tcha stehen die schweren quadratischen Zelte aus dem Norden eingewanderter Nomaden. Ich habe keinen Stock und kann mir in diesem baumlosen Land auch keinen besorgen, so bin ich froh darüber, daß der rauschende Fluß meine Schritte für die Hunde unhörbar macht.
265
Auf einer Kieselbank im Fluß steht ein geschmückter Steinhaufen, zu Ehren der Wasserdämonen, Klu, wie Tukten später erklärt. Sie sollen sich rächen, wenn man sie nicht beachtet. Zwischen den Felsen bewegen sich sonderbare Schatten: eine verhutzelte kleine Frau, viel zu alt, um die Mutter der beiden vermummten Kinder zu sein, die neben ihr stehen. Die Gestalten im grauen Licht sehen aus wie Trolle aus einem Zaubermärchen. Der höchstens zehn Jahre alte, vor Kälte schnatternde Junge trägt eine Last, die schwerer aussieht als die meine, und das kleine Mädchen, fast noch ein Kleinkind, muß über die gefrorenen Bäche hinübergehoben werden, die wie Eiszungen aus den Klüften in der östlichen Wand hervorlecken. Die Alte ist gebeugt unter einem großen Packen Schaffelle; was sie weiter im Süden dafür bekommt, dürfte kaum eine so schwere Reise lohnen. Sie hebt mit einer bittenden Gebärde die gichtigen Hände an den Mund, aber ich habe nichts zu essen dabei und bedeute ihr, sie solle die mir folgenden Sherpa darum bitten. Die drei lächeln so gut sie können; vielleicht sind die Kinder tapfere Waisen, vielleicht sind sie so früh auf den Beinen, damit sie nicht in der bitteren Kälte zu Tode frieren, da sie keinerlei Brennmaterial haben. Ich gehe weiter nach Raka und schreite so rasch wie möglich aus, um warm zu bleiben.
Eine Yakherde, getrieben von verwilderten Knaben, kommt den Berg über Raka herab, in einem aus Steinen errichteten Pferch liegen weitere hundert Yaks, dazu bestimmt, die hier gestapelten Wollballen und Salzlasten in den Süden zu transportieren, die von großköpfigen Doggen bewacht werden. Langhaarige Männer mit Kurzschwertern, gestreiften Kitteln und unterm Knie zusammengeschnürten Filzstiefeln sitzen rauchend um ein Feuer. Diese Männer aus dem Norden sind rauh und verwegen, aber die Leute von Raka sollen regelrechte Räuber sein. »Schlechte Menschen«, hat Karma Dorje sie gestern genannt, die das ganze Jahr über in der dunklen Schlucht leben, als ob sie das Tageslicht scheuten. Mit verkniffenen Gesichtern, wie Sträflinge, sehen sie uns nach.
Oberhalb von Raka verengt sich der Canyon zu einer engen Klamm, in der das Wasser von einer Wand zur anderen geworfen wird. Weder die Leute von Raka noch die Nomaden haben sich 266um den Bau einer Brücke gekümmert, zum Glück ist der Wasserstand nach den langen Wochen ohne Regen ziemlich niedrig. Zuerst versuchen wir, trockenen Fußes hinüberzukommen, indem wir an seichten Stellen Trittsteine in den Fluß werfen, aber die großen Steine sind fest in die Kiesbänke eingefroren, und die kleineren, die wir lostreten können, sind, wenn wir genügend davon aufgehäuft haben, bald mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Wir werfen Sand darüber, breiten die Arme aus und springen los, aber nach drei solch kitzligen Übergängen geben wir diese Methode auf, denn sie ist zu mühsam und kostet zu viel Zeit. Kurz entschlossen ziehen wir Schuhe und Strümpfe aus, rollen die Hosenbeine so hoch wie möglich und waten barfuß hinüber, wobei wir durch das Eis an beiden Ufern brechen. Nach einigen Durchquerungen sind meine Füße versteinert, und ich verfluche Karma: Wieviel einfacher wäre es gewesen, wenn wir Raka gestern noch hinter uns gelassen und diese Übergänge in der warmen Mittagssonne unternommen hätten, um dann zu kampieren, wo sich die Schlucht in ein Hochtal öffnet. Die drei Stunden Tageslicht, die wir gestern in Tcha verschwendet haben, bringen uns heute einen langen, harten Tag, an dessen Ende wir einen hohen Paß überqueren müssen. Doch bei allem lacht und schwatzt Tende ununterbrochen, und ihre Fröhlichkeit versöhnt mich etwas mit ihrem Mann, der ebenso heiter ist, wenn auch nicht auf so ansteckende Weise. Übrigens strengt er sich beim Brückenbau besonders an und testet die Übergänge auch als erster – und als er dabei ausgleitet und seine Kleider vor Wasser triefen, lacht er bloß darüber. Auch Tukten ist hilfreich und guter Laune, nur Dawa schaut mit stierem Blick vor sich hin, und ich muß ihn immer wieder herbeirufen, damit er uns hilft. Offenbar ist er nicht ganz bei sich, denn er stolpert oft und läßt einmal seine Last so ungeschickt fahren, daß mein Schlafsack naß wird. In der letzten Zeit scheint er keine Gelegenheit zu einer Ungeschicklichkeit auszulassen, und keine Ermahnung nützt etwas.
Auf der anderen Seite des Raka-Canyon brechen Sonnenbahnen durch nach Osten abzweigende Schluchten, von denen eine, so sagt Tukten, nach Tarap führt. Die Nordhänge sind hier mit dichtem grünen Dornengestrüpp bewachsen, doch gibt es weiter oben 267keine Klippen und daher auch kein Zeichen von Blauschafen. Im Frühjahr müssen gischtende Wasserfälle durch den Canyon tanzen, denn nun geht er steil aufwärts in ein offenes Tal, wo der Bergfluß in einem breiten Bett aus dunklen Kieseln von den Schneefeldern herabrauscht. Hier wenden wir uns südwärts, wieder in Richtung auf den Himalaja.
In einer Flußbiegung hält Karma an, um ein Feuer anzuzünden. Ich traue seiner Versicherung nicht, der Namdo-Paß, obwohl »sehr steil«, sei von hier aus in einer Stunde zu erreichen. Ich ziehe die Stiefel aus, durchwate das Bett eines Nebenflusses und gehe voran in der Hoffnung, daß mein gutes Beispiel die Mittagsrast dieses Saumseligen etwas verkürzt.
Auf der gegenüberliegenden Flußseite steht eine große Stupa und daneben eine Pyramide aus Mani-Steinen und zerfetzten Gebetsfahnen. Zwischen den Steinen liegen große gehörnte Schädel des Argalis-Schafes, einer scheint noch relativ neu zu sein. Die langbeinigen, schnellen Argalis brauchen keine Felsklippen in der Nähe, um sich in Sicherheit bringen zu können, und so suche ich denn immer wieder die Berghänge nach Ovis ammon ab.
Weiter oben treiben zwei Hirten ihre Yaks in die Dornbüsche. Da sie Feuerholz sammeln, haben sie offenbar nicht vor, noch heute über den Paß zu gehen. Ein Stück weiter verläßt der Yak-Pfad das Flußbett und beginnt steil in den Schnee hinaufzusteigen. Es wird Nachmittag, und nach sieben Stunden harten Marschierens habe ich auch nicht viel Lust zu einem steilen Anstieg. Andererseits, wenn wir jeden Tag so früh lagern wie gestern, brauchen wir fünf anstatt drei Tage nach Murwa. Und so schreite ich fort in der Hoffnung, daß Tukten die anderen zum Weitergehen überredet.
Wer als erster nach den Schneefällen im Oktober den Paß überschritten hat, mußte schwere Arbeit leisten. Auch jetzt, nachdem viele Karawanen nachgefolgt sind, kann man abseits des Weges die Spuren tief in den Schnee eingebrochener Lasttiere erkennen, die von der Richtung abgewichen sind. Jetzt ist die Hauptroute voller Dung und nicht zu verfehlen, auf dem gefrorenen Dung findet der Fuß besseren Halt. Außer der Fährte einer Wühlmaus gibt es keine Spuren von Wildtieren, am Himmel ein 268paar blasse Finken auf dem Weg nach Süden sind die einzigen Zeichen von Leben.
Der Pfad steigt steil zu dreieckigen Schneegipfeln auf, die Sonne sinkt. Ich beeile mich, um mit dem in völliger Stille den Berg hinaufwandernden Licht Schritt zu halten, vielleicht gelingt es mir, bis zur Paßhöhe warm zu bleiben. Der Wind hat an einigen Stellen den Schnee von den steilen Wänden gefegt, so daß der dunkle Fels hervorkommt – schwingenförmige schwarze Konturen schweben durch das Weiß. Der Himmel glüht, und die erstarrten Gipfel beginnen zu klingen. Die Schönheit des Namdo-Passes öffnet meinen Geist, er ist tatsächlich eine Pforte zum Himalaja, durch die der Wanderer aus einer Welt in eine andere eintritt. Ich habe keine Ahnung, wie der Paß wirklich heißt, aber ich meine, dieser Name paßt zu ihm: Nam-do bedeutet »Himmels-Stein«.
Bei dem Steinhaufen am Paß drehe ich mich um und schaue hinter mich. Am Nordhorizont erstreckt sich die braune Wüste der Tibetischen Hochebene, ohne ein einziges Anzeichen für die menschlichen Siedlungen in ihren Canyons und Tälern. (Auf dieser Paßhöhe wurde GS in der ersten Dezemberwoche von einem Schneesturm überrascht; später erzählte er mir, wie ein Hirte mitten im wilden Schneetreiben eine Gebetsfahne in den Steinhaufen steckte, neben dem sein Höhenmeßgerät 5300 Meter anzeigte.)
Die Sonne ist fort. Von weitem dringt das Weinen von Chiring Lamo durch die dünne Luft herauf, die Kinderstimme ist der einzige Laut in der weißen Wüste. Nach den Wolken von gestern abend und dem Wind von heute nacht können wir heilfroh sein, daß sich das gute Wetter gehalten hat. Als endlich Dawa auftaucht, winke ich ihm zu und steige dann rasch die andere Seite des Bergsattels hinab, ehe es völlig dunkel wird. Unter mir liegt ein verschneiter Talkessel, der am anderen Ende in einen offenen Berghang übergeht, wo wir unser Lager aufschlagen können. Zu meiner Überraschung führt der Pfad noch einmal ins Sonnenlicht, da das Tal sich nach Westen senkt und den Blick auf das tiefstehende Gestirn freigibt.
Dawa kommt und wir beginnen, auf einem kleinen Tundra-Streifen das Lager aufzuschlagen. Tende trifft als nächste ein, 269mitgenommen, aber lächelnd. In der kalten Dämmerung sammelt sie Dungfladen und singt dabei leise für Chiring Lamo.
Unser Lager liegt nur etwa 300 Meter unterhalb des Namdo-Passes und der Morgen ist bitterkalt. Auch die ersten Sonnenstrahlen bringen keine Wärme. Der Canyon unter uns fällt zu einem Gewirr dunkler, enger Schluchten ab, die wohl zu dem östlichen Arm des Phoksumdo-Sees führen, den wir am 25. Oktober gesehen haben, denn zwischen zwei Bergketten tut sich dieser Richtung eine Lücke auf, in deren Tiefe der türkisfarbene See der großen Dämonin verborgen liegen muß.
Trotz der Kälte sitzen Tende und Chiring Lamo fast nackt auf einem Schafsfell vor dem Feuer, das Kinderköpfchen liegt zwischen den Perlenketten und Amuletten an der braunen Brust der Mutter. Dawa ist wohl ernsthaft krank, er läßt mir durch Tukten sagen, daß er schon vor dem Abmarsch aus Shey an Durchfall und Darmblutungen gelitten hat und sich sein Zustand verschlimmert. Besonders die Blutungen erschrecken mich, denn das kann gefährlich werden. Dawa brauchte jetzt eigentlich Ruhe, aber wir können nicht hier in der Wildnis zwischen den Pässen bleiben. Wahrscheinlich ist es sogar sein Glück, daß er mit uns gekommen ist; ohne Gyaltsens Furcht vor Tukten wäre Dawa bei GS geblieben und möglicherweise dort in Shey gestorben, ohne jemals etwas von seiner Krankheit zu sagen, weniger aus Tapferkeit als aus jener bäuerlichen Apathie und dem für diese Menschen typischen Fatalismus, der so oft mit Dummheit verwechselt wird.
Ich gebe ihm ein Medikament gegen Durchfall, das ihn ebensogut umbringen kann. In seinem geschwächten Zustand sehnt sich Dawa nach Fürsorge; es tut ihm gut, daß ich ihn daran erinnere, die Schneemaske zu tragen, damit sein Zustand sich nicht noch durch Schneeblindheit verschlimmert. In seinen Kniehosen, mit hängendem Kopf, steht er vor mir wie ein großes Kind, das Schelte bekommen hat.
Die Yak-Route steigt in den Schatten des Flußtals hinab, überquert 270den vereisten Fluß im Talgrund und steigt auf der anderen Seite wieder in die Sonne hinauf. Ein Schwarm Himalaja-Schneehühner streicht über den steilen Berg. Gegenüber durchziehen Felsklippen die mit Dornengestrüpp bewachsenen Hänge im Norden und Westen, und bald sind auch die ersten Blauschafe zu sehen, eine Gruppe aus neun, eine andere aus sechsundzwanzig Tieren. Vergeblich suche ich die Hänge mit dem Fernglas nach Anzeichen für einen Schneeleoparden ab.
Im Windschatten einer Einbuchtung machen zwei Männer eine Yak-Karawane zum Aufbruch fertig, sie beladen die unförmigen Tiere mit ihren schweren Lasten. Wenig später kommt uns eine andere Karawane entgegen, diese auf dem Weg nach Norden, nachdem die Leute Wolle und Salz gegen Getreide, Bauholz und allerlei kleine Handelsgüter aus dem Süden eingetauscht haben. Die Yaks sind für ihre Mühen mit großen roten Quasten auf ihren Lasten und kleineren orangefarbenen über ihren Ohren belohnt worden, die dunkelhäutigen Treiber haben Ketten und Amulette um den Hals, sie tragen glitzernde Ohrringe und silberne Dolchscheiden. Dies sind die Chang-Tataren längst vergangener Jahrhunderte. Mit rauhen Schreien und schrillen Pfiffen, nackt unter schmutzigen Tierfellen, treiben die wilden Burschen ihre Yaks durch die Schlucht. Hier in dieser Landschaft, in den dunklen Schluchten ist ihr Platz, man kann sie sich kaum woanders vorstellen. Die »rotgesichtigen Teufel« betrachten mich neugierig und stellen mir die unter Wandernden üblichen Fragen:
»Woher kommst du?«
»Shey Gompa.«
»Ah. Und wohin gehst du?«
»Zum Bheri.«
»Ah.«
Während ihre mißtrauischen Hunde sich an mir vorbeidrücken, nicken wir uns zu, gestikulieren und ziehen dann weiter unseres Weges zu anderen Zielen und in verschiedene Welten.
Der Pfad windet sich zwischen Felsentürmen hindurch, die steil in immer neue Schluchten abfallen, hin und her, wie ziellos in alle Richtungen. Im kalten Glanz des Eises ist diese Einöde zwischen den hohen Pässen eine leblose und alles Leben bedrohende Region. 271Das Labyrinth hat seine eigene Schönheit, aber die eisige Bedrohung läßt mich erschauern und treibt mich zur Eile an. Kurz vor Mittag erreichen wir den Anstieg zum zweiten Paß. Auf einer Bergkuppe steht eine Gebetswand und ein Pferch für Karawanen, die zu spät hier eintreffen, um den Paß noch am selben Tag zu bewältigen. Sicherlich werden wir Murwa erst spät am Abend erreichen, obwohl Karma das Gegenteil behauptet. Wahrscheinlich werden wir uns schon sehr sputen müssen, um überhaupt noch über den Paß zu kommen und auf der anderen Seite bis hinab zur Schneegrenze zu gelangen, wo wir Reisig für ein wärmendes Feuer sammeln können. Da ich nicht die Lunge der Bergvölker habe und auf den steilen Strecken nur langsam vorankomme, halte ich vor dem Aufstieg nicht an, sondern gehe weiter, ohne auf die anderen zu warten.
Immer wieder bleibe ich zum Atemholen stehen und schaue zurück. Wie ich sehe, hat Karma vor der Gebetswand ein Schaffell ausgebreitet und sich darauf gelegt, während Tende, Dawa und Tukten sich auf Felsblöcke niedergelassen haben. Zweifellos wird Karma ein Feuer anzünden und kostbare Tagesstunden mit einer langwierigen Mahlzeit vertun, so daß wir wieder spät am Abend in Dunkelheit und Kälte das Lager aufschlagen müssen. Er ist so leichtsinnig, wie er fröhlich ist, und verschwendet tagsüber keinen Gedanken an den Abend. Bis jetzt hat er nur falsche Informationen geliefert: dieser Paß ist, wie deutlich zu sehen ist, keinesfalls leichter als der vorige, der Anstieg ist eher steiler und länger.
Sogar in der Mittagsstunde bleibt der Weg hartgefroren und glatt, ich kann auch nicht zur Seite ausweichen, da ich dort sofort durch die Firnkruste einbreche. Der stetige, langsame Schritt, mit dem man Steilhänge am besten überwindet, ist hier unmöglich, ständig rutsche ich aus und muß mich mit den Händen festhalten. Über mir kurvt eine dunkle Yak-Karawane über die Eisflächen, eine andere überholt mich unterwegs; die Treiber, deren Stiefel Sohlen aus festem Zwirn haben, schlendern mit den Händen auf dem Rücken den eisglatten Hang herauf und grunzen und pfeifen ihren dahinschwankenden Tieren zu. Hinter ihnen folgt eine Herde schwarzer Ziegen, die mit klapperndem Hufschlag in gerader Linie über das Eis hinaufspringen, ihr Gehörn glänzt silbern 272vor dem tiefblauen Mittagshimmel. Der Ziegenhirte, von Kopf bis Fuß in blutrote Wolle gekleidet, hält seine Tiere mit gutgezielten Schneeball-Würfen in Reih und Glied; als er über mir durch die Sonne zieht, zerstieben die Schneebälle wie blasses Feuer. Die Gipfel beginnen um mich zu kreisen.
Als ich endlich die Schneefelder unterhalb des Gipfelgrates erreiche, bin ich völlig erschöpft. Über dem Weiß segelt ein Lämmergeier, sein Schatten huscht an mir vorüber, ich reiße mich zusammen und klettere weiter. Zwei Stunden stapfe, keuche, klettere, rutsche, klettere und keuche ich weiter, stumpfsinnig wie ein Tier, während hoch über mir Gebetsfahnen in der nach Westen sinkenden Sonne fliegen, die die kalten Gipfel aufleuchten und den harten Himmel in weißem Licht strahlen läßt. Fahnenschatten tanzen auf weißen Wänden und Schneewehen, als ich im Schatten des Gipfels durch einen Eistunnel die letzten Meter zum Paß hinauftaumele. Dann trete ich wieder in die Sonne hinaus, auf dem letzten der hohen Pässe; ich reiße mir die Wollmütze vom Kopf, damit der Wind mir den Kopf freibläst, sinke erleichtert auf die Knie, ausgepumpt, auf einem schmalen Grat zwischen zwei Welten.
Im Süden und Westen ragen die Eisgipfel des mächtigen Kanjiroba-Massivs empor. Von einem sonnendurchfluteten Dunstschleier umgeben, scheinen sie unwirklich, als könnten sie sich jeden Moment auflösen wie eine Halluzination. Hinter mir, tief unten in der Einöde, aus der ich komme, sind meine Gefährten schwarze Flecken auf dem Schnee. Immer noch schwer atmend, lausche ich dem Wind in meinem Atem, der sirrenden Stille im Feuer des Schnees und den aufsteigenden Felsen. Unermüdlich knattern die Gebetsfahnen und schütteln ihre Wind-Bilder in das nördliche Blau.
Ich habe das Weltall für mich allein. Das Weltall hat mich für sich allein.
Dann setzt die Zeit wieder ein, und meine Stimmung schlägt um. Mein Rücken unter dem schweren Gepäck ist verschwitzt, der Wind wird kalt. Noch ehe ich ausgeruht bin, treibt mich die Kälte den Berg hinunter in einem qualvollen Abstieg über scharfkantige Felsen, schlüpfrige Schneezungen und glitschiges Eis, über das ich mit weichen Knien rutsche und stolpere, als 273würde mich das Gewicht auf meinem Rücken in die Tiefe drücken. Etwa dreihundert Meter tiefer wird aus dem fast senkrechten Felssturz ein immer noch sehr steiler schneebedeckter Pfad über einem vereisten Flußbett. Es dämmert schon, als Tukten mich in seinen fadenscheinigen Kleidern und Segeltuchschuhen überholt. Tuktens Gleichmut gegen Kälte und Anstrengung ist weder Gleichgültigkeit noch Askese; er nimmt einfach hin, was ihm widerfährt. Darin liegt die Quelle seiner inneren Ruhe, die seine schwer zu beschreibende Erscheinung so eindrucksvoll macht. Er stimmt mir zu, daß Murwa für heute nicht in Frage kommt, und geht weiter, mit raschen, immer noch leichten Schritten, um einen geeigneten Lagerplatz zu suchen und Brennmaterial zu sammeln.
Die steile Schlucht, die sich vom Paß herabzieht, mündet schließlich in einen sandigen Berghang, der vom Canyon des oberen Murwa-Flusses abfällt. Die Dunkelheit bricht herein, und ich halte respektvollen Abstand zu den Feuern zweier Karawanen, aus Angst vor ihren Hunden. Als es immer finsterer wird, rufe ich mehrmals »Tukten, Tuk-ten«, bekomme aber keine Antwort. Endlich entdecke ich ihn unter mir beim Feuermachen – Tukten mit seiner Spürnase hat eine Steinhütte an einem Wasserfall gefunden.
Dawa, der eine Stunde nach mir eintrifft, legt sich wortlos und ohne etwas zu essen in die Hütte. Immer wieder rufen wir nach Karma und seiner Familie, aber eine weitere Stunde vergeht und immer noch ist nichts von ihnen zu sehen und zu hören. Heute morgen hat ein gähnender Karma seine Unwilligkeit aufzustehen damit entschuldigt, daß wir sowieso am frühen Nachmittag in Murwa eintreffen würden. Kein anderer als dieser nichtsnutzige Lautenspieler kann es gewesen sein, der Jang-bu – und damit auch mir – weisgemacht hat, man könne »in einem schweren und einem leichten Tag« von Saldang nach Murwa gelangen. Jetzt liegen zwei harte und ein leichter Tag hinter uns und noch immer sind wir nicht in Murwa. Gutgläubig meinte Jang-bu, wir könnten sicher beide Pässe an einem Tag schaffen, da keiner von beiden so hoch und schwierig sei wie der Shey-Paß, vom Kang-La ganz zu schweigen. Aber auch ich war leichtsinnig, als ich mir keine Gedanken darüber machte, warum dann die Wollhändler aus 274Saldang die Route über den Shey-Paß und den Kang-La diesem Weg vorgezogen haben. Jetzt weiß ich es besser. Der eisige Nordhang am Kang-La ist zu steil für Yaks, so daß der Wanderer seine eigene Spur treten muß, aber davon abgesehen ist diese Route leichter als der Weg von Shey über Saldang nach Murwa, auf dem drei Pässe überstiegen werden müssen. Und der Abstieg von dem dritten Paß über uns ist zu dieser Jahreszeit so anstrengend wie der Aufstieg. Mit Sorge denke ich an Chiring Lamo dort über mir in Eis und Sternenlicht, wie sie auf den müden Schultern ihrer Mutter an tückischen Abgründen entlangreitet. Auf solch engen Simsen sollte man nicht in mondlosen Nächten unterwegs sein.
Aber ich bin zu müde, um etwas zu unternehmen, nicht einmal ausdenken kann ich mir etwas. Und ich liege schon im Schlafsack, als die kindlich unbefangene Familie aus dem Dunkel hervortritt.
Gestern bin ich um acht eingeschlafen. Nach tiefem Schlaf wache ich um vier Uhr morgens auf, eingehüllt in ein sanft glühendes Wohlbefinden: Ich habe die hohen Pässe vor dem Wintereinbruch hinter mir gelassen, ich bin auf dem Weg nach Hause. Seltsamerweise äußert sich meine Freude in einem Anflug tiefer Dankbarkeit gegenüber meiner Familie und meinen Freunden, die mir in Deborahs letzten Lebenstagen so verständnisvoll zur Seite standen. So viele traurige und glückliche Erinnerungen stürmen plötzlich auf mich ein, daß mir ganz warm davon wird.
Kurz vor Deborahs Tod kam Eido Roshi, er hatte den Kopf frisch geschoren. Ich hielt Deborahs rechte Hand, Eido Roshi nahm ihre linke, und so rezitierten wir wieder und wieder unsere buddhistischen Gelübde. Kurz nach Mitternacht starb Deborah ohne Kampf.
Ich verließ das Krankenhaus kurz vor der Morgendämmerung. Es schneite. Als ich durch die stillen Straßen ging, fiel mir der Zen-Spruch ein, den Deborah besonders liebte: »Keine Schneeflocke fällt je an die falsche Stelle.« Und auch an diesem grauen 275Wintermorgen war alles, wie es sein sollte, die Schneeflocken fielen still und leicht, alles war ruhig und klar. In ihrem Buch schreibt Deborah:
Die Blume offenbart die ihr innewohnende Intelligenz, indem sie sich entfaltet.
Darin liegt Disziplin.
Die Blume wächst fehlerlos.
Der Mensch muß sich erst entwickeln, ehe er die Intelligenz der Blume versteht.
Vorgehen, als wisse man nichts, nicht einmal sein Alter, sein Geschlecht oder wie man aussieht. Vorgehen, als wäre man aus Spinnweben gemacht … ein Nebel, der hindurchgeht und durch den man hindurchgeht und der doch die Gestalt behält. Ein Nebel, der die Gestalt verliert und immer noch ist. Ein Nebel, der sich schließlich auflöst, indem seine Partikel sich in der Sonne zerstreuen.[85]
Tukten bringt mir Tee und Porridge ins Zelt und treibt die anderen zur Eile an, während ich mich auf den Weg mache. Dawa taumelt bedenklich, und da er kein Simulant ist, muß er sich elend fühlen. Wenn er zusammenbricht, wird es ernst, denn hier in den Bergen finden wir nirgends einen Arzt für ihn, und natürlich können wir ihn nicht einfach in Murwa zurücklassen. In der Hoffnung, ihn bis Jumla durchzubringen, haben wir seine Last unter uns aufgeteilt, und Karma hat versprochen, daß er uns bis nach Tibrikot am Bheri-Fluß als Träger begleitet. Zum Glück hat sich unsere Ausrüstung schon weitgehend reduziert, und jeden Tag lasse ich etwas mehr zurück; es gefällt mir, mit leeren Händen in Jumla anzukommen.
Der Oberlauf des Murwa-Flusses fließt durch einen breiten Canyon mit Wacholdersträuchern und schwarzen, mit Flechten überwachsenen Granitblöcken, die wie verstreute Denkmäler die natürliche, in riesigen Stufen abfallende Aulandschaft säumen; am Ostrand des Canyon hat sich der Fluß eine tiefe Schlucht gegraben. Noch ist es dunkel, nur im Süden, wo die Wände der Schlucht zusammenlaufen, hellt es sich auf, und die Spitzen des Kanjiroba leuchten rosa. Hoch über uns im Canyon läuten Yak-Glocken, 276und zwischen den Granitblöcken vor uns steigt geisterhaft eine Rauchsäule auf. Zwei Hirten hocken wie versteinert vor ihrem Feuer, und hinter ihnen steht das Mantra om mani padme hum mit riesigen Schriftzeichen in die Felswand gemeißelt.
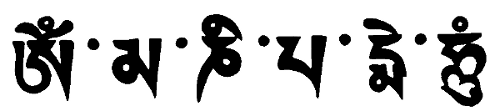
Lächelnd denke ich an einen Satz, den mir ein Freund vor meiner Abreise in einem Brief schrieb: »Ich kann mir die seltsamen und wunderbaren Dinge kaum vorstellen, die du sehen wirst.« Gestern abend warf die untergehende Sonne den Schatten eines Felsenturmes hoch über mir an die Wand, es sah aus wie meine eigene, ins Riesenhafte gesteigerte Silhouette. Heute morgen nun finde ich einen ebenmäßig runden Felsen, der aufgebrochen ist wie ein sauber geteilter Apfel, und mitten in dem Spalt liegt eine steinerne Kugel, von den Elementen und Naturkräften so genau in die Mitte gesetzt wie ein Heiligenbild auf den Altar. Mit Ehrfurcht gedenke ich der wilden, mörderischen und doch herrlichen Gewalten des Kosmos.
Wo der Bergbach sich in einer tiefen Kehre von Osten nach Westen wirft und sich immer tiefer in seine Schlucht hineinfrißt, überquere ich das schäumende Wasser auf einer Brücke und laufe in langen Sätzen weiter bergabwärts, getragen von einer Welle des Frohsinns und der Dankbarkeit. Mein Leben und meine Arbeit, meine Kinder, Liebesbeziehungen und Freundschaften in Vergangenheit und Gegenwart, alles erscheint mir herrlich und voller Wunder.
Auf einem Bergvorsprung über den Flußklippen steht die Yakherde, die mich gestern vor dem Paß überholt hat. Ein Stück weiter unten ist Wald, richtiger Wald, und ich sehe jede einzelne Birke und Föhre mit Staunen. Und immer noch geht es steil abwärts, als sich der Canyon schon zu einem weiten Tal geöffnet hat und zu den Zedern und Föhren der oberen Baumgrenze sich Fichten und Rottannen gesellen. Schließlich kommt der Ort Murwa in Sicht, tief unten im Morgenschatten der Berge.
277
Hier in Murwa gibt es wieder Krähen anstatt Raben, denn Murwa liegt 1200 Meter tiefer als Shey. Die Ansiedlung ist genau so malerisch, wie ich sie in Erinnerung habe, eine Gruppe gut gehaltener Bauernhäuser mit festen Steinmauern vor der großen Felswand im Nordwesten, die den Phoksumdo-See aufstaut.
Um den kranken Dawa zu schonen und da wir uns nach drei hohen Pässen in vier Tagen auch recht angeschlagen fühlen, beschließen wir, für den Rest des Tages in Murwa zu bleiben, wo wir unser Lager neben einem verlassenen Bauernhof bei einem Tannenwäldchen aufschlagen. Drüben in einem Pferch erkennen wir die seltsam bunten Zelte einer japanischen Bergsteigergruppe, die von einer Besteigung des Kanjiroba zurückgekehrt ist. Die roten Zelte erwecken widersprüchliche Gefühle – die Rückkehr in das zwanzigste Jahrhundert geschieht zu rasch. Trotzdem ist es ein Glück, daß wir die Japaner hier finden, denn der Leiter der Expedition ist ein Arzt. Ohne diesen unglaublichen Zufall hätte Dawa vor Jumla keine Hilfe erhalten. Er ist zu apathisch, um sein Glück zu begreifen, aber Tukten weiß es zu schätzen. »Nepalesische Doktoren«, sagt er geringschätzig und zuckt die Achseln: Alle guten nepalesischen Ärzte gehen ins Ausland. Unser freundlicher Wohltäter nimmt sich Dawa gründlich vor und gibt ihm ein Fläschchen mit blauen Pillen, die wir Dawa viermal täglich einflößen sollen. Nach Ansicht des Arztes hat er eine sehr ansteckende Dysenterie, und so bekommen auch wir anderen Pillen als vorbeugende Maßnahmen; von einer Bezahlung will er nichts wissen. Daß Dawa uns alle bisher nicht mit seiner Krankheit angesteckt hat, grenzt bei den primitiven hygienischen Verhältnissen des Lagerlebens an ein Wunder. Ich habe mir längst abgewöhnt zuzusehen, wie unsere Nahrung zubereitet wird und wie die Hände, die sie berühren, aussehen, denn meine eigenen wären auch nicht sauberer. Es ist eine Ironie des Schicksals, daß die Krankheit ausgerechnet Dawa, den saubersten der Sherpa, erwischt hat, den einzigen, den ich je baden sah.
Aus den Karten der Expeditionsteilnehmer und von Anu, ihrem Sherpa-Führer (der übrigens ein Bekannter von Tukten ist), erfahre ich, daß der Kanjiroba-Gipfel mit dem steilen Gletscher – der wie ein gefrorener Wasserfall aussieht und den ich vom Höhlenlager und später vom Gipfel des Somdoberges aus bewundert 278habe – Kang Jeralba genannt wird, »Schnee von Jeralba«. Der eigentliche Kanjiroba liegt weiter westlich über dem Phoksumdo-Fluß. Obwohl es die zweite Besteigung des über 7000 Meter hohen Kanjiroba war, haben die Japaner eine neue Aufstiegsroute gewählt und können daher mit Recht von einer Erstbezwingung sprechen.
Über die Namen und die Lage der Pässe, die wir überquert haben, gibt die Karte nur ungenaue Auskünfte. Wo der von mir so genannte »Namod-Paß« sein sollte, ist ein Paß namens Lang-mu Shey oder »Langer Paß in der Shey-Gegend« eingetragen, eine Beschreibung, die eher auf den Paß zwischen Shey und Saldang zutrifft. Der gestern bewältigte Paß ist richtig eingetragen, er heißt Bugu La und ist mit 5050 Meter ausgezeichnet. Wie Sherpa Anu erzählt, erinnert der Name »Bugu« an den Kampf zwischen einem Berggott – vielleicht Nurpu? – und einem Dämon; dem Gott gelang es schließlich, seinen Widersacher bei Murwa zu überwältigen und in der Flußschnelle unterhalb der Fälle zu ertränken.
Ich bin den Bergsteigern sehr dankbar, dennoch empfinde ich die bunten Zelte und fremden Gesichter ebensosehr wie die in Shey erhaltene Post als eine Störung, meine Hochstimmung vom oberen Murwa-Tal schwindet dahin. Die Sonne kommt erst am späten Morgen hinter den Bergen hervor und verschwindet rasch wieder, die Welt ist dunkel und kalt. Noch vor zwei Stunden hätte ich es als wundersam erfahren, daß die Sonne dieses Zelt nicht erreicht, in dem ein Sonnenanbeter so sehnlich auf ihre Wärme wartet, um sich waschen zu können. Jetzt ärgere ich mich nur noch darüber, und diese Dummheit ärgert mich noch mehr: habe ich denn gar nichts gelernt? Tukten sieht mich mit seinem unerschütterlichen Blick an, den ich kühl erwidere. Die irrsinnige Freude, die Entrückung, die mich gestern beim Abstieg meinen ließ, ich könnte jeden Moment aus meiner Haut springen, die Schwerkraft überwinden, wie in letzter Zeit so oft in meinen Träumen – war das nicht mehr als schiere Erleichterung darüber, daß der letzte hohe Paß hinter meinem Rücken lag? Wenn es das war, dann wäre es eher traurig gewesen, auf diese Weise das Ende der kostbaren Tage in Shey zu feiern. Vielleicht bin ich zu früh aufgebrochen und habe eine große Chance vertan, vielleicht 279hätte der Schneeleopard sich doch noch gezeigt, wenn ich bis zum Dezember geblieben wäre. Solche Zweifel deprimieren mich zutiefst. Aus Sorge um die Zukunft beraube ich mich immer wieder der Gegenwart, durch Flucht entziehe ich mich der wahren Freiheit.
Mit meinem Tagebuch und einigen Tschapatis verziehe ich mich in ein immergrünes Gehölz über den Klippen des Suli Gad und kehre der Menschheit den Rücken zu. Nicht als ob ich in letzter Zeit zu viel geredet hätte, denn Tukten spricht als einziger ein wenig Englisch und unsere gemeinsamen Themen sind längst erschöpft, außerdem verstehen wir uns ohne Worte viel besser. Auch ein Japaner spricht etwas Englisch, aber keiner von uns beiden ist zum Reden aufgelegt. Diese Bergsteiger müssen ebensowenig davon erbaut sein wie ich, in dieser einsamen Gegend Fremde anzutreffen.
Das schwer herabrauschende Wasser, die hellen Gipfel, der Einklang der braunen Häuser aus verwitterten Steinen tun mir wohl.
Ich sitze auf einem sonnigen Moospolster im Windschatten und fühle mich weitaus besser. Der Phoksumdo-Damm über den Fällen schiebt sich wie ein Riegel vor den Himmel. Dort oben hat mir ein kleines Mädchen vor einem Monat ein Stück Käse gegeben, und Männer auf silberbeschlagenen Sätteln haben mir zugerufen, der Schnee wäre zu tief, um den Kang-La zu bewältigen.
Schon früh am Nachmittag verschwindet die Sonne hinter den Felsen. Steif vor Kälte stehe ich auf und gehe zum Lager zurück. Die Felder sind abgeerntet, hie und da stehen dickvermummte Gestalten auf dem Weg, als warteten sie auf den Winter. Der Wind fährt so eisig und mit solcher Gewalt über die staubigen Flächen, daß ich mit meinem Zelt in einen leeren Schuppen neben dem verlassenen Bauernhof umziehe. Dann kommt eine Gruppe wilder Gestalten aus dem Norden vom Bugu La herab. Die Leute nehmen das leere Haus in Beschlag und treiben ihr Dzo in den Stall hinter meinem Zelt; dabei bringen sie es fertig, die meisten meiner Zeltpflöcke aus dem Boden zu reißen. Den größten Teil der Nacht liege ich wach und zerbreche mir den Kopf darüber, was für hartes Zeug das Tier wohl wiederkäut.
Die Leute von Murwa klagen über einen »Tiger«, der vorige 280Nacht ein junges Yak gerissen habe. Morgen werde ich das Land der Schneegipfel verlassen und dem Suli Gad flußabwärts folgen. Damit schwindet auch meine letzte Hoffnung, noch einen Schneeleoparden zu erblicken.
Erfrischt wache ich auf und lausche eine Weile dem Tosen der Wasserfälle. Dawa geht es bereits besser, ich höre ihn singen. Als ich bei Tagesanbruch das Lager verlassen will, überreicht Karma mir ein Geschenk, einen Fichtenstock, den er gestern als Überraschung für mich geschnitten hat. Seine Freude über die eigene Großzügigkeit ist so ansteckend, daß ich laut lachen muß. Tende wärmt den Hintern von Chiring Lamo über dem Feuer, auf dem Tukten das Nackenstück des gestern vom Schneeleoparden getöteten Yaks kocht. Wie immer hat er auch hier Freunde gefunden und konnte ihnen das Fleisch abkaufen. Tukten ist als Mädchen für alles auf diesem Teil der Reise auch unser Koch. Ich habe ihm versprochen, ihn wie einen Sherpaführer zu bezahlen, vorausgesetzt, daß er Dawa gegenüber den Mund hält.
Vor der Stupa von Murwa lege ich die bisher gesammelten Gebetssteine auf die Wand, aus dem plötzlichen Gefühl heraus, daß sie in Dolpo bleiben sollten. Offiziell gehört das ganze Tal des Suli Gad zu Dolpo, wie Dolpo geopolitisch zu Nepal gehört. Und doch werde ich hier am Fluß, unter den Schneegipfeln und den vom Zaubersee herunterdonnernden Wasserfällen von einer Welt in eine andere eintreten.
Und obwohl ich noch hier bin, habe ich den Ort innerlich längst verlassen. In Rohagaon, dem nächsten Dorf nach Süden, gibt es keine Gebetswände mehr, und Gott Masta tritt an die Stelle von Nurpu; hinter Rohagaon folgen die Hindudörfer im Bheri-Tal, wo die ersten Wohlgerüche des Hindu-Räucherwerks aus der Ebene der großen Ganga aufsteigen, die alles Geraune von Sh'ang Sh'ung mit sich fortträgt bis ins Meer.
Der Winter hat das Aussehen des Suli-Canyon völlig verändert. Wo noch vor kurzem Beeren leuchteten, hängen jetzt nur noch wenige dürre Blätter wie vom Wind vergessen an den trockenen 281Zweigen, und die grünen Flechten auf den Steinen haben eine goldene Farbe bekommen. Das Lager des Mondbären ist herabgerissen worden, vermutlich als Feuerholz. Mit dem Laubfall zeigen sich die von der versuchten Brandrodung geschwärzten Canyonwände.
Die herbstlich melancholische Stimmung erinnert mich an die Jahre in Frankreich, als ich dort noch mit meiner ersten Frau lebte. Eines Tages lernte ich in Paris Deborah Love kennen, die zehn Jahre später meine Frau wurde. Beide Frauen, lebensvolle, frohe Geschöpfe, haben mich, wenn auch auf verschiedene Weise, verlassen. Ich verscheuche die alten Bilder und eile mit dem Fluß weiter.
Mein ganzes Leben lang bin ich zwischen diesen dunklen Wänden entlanggeeilt, über denen hoch droben die Sonne hinwegzieht, die Stimme vom dumpfen Getöse des Wassers übertönt. Fluß und Leben rinnen unter der gnadenlosen Sonne davon, weshalb habe ich es so eilig?
In einem eisigen Rinnsal wasche ich den Staub von Murwa ab, putze mir die Zähne und stecke eine Feder der Felsentaube an meine Mütze. Weiter vorne ist die Suli-Schlucht wieder tief und dunkel, zu dieser Jahreszeit muß es Stellen darin geben, die nie von der Sonne erreicht werden.
Gegen Mittag steigt der Pfad aus der Schlucht auf den Bergrücken hinauf. Als ich mich an dieser Stelle im Oktober umwandte und auf die Eisgipfel hinter mir blickte, dünkte mich die Aussicht eine der schönsten meines Lebens und ich glaubte, sie auf dem Rückweg, langsam den Berg hinabschreitend, noch mehr genießen zu können. Statt dessen treibt es mich vorwärts und ich beschleunige meine Schritte. Auch die schmalen Pfade bremsen mein Tempo nicht mehr, ich bin inzwischen Schlimmeres gewohnt. Immer weiter wandere ich aus dem frühen Winter in den späten Herbst zurück, tief unten am Fluß sehe ich den ersten grünen Bambus.
Auf einer kleinen Wiese hoch über dem Fluß esse ich eines von Tuktens schwärzlichen »Broten« und gehe bald wieder weiter. Vielleicht wäre es besser, wenn ich auf die anderen wartete, aber ich kann nicht warten. Ich gehe und gehe, berauscht von dem Sauerstoffreichtum niedriger Höhen, auf und ab über die steinigen 282Pfade, die zum Fluß hinab, die steile Wand des Canyon hinan und wieder hinab führen. Ich komme an de windigen Höhle vorbei, der umgekehrte Wasserfall ist noch da, aber der steinerne Dämon, den ich im Dunst sah – es war bestimmt der Dämon, den der Gott vom Bugu La bezwungen und in die Schlucht des Suli Gad geworfen hat -, ist im veränderten Licht nicht mehr zu sehen. Ich glaubte, mich genau der Stelle zu erinnern, aber der Stein ist einfach nicht mehr da.
Unten im Wald lagern Hirten um ihre Feuer; neben einer Hütte ist ein großer Pferch angelegt, in dem sich Yaks, Hunde, Ziegen und menschliche Wesen in rauhen Tierhäuten tummeln. Einige der dunkelhäutigen Männer sitzen bis zum Gürtel nackt im kalten Wind, ringsum sind Wollballen im Halbkreis aufgehäuft. Einer der Männer winkt mir heftig zu, er zeigt auf mich und ruft: »Shey Gompa!« Man bedeutet mir, zu bleiben, ich folge der Einladung und sehe mir neugierig das Lager an, immer respektvollen Abstand von den Hunden haltend. Es ist schon Nachmittag, die Sonne ist längst hinter die Berge getaucht, und da Tukten und die anderen ausbleiben, wäre es sicher am besten, ich würde hier bei den Hirten und Wollhändlern bleiben. Aber ich habe keine Ruhe, ich kann nicht still hier unten in der Schlucht sitzen, solange die Sonne noch auf den Weg oben am Hang scheint. Unvermittelt stehe ich auf und gehe ohne Abschied weiter nach Süden, wobei mir die dunklen Tatarengesichter unbewegt nachschauen.
An dem einzigen Bach, der diesen trockenen Abhang durchzieht, liegt eine kleine Wiese, auf der man lagern könnte. Eigentlich hatte ich damit gerechnet, daß Tukten mich im Laufe des Nachmittags einholen würde. Aber er ist nicht da, und außerdem wimmelt es auf der Wiese bereits von Tieren und Menschen. So trinke ich nur von dem kalten Wasser und eile weiter. Was mag geschehen sein? Hat Dawas Zustand sich wieder verschlechtert, so daß er nicht marschieren kann? Ist die kleine Chiring Lamo ins Feuer gefallen? Hat Tukten doch alle Warnungen über seinen zweifelhaften Charakter gerechtfertigt und hat sich mit meinem Gepäck über die Berge nach Indien davongemacht? Ich trage meine Notizen, das Fernglas, den Schlafsack und einmal Wäsche zum Wechseln bei mir, soll er mit dem übrigen glücklich werden!
283
Doch langsam wird es spät, ich habe nichts zu essen und auch kein Brennmaterial, außerdem gibt es keinen geeigneten Platz, um ein Feuer zu machen und zu lagern; hier ist nur der enge Steig in der Bergwand, über die der kalte Wind hinwegstreicht. Ich muß bis Rohagaon weiter, das ich erst in tiefer Nacht erreichen kann. Gestern habe ich das Marihuana-Päckchen aus Yamarkhar weggeworfen in dem Glauben, daß ich es ohnehin nicht mehr brauche; heute, erschöpft von zehn Stunden Marschierens an den steilen Flanken der Suli-Gad-Schlucht, steht mir zum erstenmal der Sinn danach, vor allem da mir vor den finsteren Bewohnern und den Hunden von Rohagaon graut. Kurz nachdem die Sehnsucht nach Cannabis mich überfallen hat, sehe ich eine kleine verdorrte Pflanze am Wegrand, die ich pflücke und allmählich zerkaue. Gestärkt ziehe ich weiter, und als nach einer Stunde die dem Masta gewidmete Steinpyramide auf einem Bergvorsprung auftaucht, bin ich in der richtigen Stimmung für das düstere Loch von Rohagaon; meinen neuen Stab fest in der Hand, bin ich bereit, es mit Räubern und Hunden aufzunehmen.
Wie sich erweist, liegen die Hunde noch an der Kette, aber die Schulhütte, in der ich unterzukommen hoffte, ist bereits von einem Wollhändler besetzt, der wenig begeistert ist von dem Gedanken, sie mit mir zu teilen. Auf den Dächern versammeln sich die Dorfbewohner, die Kinder verstummen, und alle schauen auf mich herab, als würden sie gleich ein fürchterliches Urteil über mich fällen. Was ist das für ein großer Ausländer, der in der Dunkelheit ohne Träger aus den Bergen herunterkommt? Denn in der Dunkelheit erkennen sie mich nicht wieder. »Aloo, Aloo!« rufe ich und mache eine Gebärde des Essens, damit sie in mir einen Vertreter des menschlichen Geschlechtes und keinen Dämon sehen. Nach einer Weile verstehen sie, daß ich versuche, »Kartoffeln« zu sagen. Nein, Aloo gibt es nicht, wohl aber kleine Anda von den Hühnern dort drüben. Ein dreckverkrusteter Mann mit triefenden Augen brät sie mir in einer Pfanne, die seine Frau schnell zuvor mit ihrer schmutzigen Schürze ausgewischt hat. Der freundliche japanische Arzt mit seiner Warnung fällt mir ein, ohne Ausnahme nur gut abgekochte Speisen und Getränke zu genießen, und ich hoffe, daß ich inzwischen so viele Bakterien aufgenommen habe, daß ich dagegen immun geworden 284bin. Ein anderer Dörfler schleppt mich in seine dunkle Kate und bringt mich dazu, ihm einen Messingbecher von seinem Schnaps abzukaufen, der wie rosa Benzin aussieht und riecht; dieses Zeug, denke ich mir, desinfiziert vielleicht die Eier. Mein Gastgeber ist der Schulmeister des Dorfes; er nennt mich »mein lieber Bruder«, eine Hindusitte, die er im Tiefland aufgeschnappt hat. Er probiert auch seine anderen Englisch-Brocken aus; mit dem Hintergedanken an ein Nachtlager preise ich sein Sprachtalent überschwenglich, und tatsächlich, ich bekomme, was ich mir wünsche. In Sicherheit vor den Hunden und der kalten Nacht lege ich mich auf mein Lager zurück, den Bauch voller Anda, Cannabis und rosa Feuerwasser, einem Gefühl von Glückseligkeit so nahe, daß ich mich frage: Warum, zum Teufel, plagst du dich so mit dem Meditieren ab? Irgend jemand hat einmal gesagt, Gott lasse dem Menschen die Wahl zwischen Bequemlichkeit und Wahrheit, beides zusammen könne er nicht haben. Kaum habe ich mich für ein Leben der Bequemlichkeit entschieden, als die Hunde einen fürchterlichen Lärm anstimmen und alle Leute hinauseilen.
Der treue Tukten ist im Stockdunkel angekommen, über Wege, die ich nicht einmal bei Tageslicht gern gegangen bin. Dawa und die anderen kämen gleich nach, versichert er, und so ist es auch. Bald tauchen die ewig lächelnden Gesichter auf, nur Chiring Lamo weint vor Müdigkeit. Tukten, der nach einer Unterkunft, Wasser und Brennstoff Ausschau hält, ist mit der Familie von Triefauge handelseinig geworden, und bald sitzen wir um deren Feuerstelle. Fast atemlos vor Faszination beobachte ich die Frau von Triefauge beim Kochen, einem Ritual von unglaublicher Einfachheit und Sicherheit der Bewegungen. Der Mann muß eine schmerzhafte Augenentzündung haben, denn er liegt abseits vom Feuer an einer Wand und stiert finster vor sich hin. Die in schwarze Lumpen gehüllte Frau hantiert langsam und bestimmt mit dem brennenden Reisig, um Tsampa und Kürbisbrei zu bereiten – das Brotmachen, das Gemurmel, die Liebe wie das Essen, die sie ohne überflüssige Worte und Bewegungen an die Kinder austeilt, die zärtliche Fürsorge für den kranken Mann, all das hat die Ruhe und Würde eines Sakraments. Vorhin hat Triefauge seine Frau wüst beschimpft und ihr meine Rupiennoten 285ins Gesicht geworfen, um sich vor den Dorfgenossen aufzuspielen, jetzt läßt er sich, vor Schmerzen kleinlaut und geduldig, von seiner Frau in eine Decke wickeln. Erst bei näherem Hinsehen erkennt man unter all dem Schmutz und den Lumpen, wie jung sie noch ist, zuerst hatte ich sie für eine alte Frau gehalten. Sie ißt nur das, was die Kinder übriggelassen haben, und legt sich dann auf eine Matte neben ihren Mann zum Schlafen hin. Die Familie benimmt sich, als wäre ich mit meiner großen, ungewohnten Gestalt nicht vorhanden, obwohl ich stumm und reglos wie ein Buddha neben dem Feuer sitze. Die Kinder sehen mich an, als schauten sie durch mich hindurch; vielleicht bin ich doch noch unsichtbar geworden.
Diese Nacht habe ich im Flur des Hauses auf einem weichen Bett aus fingerdickem Staub geschlafen. Der verrückte Hund von Rohagaon draußen an der Kette bellte wiederum die ganze Nacht, diesmal jedoch vergebens, denn ich war zu müde, um mich darüber aufzuregen. Nur als er mich das erstemal aufweckte, ging ich hinaus und drohte ihm mit dem Stock. Das stachelte ihn zu einer schäumenden Wut an, in der er fast die Kette aus der Wand riß. In meiner Trunkenheit pinkelte ich ihn an und rächte mich damit für den fürchterlichen Lärm in jener Oktobernacht und auch in dieser. Im Hochgefühl dieser feigen Tat, begangen im Licht des abnehmenden Mondes, legte ich mich voller Seelenfrieden und Befriedigung wieder zur Ruhe.
Bei Tagesanbruch höre ich die Familie durch die dünne Lehmwand gähnen und seufzen, und bald stolpert der Familienvater hinaus in den Hof, wo er sich räuspert, spuckt und seine Blase entleert. Bald darauf geht seine Frau zum Wasserholen ein Stück den Berg hinauf. Vielleicht hockt sie sich auch irgendwo an den Rand des Pfades und schaut dabei hinüber zu den Schneegipfeln südlich des Bheri, die im Morgenlicht aufglimmen. Wer weiß, was für weltverlorene Gedanken ihr dabei durch den Kopf ziehen?
Schon vor Sonnenaufgang wird es wärmer, kaum kann ich noch meinen Atem in der Bergluft sehen. Ein Schwarm Felsentauben 286verläßt seinen Schlafplatz in einer Schlucht unter Rohagaon; in der Morgensonne über dem Tal blitzen die Flügel blausilbern auf.
Es geht am Felsen vorbei, wo die Tamang auf dem Hinweg kleine Walnüsse knackten, dann auch am Nußbaumwäldchen, das jetzt kahl dasteht. Das warme Gelb und der Humusgeruch sind verschwunden. Der Bach, der durch den Wald fließt und der vor einem Monat fast von den Blättern erstickt wurde, springt nun ungehindert zum Suli hinab. Zurück bleibt die stille Versammlung grauer Baumstämme, verblaßter Moose und verwehter Blätter, in denen kleine Wintervögel zwitschernd herumhüpfen. Aber weiter unten im Tal herrscht Geschäftigkeit, wo uns im Frühherbst die leeren Fenster des verlassenen Dorfes entgegenstarrten: Menschenstimmen, Hundebellen, Hähnekrähen schallt herauf, denn die Berghänge dienen den Yaks aus dem Norden als Winterweide.
Im Dorf biegt ein kleiner Seitenpfad von der Hauptroute nach Süden ab und führt durch Felsengeröll und Olivenhaine hinunter zu einer Brücke am grünen Fluß. Die geschnitzten Brückenpfosten stellen groteske, gelb und rot bemalte Figuren dar. In der heißen Mittagssonne auf der Brücke warte ich auf meine Gefährten, und wieder befällt mich diese unerklärliche Verzweiflung. In diesem Fluß fließen die Wasser vom Kang-La, die Wildwasser vom Bugu-La und von jenem Bön-Dorf bei Pung-mo. Im Suli Gad ist das Türkis des Phoksumdo-Sees und das demantenfunkelnde Blau des Kang-La.
Eine Stunde vergeht, aber niemand kommt. Wütend gehe ich allein über die Brücke und klettere das Steilufer an der anderen Seite hinauf. Etwa einen Kilometer weiter verschwindet das jadefarbene Wasser der Schneegipfel in den grauen Strudeln des Bheri-Flusses, der sie in den Schlamm des Südens hinunterträgt.
Der Pfad folgt nun dem Bheri nach Westen, dabei jedoch allmählich von der Talsohle zur Anhöhe aufsteigend, wo das Dörfchen Roman mitten in einem Zedernwald liegt. Ein böiger Wind peitscht die ärmlichen Lumpen über den Kultbauten, die Dorfbrunnen sind rotbemalte Figuren mit phallischen Wasserspeiern, und westlich des Dorfes ragen hohe Steinhaufen und große rote Pfosten auf. Aus einem Feld unter mir schaut eine Affenhorde 287herauf, die Tiere haben einen langen Ringelschwanz, und ihre Köpfe glänzen rötlich im Schein der untergehenden Sonne.
Ich habe Kopfschmerzen und fühle mich äußerst seltsam. Den ganzen Tag lang hat mich die Trägheit meiner Reisegefährten geärgert, auf die ich vergeblich an der Brücke gewartet habe. Wie damals in Murwa, als die Sonne mein Zelt nicht wärmte und ich nicht baden konnte, packt mich sinnlose Wut. Hat mich denn alle meine Ausgeglichenheit, dazu mein Sinn für Humor gänzlich verlassen, daß ich mich so aufführe – oder ist es lediglich die Angst vor der Rückkehr zum Leben in den Niederungen?
Auf meinem Weg über die Hügel am Bheri erinnere ich mich, wie vorsichtig man nach der Zurückgezogenheit einer einwöchigen Zen-Übung sein muß, um nicht zu viel zu sprechen und sich nicht zu rasch zu bewegen, ähnlich vorsichtig wie beim Herunterkommen von einem durch Halluzinogene bewirkten »high«. Es ist wichtig, langsam aus einer solchen Metamorphose hervorzukommen, wie ein Schmetterling, der zuerst still seine neuen Flügel in der Sonne trocknet, damit der luzide Geisteszustand nicht plötzlich zerbricht. Es waren sehr stille Tage dort oben in den Bergen und auch eine Art halluzinatorischer, innerer Reise – und dann dieser plötzliche Abstieg. Was auch immer der Grund sein mag, ich komme zu schnell herunter – zu schnell für was? Und wenn ich zu schnell herunterkomme, warum beeile ich mich dann so? Statt meine große Reise zu feiern, fühle ich mich verstümmelt, mörderisch: in mir wüten dunkle Energien, und ich habe keine Gewalt über meine schlechte Laune.
Und als dann später am Abend ein Hindu aus Roman die kleinen Kinder beiseite stoßend seinen grindigen Kopf in mein Zelt steckt, sich mit blöder Ungläubigkeit umsieht und mir aus einem stinkenden Mund mit fauligen Lippen unverständliche Fragen entgegenschreit, stürze ich mich auf ihn, schubse ihn mit brachialer Gewalt aus dem Zelt und schlage die Zeltklappe zu, wobei ich ebenso unverständlich schreie: Nein, ich habe die Medizin nicht, die er braucht, und es gibt sowieso keine Heilung für ihn, keine Heilung für mich. Wie soll der arme, stinkende Bursche auch wissen, daß es nicht seine Unverfrorenheit ist, die mich erzürnt, nicht der Eiter und der faulige Atem – es ist sein Fleisch und 288Blut, das sich nicht von dem meinen unterscheidet. In seiner verfluchten Not erinnert er mich an unser gemeinsames Elend, diesen Sumpf des Verlangens, in den ich nach meinem mißglückten Sprung wieder zurückfalle.
»Erwarte nichts«, hatte Eido Roshi mich bei der Abreise gewarnt. Und ich hatte geglaubt, ich könne unbelastet wunschlos im Licht und im Schweigen des Himalaja wandern, ohne den Ehrgeiz, etwas zu erlangen. Jetzt bin ich ausgelaugt. Der Weg, dem ich atemlos gefolgt bin, verliert sich im Gestein. Vor lauter geistigem Streben habe ich meine Kinder vernachlässigt und mir selbst nur Schaden zugefügt; und einen Weg zurück gibt es nicht. Es hat sich auch nichts geändert, ich bin immer noch dasselbe Ich, besessen von den alten Gelüsten und Leidenschaften, der ewige Nörgler über unbedeutende Widerwärtigkeiten, immer noch klafft die Lücke zwischen dem, was ich weiß, und dem, was ich bin. Ich habe mich dem Fluß der Dinge entzogen und bin fehlgegangen. Trotz der Euphorie der Herrlichkeit und dem »Erfolg« der Reise zum Kristall-Berg wurde eine große Gelegenheit versäumt, ich habe versagt. Gut, ich werde das Spiel meiner Vaterschaft, meiner Arbeit, meiner Freundschaften und meiner Zen-Praxis spielen, aber alle Hoffnungen, Taten und Reisen haben zu nichts geführt. Ich habe nichts mehr zu erwarten.
Heute wollen Karma und seine Familie noch bis Tibrikot den gleichen Weg gehen wie wir und von dort aus der Handelsroute dem Bheri entlang nach Süden folgen. Im leichten Frühnebel der Vorgebirge höre ich Karma singen, gestern abend hat er zum erstenmal seit dem Tanz in Saldang auf seiner Laute gespielt. Da ich wieder vorgehe, nehme ich schon hier von dem freundlichen Minnesänger Abschied und winke auch Tende, die nackt mit Chiring Lamo zwischen warmen Schaffellen liegt und sich auf unschuldige Weise entblößt, um mir zurückzuwinken.
Über Raka lag schon die Winterstarre, in Murwa stand der Winter gerade bevor, in Rohagaon war es Spätherbst, und nun 289stehen hier, im Tal nach Tibrikot, die Walnußbäume noch in vollem Laub, grüne Farne ziehen sich am Ufer entlang, ein Wiedehopf zeigt sich, und in der warmen Luft flitzen Schwalben und gaukeln Schmetterlinge. So reise ich gegen die Zeit in das müde Licht des scheidenden Sommers hinein.
Da sie nicht mehr auf Karma und seine Familie warten müssen, holen mich die Sherpa kurz vor Tibrikot ein, das auf der Ost-West-Route zwischen Tarakot und Jumla liegt und das große Handelszentrum dieser Gegend sein soll. Auf einer Anhöhe über dem Flußtal steht ein großer roter Hindu-Tempel, denn die Brahmanen und Chetris sind bis zu dieser mächtigen Flußbiegung den Bheri aufwärts gewandert und haben sich hier niedergelassen. Zwei kleine Hindu-Dukhan nebeneinander sind die ersten Geschäfte, die ich seit Pokhara sehe. Wir kaufen das Allernotwendigste ein: Salz, Zucker, Zündhölzer und Seife, aber da keiner der Läden Kerzen, Kerosin oder Taschenlampenbatterien führt, werden wir auch ferner die Abende im Dunkeln verbringen müssen. Auch Reis und Mehl ist nicht zu haben, so daß wir bei unserer Linsenkost bleiben müssen mit ein paar Aloo oder Anda, falls wir sie unterwegs ergattern können. In Tibrikot gibt es so wenig zu kaufen, daß wir das große Handelszentrum in wenigen Minuten erledigt haben. Wir schlagen die Westroute nach Jumla ein, entlang dem Balansuro-Fluß, auf der wir mit einem langsamen Anstieg wieder in die Gebirgswelt zurückgelangen. Bis Jumla müssen wir zwei Pässe überqueren, die aber, wie Tukten behauptet, niedrig sind, so daß wir keine Schwierigkeiten erwarten. Nach Norden zweigt ein Weg über die Berge zum Bön-Dorf Pung-mo überhalb des Phoksumdo ab, doch ist er schon vom Winterschnee versperrt.
Ist heute Erntedankfest?
Eingedenk meiner ersten Depressionen beim Abstieg von Tarakot zum Bheri-Canyon bin ich zu der Überzeugung gekommen, daß der Hauptgrund für meine Stimmungsschwankungen im plötzlichen Höhenverlust zu suchen ist. Eine Änderung, ein schmerzvoller Wachstumsprozeß hat eingesetzt, der Häutung einer Schlange vergleichbar – lustlos, reizbar, ohne Appetit ziehe ich die alten Fetzen meines früheren Lebens hinter mir her, den Blick getrübt durch die alten Hautfetzen vor dem neuen Auge. 290Es ist schwer, sich zurechtzufinden, da ich nicht weiß, wer sich zurechtfinden soll, ich bin nicht mehr die alte Person und noch nicht die neue.
Und schon beginnen das Nichts-mehr-Erwarten, die Hoffnungslosigkeit einen seltsamen Reiz zu haben, es ist, als käme ich dem Geheimnis der Berge endlich näher. Nun, wo die Vergangenheit zerronnen und die Zukunft ohne Sinn und Ziel ist, wo ich alle Erwartungen aufgegeben habe, beginne ich die Bedeutung des Jetzt zu erfassen, von dem alle großen Meister sprechen.
Der verwässerte Jesus der modernen Bibelübersetzungen macht dem reuigen Sünder Hoffnung auf das Himmelreich: »Heute wirst du mit mir im Paradiese sein.« Aber in den älteren Übersetzungen fehlt das Wort »heute«, wie Soen Roshi betont, von Zukunft ist nicht die Rede. In der russischen Übersetzung zum Beispiel heißt es »jetzt und hier«. Jesus sagt also: »Genau jetzt bist du im Paradies.« Wieviel lebendiger ist das! Es gibt keine Hoffnung anderswo als in diesem Augenblick, in den karmischen Bedingungen, die dem eigenen Leben zugrundeliegen. Genau dieser Tag ist ein Aspekt des Nirvana, das sich nicht vom Samsara unterscheidet, er ist ein subtiler alchimistischer Prozeß, in dem der dunkle Schlamm sich in die reine weiße Blüte des Lotus verwandelt.
»Natürlich genieße ich das Leben! Es ist wunderbar! Besonders, da ich keine andere Wahl habe!«
Und vielleicht ist es das, was Tukten weiß: daß die Reise nach Dolpo, Schritt für Schritt und Tag für Tag, das Juwel im Herzen des Lotus ist, das Tao und der Weg, und zwar nicht mehr und nicht weniger als die kleinen Alltagserlebnisse zu Hause. Die Lehre, die Lama Tupjuk uns an jenem Tag anbot, als der Schneeleopard uns von den Felsen beobachtete und der Kristall-Berg am Himmel segelte, war nicht, wie ich damals dachte, die erleuchtete Weisheit eines einzelnen, sondern ein großartiger Ausdruck des Göttlichen in der gesamten Menschheit.
Wieder klettern wir dem Himmel entgegen, und mit jedem Schritt wird meine Laune besser. Ich schreite rasch voran, setze den Stock fest auf den Boden auf und lasse die trübseligen Gedanken hinter mir zurück; ich beginne zu lächeln, kann wieder 291über mich selbst lachen und nehme die Mißerfolge der Reise, wie ihre Wunder, dankbar an, ich nehme an, was mir auf meinem Weg auch noch begegnen wird. Zwar weiß ich, daß dieser Zustand der Transzendenz nicht lange anhalten wird, aber solange er dauert, tanze ich den Weg entlang, als sei ich endlich frei. Ich fühle mich wieder leicht, als wäre ich in den Schnee der Himmelsberge zurückgekehrt.
Das klare und stille Licht des Himalaja wird durch die Abwesenheit von Rauch und Geräuschen noch intensiviert. Die unzähligen, die Atmosphäre durchbohrenden Bergspitzen lassen ein himmlisches Licht durchscheinen, das Licht, das die Steine klingen läßt, die brausende Sonne, der Silberglanz, der in den Flechten und den Schwingen der Krähen wohnt, im Klingeln der Ponyglocken und im Geruch des Schnees.
Aber die Welt dreht sich, und das Silber bekommt einen irdischen Glanz. Es durchdringt kleine Gestalten hoch am Berghang, die Bauern ungewisser, von Dämonen bevölkerter Zeitalter, steife, zweibeinige Abbilder des Menschen, auf die stumpfsinnigen Bestien einschlagend, die den stumpfen Holzpflug vorwärtszerren. Ou-haa! Grunzend und schreiend wird der Mensch zur Bestie mit dem grausamen Ring durch die Nase, hin und her, hin und her, in dem harten Trott, der den Pflug durch den steinigen Boden zieht, Jahrhundert auf Jahrhundert. Eine Furche weiter eine gebeugte vierschrötige Bäuerin, die mit einer primitiven Hacke auf die Steine schlägt – Schritt, hacken, Schritt, hacken, Schritt, hacken …
Ou-haa!
Unterhalb des Weges drischt eine alte Frau in schwarzen Lumpen Gerste auf dem flachen Dach ihrer Hütte und läßt den Flegel rhythmisch durch die Luft sausen. Unter einem Nußbaum liegt wiederkäuend eine Kuh, ihre Glocke bleibt still.
Nun geht es durch eine Schlucht hinauf nach Kalibon, das, wie Tukten mir erzählt, vor vielen, vielen Jahren, schon lange bevor »Nepal und Tibet nicht mehr dasselbe waren«, von Khampas besetzt wurde. Zweifellos hat Tukten damit in einem gewissen Sinn recht, denn mit Khampas sind in diesem Fall nicht die räuberischen Nomaden, sondern Einwanderer aus Khams in Osttibet gemeint, die später als die Sherpa nach Nepal einwanderten 292und von diesen deshalb als sozial niedrigerstehend angesehen werden. Wie in den Hindu-Dörfern wollen diese Khampas sich nicht mit den lokalen Gottheiten anlegen und so ist ihre Stupa dem Gott Masta gewidmet. Die Khampas sind gastfreundliche, hilfsbereite Leute, von denen Tukten geschälte Walnüsse, grünes Buchweizenmehl und Kartoffeln ersteht, während ich mich in der Sonne wasche, Tee trinke und mich dann von den Dorfkindern auf einen Osthang führen lasse, von dem aus sich eine Aussicht auf das Dhaulagiri-Massiv bietet, so großartig, wie wir sie auf unserer Wanderung bisher noch nicht gehabt haben. Tukten, der mir nachgekommen ist, zeigt stolz auf den Churen Himal und den Großen Dhaulagiri, den die Bergsteiger Dhaulagiri I nennen, und zu dem Tukten eine Expedition begleitet hat. Der Nordwind bläst große Wolken Pulverschnee von den Gipfeln, es sieht aus, als stünden sie in Flammen. Von Kalibon aus kann man fast die Gegend des Jang-La sehen, wie weit entfernt erscheinen mir jetzt jene Tage, wie in einem anderen Leben.
Eine mondlose Nacht. Ich habe den Kopf zum Zelt hinausgesteckt und beobachte die Sterne, die am blauschwarzen Himmel funkelnd ihre Bahn ziehen. Obwohl ich acht Stunden geschlafen habe, bin ich morgens noch müde, sonst langen auch sechs Stunden Schlaf. Als Dawa mir den Tee bringt, bin ich nochmals eingeschlafen und fühle mich beim Aufstehen wie gerädert.
Nun, wo es Dawa wieder bessergeht, scheint er durch die Sonderbehandlung verwöhnt zu sein, zum erstenmal drückt er sich vor der Arbeit, wobei ihm die Gutmütigkeit Tuktens zupaß kommt. Seit Karma uns verlassen hat, trage ich den größten Teil meiner Sachen selber, das andere hat Tukten zusätzlich übernommen; obwohl er kleiner ist als Dawa und ich, hat er sich von mir nichts mehr abnehmen lassen und hat auch Dawa nicht darum gebeten. Von Anfang an hat dieser leopardenäugige Heilige schwerer getragen und ist besser marschiert als wir alle; nicht einmal habe ich ihn müde oder niedergeschlagen gesehen, und er hat auch nicht mit Verdrossenheit auf meine schlechte Laune der 293letzten Tage reagiert. Auch auf den steilsten Hängen weiß er für jeden ein freundliches Wort, seine weiche, tiefe Stimme ist beruhigend und wohltuend wie der Südwind, in dem ich jetzt wandere. Alle Pilger und Tiere sind seine Freunde und hören ihm aufmerksam zu, obwohl er nur selten spricht, wenn er nicht gefragt wird. Ohne sich vorzudrängen, ist er immer zur Hand, wenn er gebraucht wird, was er für selbstverständlich zu halten scheint.
Die Sonne erfüllt das Bheri-Tal mit einem zarten goldenen Dunst und wärmt mir den Rücken, als ich zwischen Rhododendron-Gehölzen und Eichen bergauf steige. Ein Junge mit einer himmelblauen Mütze überholt mich und ist schon wieder verschwunden. Er läßt ein sonderbares Gefühl zurück, das mich schaudern läßt – hoffentlich dreht er sich nicht um: Ich habe nie eine solche blaue Mütze besessen, ich habe sein Gesicht nicht gesehen, und doch ist dieser Junge, der unter den Bäumen verschwindet, genau dasselbe wie ich.
Der Paß ist nicht hoch, kaum 4000 Meter, nur hie und da liegt ein wenig Schnee. Ein stechender Schmerz fährt mir ins Knie, und als ich es zu schonen versuche, beginnen auch die anderen Gelenke zu schmerzen. Zu meiner großen Erleichterung ist der Abstieg an der anderen Seite des Passes einer der bequemsten Wege, die ich bislang in Nepal gegangen bin. Er führt am Waldsaum mehrerer Täler entlang, bis er auf einen scharfen Bergkamm hinausläuft. Dann allerdings geht es steil hinunter zu einem hübschen Dörfchen mit alten Gebetsmauern über einem Fluß. Diese warme Jahreszeit hat etwas Traumhaftes, so anders ist sie als die Herbsttage, die ich bisher erlebt habe. In den Bächen riecht es nach Froschlaich, in der Sonne nach Hühnerdreck, darüber liegt der Rauch eines Holzfeuers und der säuerliche Geruch vermodernder Blätter: altbekannte Gerüche aus meiner Kinderzeit, die mir ans Herz rühren.
Hinter einer Brücke geht es weiter nach Westen durch ein langgestrecktes, flaches Tal, das allmählich auf einen niederen Paß zustrebt, über dem die untergehende Sonne steht. Da ich hinke, haben Tukten und Dawa mich überholt. Ihre kleinen mit unförmigen Lasten bepackten Gestalten tauchen als dunkle Silhouetten in das Sonnenfeuer ein: wie Pilger am Himmelstor umgibt sie ein Lichtschein, sie brennen auf und verschwinden.
294
Auf meinen Stock gestützt bleibe ich stehen und wende mich nach Osten, um einen letzten Blick, vielleicht den letzten in meinem Leben, auf die großen Dhaulagiri-Gipfel und die Bheri-Region zu werfen. Dann überschreite ich ebenfalls die Paßhöhe und steige langsam in das Tal nach Sonrikot hinunter.
Von Sonrikot her kommt der Klang einer Trommel. Stark hinkend komme ich nur langsam voran, aber der oft begangene Weg ist breit und sicher, so daß ich auch bei Sternenlicht keine Probleme haben werde.
Als ich mich den dunklen Hütten nähere, wappne ich mich gegen den Angriff wilder Hunde. Aber dort erkenne ich die Umrisse von Tukten, er ist mir entgegengekommen, als mache er bloß einen kleinen Abendspaziergang.
»Good night, Sah«, murmelt er, nimmt mir das Gepäck ab und führt mich ins Dorf, wo er mein Zelt bereits auf einem Dach aufgeschlagen hat. Das letzte zähe Stück Fleisch vom Yak aus Murwa paßt ausgezeichnet zu dem Rübengemüse, das uns unsere Namu zusammen mit frischem Joghurt in einer Messingschale serviert.
Wie in Roman sind auch hier die Zeltnägel in das flache Lehmdach eines Hauses eingetrieben, wo mich die freundliche Atmosphäre von Gebetsfahnen, Kürbiskernen, Heizmaterial und zum Trocknen ausgebreiteten roten Pfefferschoten umgibt. Nur daß hier Fremde gern gesehen sind, darin unterscheidet sich das Bergdorf von Roman. Wie Tukten sagt, sind viele Leute aus dem Norden gekommen, um hier ihre Yaks auf die Weide zu treiben oder sie als Packtiere auf der Jumla-Route zu vermieten. Dies ist das letzte buddhistische Dorf auf unserer Reise, und selbst hier stirbt der Glaube schon aus, die Gebetswände sind alt, und offenbar hat seit Jahren niemand einen neuen Stein hinzugefügt. Wir leben ja auch im Kali Yuga, dem Dunklen Zeitalter, in dem alle großen Religionen der Menschheit im Niedergang begriffen sind.
295
Heute meiden meine Füße alle lockeren Steine, finden wie von selbst einen sicheren Halt, und ich verliere keine Energie durch Stolpereien. Mein Knie ist besser geworden, und durch Eichenwälder und Rhododendrongehölz gewinne ich rasch die Höhe eines Bergkammes mit einer großartigen Aussicht nach Westen. Auch dieser Paß dürfte, wie der gestrige, nicht über 4000 Meter hoch sein – bevor der Mensch hier Raubbau trieb, lag kein Paß auf der Jumla-Route oberhalb der Baumgrenze -, aber der Wind ist kalt, und der Pfad, der sich am Nordhang tief in unberührten Wald hinabwindet, ist vereist und glatt. Starker Harz- und Tannengeruch steigt aus den dichten Nadelwäldern, darunter mischt sich der mineralische Geruch schweren Humusbodens.
Vor uns, wo sich an einem Fluß das Walddickicht lichtet, stehen die Sherpa und deuten aufgeregt wie zwei Schulbuben auf etwas. Im schimmernden Wasser sitzt, auf dem grünen Moosbelag einer umgestürzten Kiefer, furchtlos ein Pelztier von der Größe eines Vielfraßes. Ich strahle ebenso wie die Sherpa. Der Rote Panda gehört zu den hübschesten Waldtieren des Himalaja, und dieser ist besonders leuchtend rot und schwarz gefärbt. Als das zerklüftete Gebiet des Suli Gad hinter uns lag, hatte ich schon alle Hoffnung aufgegeben, noch einen Panda zu Gesicht zu bekommen. Ich freue mich an dem Vergnügen, das die Sherpa an dem hübschen Geschöpf haben, der Panda hat das erste Lächeln auf Dawas Gesicht gezaubert seit dem Tanzabend in Saldang.
Das seltene Erlebnis hat uns einander nähergebracht. Plaudernd und lachend machen wir Pause und teilen uns ein Stück Brot; offenbar werden wir uns plötzlich der Tatsache bewußt, daß unsere gemeinsamen Tage zu Ende gehen, der letzte Paß liegt hinter uns, und bis Jumla sind es noch anderthalb leichte Tagesmärsche.
Heute nacht kampieren wir auf einer Birkeninsel im Zuwa-Fluß, da die Wände des Canyon so steil in den Fluß abfallen, daß man am Ufer kein Zelt aufschlagen kann. Die Luft ist feucht und bitterkalt, das Brausen des Flusses ist überwältigend, man hört kaum sein eigenes Wort. Leider hatte ich kurz zuvor den guten 296Rat Tuktens ausgeschlagen, in einer offenen Talsenke einige Kilometer zurück das Lager aufzuschlagen; dieser Fluß macht mich ruhelos, und so habe ich Tukten angeraunzt, wir kämen morgen nie nach Jumla, wenn wir schon so früh am Nachmittag lagerten. (Sonst habe ich immer geschimpft, wenn wir im Dunkeln eintrafen statt bei gutem Licht und ich mich nicht mehr waschen konnte; der arme Mann muß mich für verrückt halten.) Aber bei Einbruch der Dunkelheit wurde immer klarer, daß wir die Hütten von Muni am Ende der Zuwa-Schlucht nicht mehr erreichen würden; die Flußinsel, die wir über einen umgestürzten Baumstamm erreichten, bot sich als letzte Zuflucht an.
Um uns bis zum Anzünden des Feuers warmzuhalten, laufen wir hin und her und reißen dabei Reisig und trockenes Schilf aus der gefrorenen Erde. Ich fühle mich schuldig, daß die anderen so frieren müssen, besonders Tukten, dessen wenige Habe auf dem Rückweg von Jumla gestohlen wurde. Dankbar nimmt er die Kleidungsstücke an, die ich entbehren kann, obwohl er nicht einmal darum gebeten hat. Tukten scheint nie zu leiden – er ist ein echter Repa. Am Feuer bemühe ich mich, besonders freundlich zu ihm zu sein, und gebe zu, wie dumm es von mir war, seinen guten Rat zurückzuweisen, denn immerhin kennt er den Weg. Aber die Mühe ist nicht nötig, wie soll Tukten mir verzeihen, wenn er sich gar nicht erst befleißigt hat, gekränkt zu sein?
Beim Abendessen komme ich auf den Yeti zu sprechen. Noch unter dem Einfluß des skeptischen Jang-bu beginnt Dawa verlegen zu kichern, aber der ältere Sherpa sieht ihn nur ernst an und sagt gelassen: »Ich habe den Yeti gehört.« Und plötzlich legt Tukten mit schriller Stimme los: »Kak-kak-kak-KAI-ee«, ein wilder, keckernder Laut wie gellendes Gelächter, keiner mir bekannten Tierstimme vergleichbar, der unheimlich von den Wänden des Canyon widerhallt.
Dann stochert Tukten eine Weile still in der Glut herum. Dawa schaut ihn betroffen an, noch überraschter als ich selber. Wie Tukten dann erklärt, ist der Yeti zwar ein Tier, »aber doch mehr Mensch als Affe«. Er selbst hat noch keinen Yeti gesehen und würde sich beim Anblick eines solchen auch sofort abwenden und so tun, als habe er ihn nicht gesehen. Der Yeti läßt sich nur selten blicken, aber wenn man ihn sieht, bringt das Unglück. 297Früher kamen viele Yetis in der Gegend von Khumbu vor, aber zu Lebzeiten von Tuktens Großvater legten die Leute vergiftete Gerste, da die Yetis immer wieder ihre Felder heimsuchten – damals lagen überall tote Yetis herum, hat Tuktens Großvater erzählt.[86]
Er schaut auf und sieht mich nachdenklich über die Flamme hinweg an. Dann sagt er etwas sehr Sonderbares: »Ich glaube, daß der Yeti Buddhist ist.« Als ich es genauer wissen will und frage, ob er einen heiligen Mann, einen Naldjorpa, oder einen Einsiedler mit besonderen Kräften meint, zuckt er nur die Achseln und läßt sich mit einer von ihm ungewohnten Widerspenstigkeit nicht auf nähere Erklärungen ein.
Die Tibeter behaupten, von einem Affengott abzustammen, der eine Inkarnation von Tschenrezigs war; er nahm eine Dämonin, die ihn begehrte, zur Frau und hatte mit ihr sechs langhaarige, geschwänzte Kinder. Er gab ihnen jedoch geweihte Getreidekörner zu essen, bis die Haare und Schwänze kürzer wurden und schließlich ganz abfielen. Nach den alten Schriften[87] erbten einige Kinder die Tugenden ihres Vaters, andere die bösen Eigenschaften der Mutter, »doch alle waren sie kräftig gebaut und mutig«, wie das die heutigen Tibeter auch sind. In der Sherpa-Version dieser Legende lebte ein zum Buddhismus bekehrter Affe als Einsiedler in den Bergen und heiratete eine Dämonin. Ihre Nachkommen, gleichfalls geschwänzt und mit langen Haaren, waren die mi-teh kang-mi, die »Menschenwesen aus dem Schnee« – die Yetis.
Die Sherpa halten die Yetis außerdem für Dhauliyas oder Wächter der Dölma (Tara)[88], dem weiblichen Aspekt von Tschenrezigs. Viele Dhauliyas verkörpern die animistischen Gottheiten vorbuddhistischer Religionen. Vermutlich besteht eine große religiöse Tradition, in deren Mittelpunkt die Mysterien der Sangbai-Dagpo oder Verborgenen Meister stehen. Diese Religion, die mit Sicherheit älter ist als der Lamaismus, ist besessen von der Vorstellung der Seelenwanderung des Menschen in den Körper niederer Anthropoiden. Deshalb verehren die Anhänger dieser Sekte auch den »fürchterlichen Schneemenschen«, und in ihren Ritualen spielen die Köpfe, Hände und Füße verstorbener Exemplare eine Rolle. »Der Einfluß dieser animistischen Glaubenslehre 298auf den tibetischen Buddhismus sollte nicht unterschätzt werden, und … motiviert die einheimische Bevölkerung, diese Geschöpfe vor dem Forschungsdrang der Europäer zu schützen.«[89]
Ich starre Tukten erwartungsvoll an, in der Hoffnung, daß er noch etwas zu dem Yeti sagt, aber er starrt schweigend, mit leuchtenden Augen in die Glut. Eine Kraft erfüllt die Luft, auch Dawa spürt das Unheimliche, und wir tauschen einen betroffenen Blick. Ein Zauberer sitzt uns da am nächtlichen Feuer in der Zuwa-Schlucht gegenüber. Als ich ihn bitte, den Ruf zu wiederholen, tut er es, wobei er mir fest in die Augen sieht, ohne sein gewohntes Lächeln:
»Kak-kak-kak-KAI-ee!«
In der grauen Morgendämmerung der Zuwa-Schlucht taucht ein Pony auf, das seinem Besitzer ausgerissen ist. Mit glasigen, wilden Augen wie eine Erscheinung aus einem Alptraum taumelt es auf den vereisten Uferbänken des Zuwa-Flusses entlang. Wir können es nicht erreichen, können ihm nicht helfen, denn das Eis ist so glatt, daß wir selbst kaum aufrecht stehen können. Mehrfach stürzt die arme Kreatur, die mageren Beine rudern in der Luft, dann endlich hat es festen Boden unter den Füßen und trollt sich hinkend in den Wald davon. Etwas verstört trete ich meinen Weg an.
Nach einer guten Stunde Marsch durch die kalte Schlucht erreiche ich den Polizeiposten unterhalb von Muni, genau das richtige, um uns wieder auf das Leben in den Niederungen vorzubereiten, die wir vor zwei Monaten bei Pokhara verlassen haben. Als die Sherpa eintreffen, durchwühlen die unfreundlichen Gesellen unser ganzes Gepäck einschließlich der Zelte, angeblich auf der Suche nach gestohlenen Kultgegenständen, aber mir ist völlig klar, daß sie einem Tibeter oder Bhotia jeden wertvollen Gegenstand fortnehmen würden, ob er nun der rechtmäßige Eigentümer wäre oder nicht. Als sogar ein Zuschauer seine Finger in meine Habseligkeiten steckt, schiebe ich seine Hand mit einem 299lauten Fluch beiseite, was Tukten zu einem warnenden Kopfschütteln veranlaßt. Als der Mann zu Pferde davonreitet, erklärt Tukten, der neugierige Bursche sei ein höherer Polizeibeamter. (Derselbe Beamte tauchte auch beim nächsten Kontrollposten wieder auf und wies seine Untergebenen an, den Abendländer, der ihn bei Muni so grob angefahren hatte, ohne abermalige Durchsuchung ziehen zu lassen. Es ist schwer, sich auf die unberechenbare, feindselige Unterwürfigkeit der Hindus einzustellen, von denen so viele – selbst die Kinder – ein verdrießliches Gesicht tragen.)
Gleich hinter dem unfreundlichen Polizeiposten beginnt die Zivilisation mit voller Wucht: mit schmutzigen Chetri-Dörfern, allgegenwärtigen Polizeibeamten, Hunden, menschlichen Exkrementen und dem lauten Geplärr von Transistor-Radios. Und schließlich liegt Jumla vor uns, einst die Hauptstadt eines Königreiches, heute eine Grenzstadt, die wie Abfall über die erodierten Hänge am jenseitigen Flußufer verstreut ist.
Mit Ausnahme des halben Ruhetages bei Murwa sind wir elf Tage ununterbrochen marschiert. Ich bin so müde und schmutzig, wie ich noch nie im Leben gewesen bin, und das will etwas heißen. Obwohl es noch früher Nachmittag ist, liegen diese Dörfer südlich des Flusses bereits im Bergschatten. Wir müßten den Fluß überqueren, um in der Sonne das Lager aufschlagen und uns waschen zu können. Aber Dawa hat offensichtlich keine Lust, und auch Tukten führt sich recht sonderbar auf; immer wieder verursacht er überflüssige Verzögerungen oder macht unsinnige Vorschläge, die so unsinnig nicht sind, wenn man seine Beweggründe durchschaut: er verspürt nicht die geringste Lust, noch heute in Jumla anzulangen.
Auch mir liegt nicht viel daran, es kann Tage dauern, bis wir eine Flugverbindung bekommen; einen guten Lagerplatz außerhalb der lauten Stadt zu finden, wäre mir wesentlich lieber. Unentschlossen wandern wir weiter, wobei Tukten einen miserablen Platz nach dem anderen vorschlägt, bis zu einer Brücke, bei der der Fluß Tila in den Zuwa mündet. Gleich daneben liegt ein hübsches Dörfchen namens Dansango, das dank eines tiefen Bergsattels im Westen lange von den Strahlen der Sonne getroffen wird. Das östliche Ende des Flugplatzes von Jumla liegt genau 300auf einem Vorsprung gerade jenseits des Tila, und Dansango ist kaum eine Wegstunde von der Stadt entfernt.
Wir lagern am Fluß neben einem seltsamen weißen Heiligtum, in dessen Hof die Sherpa ihr Feuer anzünden. Bis das Wasser heiß ist, lese ich die von Tukten nach Shey mitgebrachte Post; es sind keine schlechten Nachrichten dabei, und ich bin froh, daß ich die Lektüre so lange aufgeschoben habe. Danach wasche ich mich gründlich und trinke Tee, im Licht der untergehenden Sonne in meinem Zelteingang sitzend. Die Sonnenstrahlen tanzen auf dem Wasser, das ein Stück flußabwärts um einen seltsamen schwarzen Felsblock strudelt und gurgelt. Auf einer Wiese grasen Ponys, die Sonne zündet Funken in ihrem struppigen, am Bauch abstehenden Fell an. Dunklen, unter ihren Lasten tiefgebeugten Gestalten am anderen Ufer verleihen die letzten Sonnenstrahlen einen Heiligenschein. Das Wasser färbt sich dunkel, nur die aufspritzende Gischt bekommt hin und wieder noch einen Lichtstrahl ab. Dann ist die Sonne fort, die Reise ist zu Ende, der Neumond steigt auf.
Ich lasse Dawa als Wächter zurück und gehe mit Tukten über das Plateau am Tila nach Jumla hinein. Der Weg führt über die Felder in die schmutzigen, übelriechenden Straßen der Vorstadt voller Abfall und Lärm. Zum Glück brauchen wir uns hier nicht lange aufzuhalten, denn morgen kommt ein Flugzeug mit Post und Frachtgütern, bringt dann Arbeiter zur Nepalganj-Straße an der indischen Grenze und kehrt hierher zurück, ehe es nach Bhairava und Katmandu abfliegt.
Nochmals müssen wir der Polizei erklären, wer wir sind und was wir vorhaben; dann wechseln wir Geld bei der Bank ein, besuchen eine Teestube und kaufen zum Schluß Ziegenfleisch, Reis, Eier, verschrumpelte Orangen und Äpfel. Tukten, der bei seinem vorausgehenden Besuch offenbar wieder viele Freunde gefunden hat, weiß auch gleich, wo wir Arrak für das für heute abend geplante Abschiedsfest auftreiben können.
Den ganzen Morgen wundere ich mich schon darüber, wie 301viele Leute auf Tukten zugehen und ihn mit Herzlichkeit und Respekt begrüßen. Er selbst bemüht sich nicht um diese Begegnungen, und obwohl es ihm gefällt, daß man ihn so freudig begrüßt, nimmt er die Hochachtung, die man ihm entgegenbringt, mit der ihm eigenen Offenheit, wenn auch etwas verlegen an.
Erstaunlich ist ferner, daß Tukten heute morgen widerspruchslos nach Jumla mitkam, obwohl er gestern abend unsere Ankunft um jeden Preis verzögern wollte. Ich frage ihn, was denn an Gyaltsens Beschuldigungen Wahres sei, habe er wirklich damals in Jumla mit unserer Post durchgehen wollen? Keineswegs gekränkt durch meine Frage erinnert er mich daran, daß er sich nie über Gyaltsen beklagt habe und daß er es diesem überlassen habe, seine Version der ganzen Geschichte zu erzählen. Er zuckt die Achseln, außer der Schlägerei in Ringmo sei nichts gewesen. »Gyaltsen hat als erster zugeschlagen«, sagt Tukten mit einem Lächeln. Er denkt nicht daran, sich weiter zu verteidigen, und ich lasse die Sache auf sich beruhen.
Als einziger Schneegipfel in unserem Blickfeld glänzt die weiße Krone des 7040 Meter hohen Kanjiroba nordöstlich überm Tal des Tila, es ist der Berg, den die Japaner bestiegen haben. Die Berge rings um uns sind niedrig und stark erodiert durch unsachgemäße Bewirtschaftung. Die Stadt Jumla hat alle Nachteile und kaum einen der Vorzüge des zwanzigsten Jahrhunderts, sie wirkt deprimierend, und ich bin froh, nach Dansango zurückzukehren. Dort empfängt uns ein halbnackter Dawa mit sauber gewaschenen Sachen. Er singt vor Freude, daß die schwere Reise nun bald zu Ende geht.
Neben dem weißen Gebäude am Zusammenfluß der beiden Gewässer verbringe ich einen friedlichen Nachmittag in Meditation und lasse meinen Geist im wirbelnden Wasser des Flusses aufgehen. Abends geselle ich mich zu Tukten und Dawa ans Feuer. Wir essen zusammen, trinken unseren Arrak, unterhalten uns wenig und sind satt und zufrieden. Ich beobachte Tukten, ob er viel trinkt, aber er tut es nicht. Da sitzt der alte Soldat mit der halbmondförmigen Narbe auf der Wange, den traurigen Augen und dem wilden Lächeln, das sein Gesicht wie eine mongolische Maske verklärt. In Abwesenheit der anderen Sherpa kommen Tukten und Dawa gut miteinander aus, ich habe nicht ein ärgerliches 302Wort zwischen ihnen gehört, obwohl sie das kleine Zelt miteinander teilen. Dawa bringt Tukten die Achtung entgegen, die diesem zukommt, denn während Dawas Krankheit hat Tukten sich als echter Bodhisattva erwiesen und den jüngeren Sherpa mit derselben Rücksicht und Güte behandelt, mit der er mir begegnet.
Abwärts, abwärts – ein Alptraum des Stürzens in einer außer Kontrolle geratenen Maschine. Ich bezwinge meine Angst durch tiefe Atemzüge und bringe es sogar fertig, meinen Mitpassagieren viel Glück zu wünschen. Im Augenblick des Aufpralls hebt der Kosmos zu tönen an, und eingetaucht ins Rauschen der Flüsse frage ich mich, ob ich tot bin oder lebe. Ich fühle mich teils in, teils außerhalb meines Körpers, ich kämpfe mich von ihm los und will ihn doch nicht fahrenlassen.
Sauber und frisch finden wir uns schon früh auf dem Flugplatz ein, wo wir etwas befangen miteinander umgehen. Tukten hat seine Mütze und die Lumpen fortgeworfen und sieht in meiner Strickjacke recht ordentlich aus. Ich habe vor, ihn in Katmandu als Sirdar oder Sherpa-Führer zu empfehlen. Ich zahle den Sherpa ihren Lohn für die monatelangen treuen Dienste aus und überlasse es Tukten, die einzelnen Posten der Aufstellung für Dawa zu erläutern. Dann nehme ich ihn zur Seite und bezahle ihm den versprochenen Bonus. Ohne eine Frage und ohne das Geld zu zählen, nehmen sie es an, hocherfreut über das erhaltene Trinkgeld. Dawa malt voll Vergnügen zum erstenmal in seinem Leben seinen Namen auf eine Quittung, schon allein über diesen Gedanken schüttet er sich aus vor Lachen. Tukten zeigt sich zwar erfreut darüber, daß ich ihm die Fähigkeiten eines Sherpa-Führers zutraue, stimmt aber, wie mir scheint, mehr aus Höflichkeit als aus Überzeugung meinem Vorschlag zu, ihm in Katmandu eine bessere Stelle zu verschaffen.
Ein Reiter, ein Freund von Tukten, bringt uns als Abschiedsgeschenk eine Flasche Arrak. Gegen Mittag dröhnen Motoren 303aus der Richtung des Kanjiroba heran, und die Maschine landet auf der Graspiste. Mittlerweile kommt die halbe Stadt angelaufen, Pferde scheuen, Kinder laufen im Staub der Maschine hinterher, nur ein Bauer zieht unbeirrt seine grobe Egge am Rand des Flugplatzes durch die steinigen Äcker. Dann braust das Flugzeug nach Süden davon, und aufgeschreckte Krähen flattern über dem Tal.
Die Polizeikontrolle verläuft rasch und ohne Zwischenfall, denn der Beamte ist natürlich wieder ein Freund von Tukten. Dann kehrt die Maschine zurück und hebt zusammen mit uns wieder ab, um uns in wenigen Stunden denselben Weg nach Osten zu bringen, über die dunklen Schluchten und weißen Berghänge, den wir in so vielen harten Wochen zurückgelegt haben. Der Pilot fliegt über eine Paßhöhe zwischen zwei hohen Gipfeln hindurch und macht sich einen Spaß daraus, die Maschine nur knapp zehn Meter über den Talboden zu heben, so daß die eine Tragfläche fast den Eishang schrammt. Der einzige, dem bei diesem idiotischen Leichtsinn nicht mulmig wird, ist Sherpa Dawa, der ehrfurchtsvoll lächelt.
Das Flugzeug steigt über die Gipfelkette hinweg und setzt den Weg nach Südosten fort, vorbei am weißen Gebirgsmassiv des Dhaulagiri und am Annapurna. Als die klaren Konturen des Machhapuchare auftauchen, dreht die Maschine nach Süden ab in Richtung Bhairava, wo der Kali Gandaki aus den Bergen Nepals in die Ebene Indiens eintritt. Während die Maschine einen langgezogenen Kreis beschreibt, fällt ihr Schatten auf einen Ort, der nur Lumbini sein kann. Er liegt am Ende einer befestigten neuen Straße, ein Geschenk japanischer Buddhisten an Nepal. Ich rufe Tukten zu, er solle Dawa auf den Geburtsort des Buddha Shakyamuni aufmerksam machen. Dawa seufzt tief.
Bhairava heißt nicht nur der Ort am Rand der Gangesebene, wo die Maschine zwischenlandet, so lautet auch ein Name für Shiva den Zerstörer. Nach zwei Monaten in großer Höhe macht uns der plötzliche Abstieg auf kaum über Meereshöhe zu schaffen, wir keuchen in der feuchten Hitze. Dann fliegen wir weiter nach Norden und Osten, wobei sich die ganze weiße Zackenwand des Himalaja Gipfel für Gipfel unseren Augen darbietet. Als die Maschine im Bogen auf Katmandu zusteuert, zeigt Tukten auf 304einen Gipfel weit im Osten und sagt, das sei der Everest, der große Lachi Kang, wo Milarepa starb. Ich glaube jedoch, daß er sich irrt. Der Lachi Kang ist zu weit entfernt, als daß man ihn von hier aus sehen könnte.
Bei der Ausrüstungsgesellschaft, wo wir die geliehenen Töpfe und Zelte zurückgeben, ist alles Lob für Tukten vergeblich; der Geschäftsführer kennt Tuktens schlechten Ruf und will nichts mit ihm zu tun haben. Er behauptet, Tukten sei ein Einzelgänger, der sich nicht in die stammesbewußten Sherpagruppen einfügen könne, wie es für ein gutes Expeditions-Team erforderlich ist; außerdem trinke er zuviel und habe ein zu loses Mundwerk. Zweifellos sei er intelligent und tüchtig und führe sich auch lange Zeit hindurch tadellos auf, aber früher oder später – und dabei zeigt der Manager auf die Tüer, hinter der mein Freund wartet – früher oder später läßt der Bursche einen gerade dann im Stich, wenn man ihn am nötigsten braucht.
Tukten kennt die Antwort schon und lächelt vielsagend, als ich herauskomme, nicht etwa um sein Gesicht nicht zu verlieren, sondern um mich zu trösten. Er ist überhaupt nur aus Höflichkeit auf meinen Vorschlag eingegangen. »Genug Arbeit, Sir«, meint Tukten; er nimmt sein Leben an und wird weiterwandern, bis es zu Ende ist.
Plötzlich dämmert es, unsere Wege trennen sich. Der schüchterne Dawa, mit zwei Monatslöhnen glücklich wieder daheim, lächelt mich noch aufgeregt von dem interessanten Flug strahlend an und sieht mir dabei sogar in die Augen. Er kramt sein Englisch hervor und sagt: »Good bye, Sahib!« Tukten besteht jedoch darauf, mich bis zur Hoteltür zu begleiten, und ist betrübt, als ich ihn das Taxi nicht bezahlen lasse. Er möchte, daß wir uns in drei Tagen bei der großen Stupa von Bodhinath noch einmal treffen, etwa sechs Kilometer von hier. Er will dort ein paar Tage bei der Schwester seines Vaters wohnen und sich als guter Buddhist mit der Kraft dieses heiligen Ortes aufladen, ehe er nach Khundu bei Namche Bazar zurückkehrt, um dort den Winter zu verbringen.
Unter den geringschätzigen Blicken des Hotelpersonals schüttele ich Tukten am Portal die Hand, und ich würde ihn am liebsten 305drinnen zum Essen einladen. Doch ich weiß, daß das eine sentimentale Regung ist, eine Demonstration demokratischer Prinzipien, die auf seine Kosten gehen würde, denn das borniert kastenbewußte Personal würde diesem staubbedeckten Sherpa mit dem viel zu großen Pullover den Spaß schon vermiesen. Und selbst wenn sie sich zurückhielten, um sich das Trinkgeld nicht zu verderben – eine im Sonnenschein der Berge geschlossene Freundschaft könnte im trüben Licht des Hotels in Mitleidenschaft gezogen werden. Schon wahr, schon wahr – und doch bin ich traurig darüber, daß ich mich zu müde dazu fühle, mich über diese Schwierigkeiten hinwegzusetzen. Ich lasse ihn ziehen.
Im Rückfenster des Taxis taucht Tuktens Gesicht auf wie ein Geist, während das Taxi im Dunkel verschwindet. Nicht nur, daß dieser Mann mein Freund geworden ist, zwischen uns spannt sich ein Faden wie der schwarze Faden eines Lebensnervs; es gibt da etwas, das noch nicht zum Abschluß gebracht ist, und er weiß das ebensogut wie ich. Ohne daß wir je darüber gesprochen hätten, sehen wir das Leben in derselben Weise oder besser gesagt, ich sehe es so, wie Tukten es lebt. Mit seiner Gegenwart in jedem Augenblick, seiner Freiheit von Bindungen, der Einfachheit seines alltäglichen Beispiels hat er wieder und wieder zu erkennen gegeben, daß er der Lehrer sei, den ich zu finden gehofft hatte. Zuerst habe ich mir das aus einem Instinkt heraus aber doch bloß scherzhaft selbst gesagt, aber nun frage ich mich, ob es nicht tatsächlich so ist. »Wenn du bereit bist«, sagen die Buddhisten, »wird dein Lehrer sich zeigen.« So, wie er mich ansah, mich beobachtete, wartete er auf mich; wäre ich bereit gewesen, hätte er mich vielleicht so weit geführt, »den Schneeleoparden zu sehen«.
Aus Respekt vor ihm bleibe ich stehen und sehe Tukten nach, bis er verschwunden ist. Die Hindus stürzen mit meinem Rucksack und den kleineren Gepäckstücken davon, und ich bleibe einen Augenblick lang allein auf der Hoteltreppe zurück. Im Norden verhüllen dunkle Wolken die Berge, dort schneit es. Ob GS nun auch schon den Kristall-Berg verlassen hat? Hier bin ich, sicher zurück von jenen Gipfeln und einer Reise, die mir schönere und seltsamere Erlebnisse beschert hat, als ich zu hoffen oder mir vorzustellen wagte – weshalb erweckt die sichere Rückkehr ein solches Bedauern?
306
Meine ganze Novemberpost ist irrtümlich nach Jumla geschickt worden, heute morgen muß ich auf dem Flughafen neben dem Postsack gestanden haben. Die India Airlines streiken, niemand weiß, wann der nächste Abflug aus Nepal stattfindet. In meinem »Zimmer mit Bad«, auf das ich mich zwei Monate lang gefreut habe, ist es ungemütlich kalt, und im Bad kommt kein heißes Wasser. Hilflose Hotelangestellte rennen eine Stunde lang rein und raus, während ich rauchend in meinen schmutzigen langen Unterhosen dastehe und warte. Dann defilieren sie an mir vorbei und halten die Hand für einen Bakschisch auf, und der Klempner – welcher von ihnen das auch sein mag – verschwindet wieder; bis morgen, wie ich höre, als ich zu spät entdecke, daß das warme Wasser immer noch nicht läuft. Ich dringe ins Bad des Nebenzimmers ein, und während ich mich noch einseife, versiegt das warme Wasser. Ich stelze zurück in mein eigenes Zimmer und stelle fest, daß es hier jetzt aus dem offen gelassenen Hahn rinnt. Genarrt und plötzlich sehr erschöpft lasse ich mich lachend aufs Bett fallen, aber ich könnte jetzt ebensogut weinen. Im Spiegel schaut mich ein braunes, hageres Gesicht an, das ich seit September nicht gesehen habe. Die blauen Augen im mönchischen Schädel sind seltsam klar, aber das Gesicht ist das eines Unbekannten.
Seit Anfang November zog am 1. Dezember zum erstenmal eine dichte Wolkendecke über Shey Gompa auf. Am 3. Dezember machten sich Jang-bu und zwei Männer aus Saldang mit dem größten Teil des Gepäcks von GS auf den Weg nach Namdo. Am 5. Dezember erschien der eisgraue Wolf und drei seiner Rudelgenossen auf dem Berg von Somdo, wie um Abschied zu nehmen, denn am nächsten Tag brachen GS und Phu-Tsering von Shey auf und zogen über den Shey-Paß und Namgung Gompa direkt nach Namdo, ohne Saldang zu berühren. Von Namdo, wo Jang-bu mit Trägern auf sie wartete, marschierten sie den Nam-Khong flußaufwärts über Tcha und Raka bis zum Steinhaufen mit den großen Argalis-Schädeln am Namdo-Paß. Die Träger hatten versprochen, den Paß noch am selben Tag zu überqueren, weigerten 307sich aber weiterzugehen. Um sechs Uhr abends begann es zu schneien. Und was dann folgte, geht am besten aus den Notizen von GS über den 8. und 9. Dezember 1973 hervor, die er mir in einem Brief aus Katmandu schickte:
8. Dezember. Zehn Zentimeter Schnee bis jetzt, und um sechs Uhr morgens schneit es noch immer. Träger wollen natürlich nach Hause. Treffe einen Kerl, der behauptet, er könne uns über den Paß führen. Haben keine Wahl als zu gehen, werfen die meisten Lebensmittel, alles überflüssige Kochgeschirr, einige meiner Proben usw. fort, aber die Lasten sind immer noch fürchterlich. Der Führer ist nach einer Stunde abgehauen. Das Wetter verschlechtert sich zum Schneesturm. Wir sehen kaum dreißig Meter weit, der Wind peitscht den Schnee waagrecht heran und überzieht uns mit einer Eiskruste. Einmal klärt es sich ein wenig und wir sehen eine Karawane von fünfzig Yaks auf uns zukommen, die schwarzen Tiere im weißen Nichts, einer der phantastischsten Anblicke meines Lebens. Eine Weile können wir ihrer Spur folgen. Dann holt uns zum Glück eine Karawane von sechs Yaks ein, die in unserer Richtung geht und die meinen Koffer übernimmt. Immer noch im Schneesturm ziehen wir über den Paß (5330 Meter), nach einer Stunde klärt sich das Wetter etwas auf. Gehen bis zur Dunkelheit und bleiben bei einer kleinen Höhle.
9. Dezember. Yak-Typ sagt, er werde erst in ein paar Tagen weiterziehen, wenn die Tiere ausgeruht haben. Etwa zwanzig Zentimeter Neuschnee auf dem Weg. Er sagt, eine Last wolle er bis zum nächsten Paß tragen, gegen Vorauszahlung von sechzig Rupien. Bin mißtrauisch, aber habe keine Wahl. Nach einer Wegstunde läßt er sich hinfallen, behauptet, sein Bein verletzt zu haben. Das Gelt hat er im Lager bei einem Freund g elassen. Die Sonne scheint, wir müssen sehen, daß wir weiterkommen. Jang-bu zeigt sein Mißfallen, indem er den Kerl ordentlich verdrischt. Das heilt das Bein, aber der Kerl will nicht über den Paß, sondern schlägt vor, in einer Schlucht zum See hinabzusteigen. Mir gefällt die Sache nicht, kenne diese Schluchten, aber die Sherpa sind dafür und Gyaltsen hat nur 308Segeltuchschuhe. Ich will keine erfrorenen Füße auf dem Gewissen haben. Wir zwingen unseren Yak-Freund, die Last den Canyon hinabzutragen. Um zwei Uhr nachmittags brennt er durch. Aber den größten Teil des Geldes hat er abgedient. Eine höllische Tour: Eisfälle, verschneites, schlüpfriges Felsengeröll, handbreite, vereiste Simse an Steilhängen. Da ich der schwerste von uns allen bin, finden es die anderen nur logisch, daß ich die Eisbrücken über den Bächen als erster ausprobiere. Logisch, aber nicht immer angenehm, einmal falle ich rein, naß bis zur Brust; nasse Füße hole ich mir mehrmals. Abends haben wir den schlimmsten Teil des Canyon hinter uns; endlich ein großes Feuer.
Am 10. Dezember kam die Gruppe aus dem Canyon auf die Niederung am ostarm des Phoksumdo-Sees hinaus, den wir am 25. Oktober gesehen hatten. Und hier war es, wo plötzlich ein Schneeleopard vor GS im fleckigen Schnee aufsprang, der einzige, den er auf dieser Expedition zu Gesicht bekam. Die Spuren eines zweiten Tieres wargen ganz in der Nähe, und da GS die Population innerhalb der Region Shey-Saldang-Phoksumdo auf nur etwa sechs Tiere schätzt, freut mich der Gedanke, daß es ein Pärchen gewesen sein könnte.[90]
An jenem Tag kletterten GS und seine Leute um das steile Nordufer des Sees herum bis zu unserem alten Lager unter den Silberbirken am Phoksumdo-Fluß. Während Jang-bu und Gyaltsen mit dem schweren Gepäck langsamer nachfolgten, brachen GS und Phu-Tsering am nächsten Morgen zu einem Eilmarsch nach Jumla auf, das sie am 15. Dezember erreichten. Zwei Tage später flogen sie nach Katmandu. Aber alle Mühe war vergeblich, der Familie von GS war es nicht gelungen, wie geplant nach Katmandu zu kommen, und wegen des Streiks der Luftfahrtgesellschaften und anderer Widerwärtigkeiten kam GS erst drei Tage nach Weihnachten zu Hause in Pakistan an. Nicht lange danach erreichte ihn die Nachricht aus Nepal, wegen eines blutigen Scharmützels zwischen Khampas und den nepalesischen Truppen an der tibetischen Grenze nördlich von Shey sei das Land Dolpo erneut für alle Ausländer abgeriegelt worden.
309
Zu Fuß und mit dem Fahrrad durchstreife ich die alte Stadt Patan am anderen Flußufer, wo tibetische Flüchtlinge Nachbildungen der alten Kultgegenstände aus dem Lande Bhot anfertigen. Ich besuche die Stupas, Tempel und Pagoden der Gegend und steige die dreihundertdreißig Stufen nach Swayambhunath hinauf, wo der Überlieferung nach Buddha zwischen den Affen und Kiefernbäumen gepredigt haben soll. Am Asan Bazar halte ich Ausschau nach Ongdi, dem Händler, und stoße statt dessen auf einen verlegenen Dawa in einer neuen roten Plastikjacke. Von einem Dieb erstehe ich eine alte, bemalte Tonskulptur des elfköpfigen Avalokiteshvara, dem in seinem Kummer über den heruntergekommenen Zustand der Menschheit der Kopf zerplatzte. Ich treffe auch Pirim und Tulo Kansha, die ich zuletzt sah, als sie voll von Chang und beladen mit Ziegenfleisch in jenem Wald am Phoksumdo-See verschwanden. Sie begrüßen mich mit ihrem herzlichen Lächeln, wie immer völlig zufrieden mit ihrem kargen Leben. Umringt von einer Menge Bhotias aus den Bergen lachen wir einander an und schlagen uns mit fröhlichen Rufen auf die Schultern aus Mangel an anderen Verständigungsmöglichkeiten.
An dem Tag, an dem ich mit Tukten verabredet bin, radle ich durch die spätherbstliche Landschaft des Katmandu-Tales zum alten Heiligtum von Bodhinath. Die aufgemalten großen Augen über der weißen Kuppel sehen mich über die braunen Dächer hinweg an. Die Überlieferung will wissen, daß die Gründung von Bodhinath durch Avalokiteshvara gesegnet wurde und daß das Heiligtum die Überreste von Kasyapa enthält, dem Jünger Buddhas, der wie Tukten lächelte, als der Buddha in stummer Belehrung die Lotusblüte hochhob. Früher wurde das Heiligtum von Pilgerscharen aus Tibet besucht. Die farbige Stupa ist von einem Viereck aus Wohnhäusern und kleinen Läden umgeben, in denen Messing-Buddhas, Heiligenbilder, Urnen und Ritualdolche angeboten werden, ferner Perlen aus Holz, Knochen, Stein und Türkis; Weihrauch, Gebetsmühlen, Zimbeln, Trommeln und Schellen.
In einem dieser Häuser, so hat Tukten gesagt, werde er bei der Schwester seines Vaters wohnen. Ich frage die Bewohner nach ihm, rufe seinen Namen und laufe neben meinem Fahrrad immer wieder im Geviert herum. Die große Nase unter den gemalten 310Augen sieht aus wie ein großes Fragezeichen, die Wimpel und Fahnen flattern im Wind – Tukten? Tukten? Aber nirgends kommt Antwort, niemand hat je von einem Tukten Sherpa gehört. Und schließlich setze ich mich unter den Bodhi-Augen wieder aufs Fahrrad und kehre auf grauen Dezember-Straßen nach Katmandu zurück.
311
Zuerst möchte ich George Schaller danken, daß er mich einlud, ihn nach Dolpo zu begleiten, sowie für seine Kameradschaft während dieser Reise und die Hilfe und den guten Rat, die er mir seitdem gewährt hat; Dr. Schaller war so freundlich, das Manuskript zu lesen und mich auf faktische Irrtümer sowie solche der Akzentuierung hinzuweisen. Herzlichen Dank auch an Donald Hall, der das Buch in seinem frühen Stadium durch seine eingehenden, überaus genauen und inspirierenden Kommentare beförderte in einem Stadium, in dem konstruktive Kritik besonders wichtig war. Marie Eckhart, die viele wertvolle Vorschläge machte, und der Lektorin Elisabeth Sifton von der Viking Press, die sich mit viel Engagement für das Buch einsetzte und es freundlich aber bestimmt gegen Einmischungsversuche des Autors in späteren Stadien verteidigte, gebührt ebenfalls mein Dank.
In ihrer unerschütterlichen guten Laune, ihrer Loyalität und ihrer Großzügigkeit gelang es unseren vorzüglichen Sherpa und guten Freunden Jang-bu, Tukten, Phu-Tsering, Dawa und Gyaltsen sowie unseren jungen Tamang-Trägern, aus einer harten Reise eine sehr glückliche zu machen – keine leichte Aufgabe. Tukten Sherpa schulde ich besonderen Dank – in diesem Buch kommt er wohl besser zum Ausdruck, als ich es hier sagen könnte.
Dr. Robert Fleming, Sr., erwies uns in Katmandu seine Gastfreundschaft und half uns bei der Identifizierung von Vögeln und mit anderen wertvollen Auskünften. Ashok Kuenar Hamal vom nepalesischen Parlament half uns in Dunahi weiter und Dr. Eiji Kawamura von der Kisato-Himalaja-Expedition kümmerte sich auf dem Heimweg großzügig um Dawa Sherpa, John Harrison von der Sterling Library der Yale University half mit Fachliteratur; John Blower (F. A. O. Naturschutzberater der nepalesischen 312Regierung), Robert Fleming, Jr., Michael Cheney, Joel Ziskin und Rodney Jackson trugen mit ihren Auskünften zum Gelingen des Buches bei.
Auf die geduldige Führung der drei Zen-Meister, denen dieses Buch gewidmet ist, und die Werke solcher Kenner der tibetischen Kultur wie Lama Anagarika Govinda, Dr. David Snellgrove, John Blofeld und dem verstorbenen Dr. W. Y. Evans-Wentz habe ich mich häufig bezogen. Lama Govinda und Tetsugen Sensei (zusammen mit Maezumi Roshi) halfen mir, der ich kein Fachmann auf dem Gebiet des Buddhismus bin, mit Kommentaren zum Manuskript, und Robin Kornman, ein Schüler von Chögyam Trungpa, Rimpotsche, sah es auf Irrtümer im Verständnis der Feinheiten der buddhistischen Philosophie sowie bei der Transkription von Namen und Fachbegriffen durch. Zweifellos wird das Buch trotz all dieser Hilfe noch manche Widersprüchlichkeit enthalten – ich wage zu hoffen, daß sie für den, der versteht, warum dieses Buch geschrieben wurde, nicht ins Gewicht fallen.
Schließlich möchte ich noch all den Schriftstellern, Dichtern und Erforschern des menschlichen Geistes danken, deren Worte zu meinem Verstehen beigetragen haben, seien sie in diesem Buch namentlich erwähnt oder nicht.
Peter Matthiessen
313
[1]Schaller, George B., Unter Löwen in der Serengeti. Meine Erlebnisse als Verhaltensforscher, mit einem Geleitwort von B. Grzimek, Herder, 21976, (Fischer Tb. 3502).
[2]Govinda, Lama Anagarika, Der Weg der weißen Wolken. Erlebnisse eines buddhistischen Pilgers in Tibet, Scherz, 51978.
[3]Snellgrove, David, Himalayan Pilgrimage, Oxford 1961.
[4]Matthiessen, Peter, Der Baum der Schöpfung. Erlebnis Ostafrika, Molden, 1973.
[5]Schaller, George B., Mountain Monarchs, Chicago 1977.
[6]Es wurde vermutet, daß der Yoga sich aus einer Synthese der asketischen Lebensführung der Arier mit den ausgefeilten übersinnlichen Überlieferungen der Drawiden entwickelte. »Die erst kürzlich seßhaft gewordenen Nomaden suchten sich körperlich und geistig stark und elastisch zu halten, wie Bogen und Sehne – ihr meistgebrauchtes Sinnbild. Dazu unterzogen sie sich schwierigsten Prüfungen und Entsagungen …« (G. Heard, The Human Venture, New York 1955). Was sie anstrebten, war, die ungeheueren Kräfte des Universums durch sogenannte Siddhis, übersinnliche Kräfte, zu beeinflussen, die sie durch yogische Beherrschung von Körper und Geist entwickelten. Das hat nichts zu tun mit dem passiven Fatalismus, der den östlichen Religionen von westlichen Beobachtern so oft vorgeworfen wird, sondern eher mit einer Annahme jedes Augenblicks, mit Ruhe und Gelassenheit, einer Gelassenheit im Handeln und einer Intensität in der Ruhe. Der in Meditation sitzende Yogi wurde deshalb auch »die Flamme am windgeschützten Ort, die nicht flackert« genannt. (A. K. Coomaraswamy, Buddha and the Gospel of Buddhism, New York 1964.)
[7]Coomaraswamy, Buddha and the Gospel of Buddhism, a. a. O.
[8]Die Höhenangaben in Nepal, die zum größten Teil auf den Vermessungen von Sir George Everest u. a. aus dem 19. Jh. basieren, sind je nach der verfügbaren Karte verschieden. Sie sind in diesem Buch als Annäherungswerte gegeben, wo sie nicht mit dem Höhenmeßgerät von George Schaller ermittelt wurden.
[9]Harrer, Heinrich, Sieben Jahre in Tibet. Mein Leben am Hofe des Dalai Lama, 314Ullstein Tb. 3336; Peissel, Michel, Das verbotene Königreich im Himalaya. Abenteuerliche Expedition in eine mystische Hochkultur zwischen Indien und China, Fischer Tb. 3501; Peissel, Michel, Die Chinesen sind da! Der Freiheitskampf der Khambas, Zsolnay, 1973. Im Jahre 1974 wurden die Khampas endgültig unterworfen und umgesiedelt, nachdem es zu schweren Kämpfen mit nepalesischen Truppen gekommen war, welche dazu führten, daß Dolpo wieder für alle Ausländer abgeriegelt wurde.
[10]Das (tibetische) Buch der Goldenen Regeln, hrsg. von H. P. Blavatsky, zitiert in W. Y. Evans-Wentz, Yoga und Geheimlehren Tibets, O. W. Barth, 21937.
[11]P'ang Chu-shi, genannt der »Laie P'ang«.
[12]Blake, William, The Marriage of Heaven and Hell. Die Hochzeit von Himmel und Hölle, Prestel, 1975.
[13]Graham, Kenneth, Der Wind in den Weiden oder Der Dachs läßt schön grüßen, möchte aber auf keinen Fall gestört werden, Middelhauve, 21975.
[14]Jung, Carl Gustav, Gesammelte Werke, Band XVII, Walter, 31978.
[15]Attar, Farid ud-Din, The Conference of the Birds. A Sufi Fable, Shambala, Boulder 1971.
[16]Waddell, L. Austine, The Buddhism of Tibet, or Lamaism, London 1895. Dorje (oder Vajra) wird übersetzt mit »Donnerkeil«, »heiliger Stein«, »unzerstörbarer Diamant« – gemeint ist die Essenz der kosmischen Energie, die alles andere durchschneidet, ohne davon selbst beeinträchtigt zu werden.
[17]Siehe besonders die verschiedenen imaginativen Werke von H. P. Blavatsky wie z. B. Die Geheimlehre, Adyar, 1975.
[18]Ma Tuan-lin, Non-Chinese People of China, Manuskript in der Sterling Library, Yale-Universität.
[19]Zitiert von A. David-Neel in: Magic and Mystery in Tibet, New York 1971.
[20]Evans-Wentz, W. Y., Yoga und Geheimlehren Tibets, a. a. O.; siehe auch: Gurdjieff, Georg I., Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen, Aurum, 1978.
[21]Eliade, Mircea, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik, Suhrkamp (stw), 1975.
[22]Castaneda, Carlos, Die Lehren des Don Juan. Ein Yaqui-Weg des Wissens, Fischer Tb. 1457; Eine andere Wirklichkeit. Neue Gespräche mit Don Juan, Fischer Tb. 1616; Reise nach Ixtlan. Die Lehre des Don Juan, Fischer Tb. 1809; Der Ring der Kraft. Don Juan in den Städten, Fischer Tb. 3370. Die »Authentizität« des Schamanen Don Juan ist viel diskutiert worden und Castaneda hat selbst zu der Ungewißheit über diese Gestalt beigetragen. Wie dem auch sei – wenn es Don Juan tatsächlich nicht gibt, dann ist diese vorgebliche Ethnologie ein großes Werk der Imagination. Am Wahrheitsgehalt der Lehren des Don Juan, die zumindest authentisch klingen, ändert das wenig; er wird durch gesicherte ethnologische Forschungsergebnisse belegt.
[23]Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr,
daß wir kommen, um hier zu leben.
Wir kommen, um zu schlafen, um zu träumen.
Anonymer aztekischer Autor
315
Manchmal gehe ich umher voller Mitleid mit mir selbst,
und die ganze Zeit
Trägt mich der Große Wind über den Himmel.
Anonymer Autor der Ojibwa-Indianer
[24]Die Sufis nennen diese Kraft Baraka. »Wißt ihr, warum der Scheich in das Ohr eines neugeborenen Kindes haucht? Natürlich wißt ihr es nicht! Ihr tut es ab mit Magie, primitivem Symbolismus für das Leben, aber die praktischen Gründe, das todernste Unternehmen, die innere Bewußtheit zu nähren, dieser Aspekt entgeht euch.« (Ein sufischer Scheich, zitiert in Rafael Lefort, The Teachers of Gurdjieff, Garden City, N. Y., 1968.) Zum Begriff der Baraka siehe auch: Idries Schah, Die Sufis, Diederichs, 1976.
[25]Whorf, Benjamin, »Ein indianisches Modell des Universums«, in: Tedlock, Barbara und Dennis, Über den Rand des tiefen Canyon, Diederichs, 1978.
[26]Laotse, Tao te king, übers. v. Richard Wilhelm, Diederichs, 1978.
[27]Rigveda.
[28]Werner Heisenberg, zitiert von Lawrence LeShan in: »How Can You Tell a Physicist from a Mystic?«, Intellectual Digest, Februar 1972.
[29]Govinda, Lama Anagarika, Der Weg der weißen Wolken, a. a. O.
[30]Evans-Wentz, W. Y., Yoga und Geheimlehren Tibets, a. a. O.
[31]Carl Sagan in: I. S. Shklovsky/C. Sagan, Intelligent Life in the Universe, San Francisco 1966.
[32]Shapley, Harlow, Beyond the Observatory, New York 1967.
[33]Love, Deborah, Annaghkeen, New York 1970.
[34]Nach T. Legget, The Tigers Cave, London 1964. Eine deutsche Übersetzung der Gedichte des chinesischen Zen-Einsiedlers Han Shan (»Kalter Berg«) erschien unter dem Titel: Han Shan, 150 Gedichte vom Kalten Berg, Diederichs, 31980.
[35]Evans-Wentz, W. Y., Milarepa – Tibets großer Yogi, O. W. Barth, bearbeitete Neuausgabe 1978.
[36]Da wir in unserer Sprache keinen adäquaten Begriff kennen, müssen wir in diesem Zusammenhang auf die Sanskrit-Termini zurückgreifen, die allerdings zum Teil von Hindus und Buddhisten unterschiedlich definiert werden: Samadhi (Sammlung, Einswerdung) kann zur Erfahrung von Shunyata (Leerheit) führen, welche in einer plötzlichen Satori- oder Kensho-Erfahrung (jap. für »Einblick in die wahre Wirklichkeit«) aufbrechen kann, aus der sich Prajna (transzendentale Weisheit) entwickeln mag. Prajna führt letztlich zum Zustand des Nirvana (jenseits von Verblendung, Zeit und Raum, Leben und Tod, Werden und Vergehen) und kann als ein andauernder Samadhi-Zustand verstanden werden. Damit schließt sich der Kreis, jede dieser Erfahrungen ist von allen anderen abhängig, und sie alle werden in der Meditation aktualisiert, die in sich eine Verwirklichung des »Weges« ist.
[37]In: The Medium, the Mystic, and the Physicist, New York 1974, stellt Lawrence LeShan die These auf, daß ein solcher tranceartiger Zustand, in dem man 316jenseits von Gedanken und Gefühlen zu einem Übermittler oder »Medium« wird, das sich für alle Energien und alles »Wissen« öffnet, welche frei im Universum zirkulieren, die Phänomene von Telepathie, Präkognition und Geistheilung erklären könnte.
[38]Bucke, Richard M., Die Erfahrung des kosmischen Bewußtseins. Eine Studie zur Evolution des menschlichen Geistes, Aurum, 1975.
[39]Evans-Wentz, W. Y., Yoga und Geheimlehren Tibets, a. a. O.
[40]Nach der englischen Übersetzung von Shimano Eido Roshi.
[41]Siehe: D. T. Suzuki, Der westliche und der östliche Weg. Essays über christliche und buddhistische Mystik, Ullstein Tb. 299.
[42]Der heilige Franz von Sales nannte die mystische Erfahrung eine unmittelbare Erfahrung der Liebe Gottes.
[43]Nach der Maha-Ati-Lehre, zitiert von Chögyam Trungpa in: Mudra, Boulder 1972.
[44]In: Ivan Turgenjew, Neuland.
[45]Herzog, Maurice, Annapurna, New York 1953.
[46]Evans-Wentz, W. Y., Yoga und Geheimlehren Tibets, a. a. O.
[47]Cronin, Edward, »The Yeti«, Atlantic, November 1975. Siehe auch: Cronin/McNeely/Emery, »The Yeti – Not a Snowman«, Oryx, Mai 1973.
[48]Napier, John, Big Foot: The Yeti and Sasquatch in Myth and Reality, New York 1973.
[49]Eliade, Mircea, Images and Symbols, New York 1961.
[50]Snellgrove, David, Himalayan Pilgrimage, a. a. O.
[51]Ebenda.
[52]Snellgrove, David, The Nine Ways of B'on, London 1976.
[53]Blofeld, John, Der Weg zur Macht. Praktischer Führer zur tantrischen Mystik Tibets, O. W. Barth, 1970. Siehe auch Lama Anagarika Govinda, »The Significance of Meditation in Buddhism« (Die Bedeutung der Meditation im Buddhismus), in: Main Currents of Modern Thought. »Die Reflexion ist weder im Spiegel noch außerhalb des Spiegels, und so werden die ›Dinge von ihrer Dinglichkeit befreit, ihrer Isolation, ohne dabei ihrer Form verlustig zu gehen; sie werden ihrer Materialität entkleidet, ohne aufgelöst zu werden‹.« Dies ist die »Spiegel-Lehre« aus dem Atamsaka Sutra, das Nagarjuna zugeschrieben wird, einem indischen Heiligen des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Nagarjuna wird auch die Zusammenstellung des Prajna Paramita Sutra, dem Basistext des Mahayana-Buddhismus, zugeschrieben.
[54]Snellgrove, David, Himalayan Pilgrimage, a. a. O.
[55]David-Neel, Alexandra, Magic and Mystery in Tibet, a. a. O. Siehe auch: Govinda, Der Weg der weißen Wolken, und die Bücher von Carlos Castaneda.
[56]Zitiert in: Eliade, Mircea, Schamanismus und archaische Ekstasetechnik, a. a. O.
[57]»Die Sufis betrachten Wunder als ›Schleier‹, die sich zwischen die Seele und Gott schieben. Die Meister der hinduistischen Spiritualität weisen ihre Schüler eindringlich darauf hin, den Siddhis oder übersinnlichen Fähigkeiten, die sich als ungewollte Nebenprodukte der tief-gesammelten Meditation einstellen 317können, keine Beachtung zu schenken.« (Aldous Huxley in: The Perennial Philosophy, New York 1970.
[58]Hedin, Sven, Central Asia and Tibet, I: Towards the Holy City of Lhasa, Westport, Conn., 1968.
[59]Landor, A. Henry Savage, In the Forbidden Land, New York 1899.
[60]H. E. Richardson/D. Snellgrove, A Cultural History of Tibet, London 1968.
[61]Snellgrove, David, Himalayan Pilgrimage, a. a. O.
[62]Siehe: Gerald Heard, The Human Venture, New York 1955.
[63]Snellgrove, David, Himalayan Pilgrimage, a. a. O.
[64]Govinda, Lama Anagarika, Der Weg der weißen Wolken, a. a. O.
[65]Snellgrove, David, Four Lamas of Dolpo, Cambridge, Mass., 1967.
[66]Waddell, L. A., The Buddhism of Tibet, a. a. O.
[67]Richardson, H. E., »The Karma-pa Sect: A Historical Note«, Journal of the Royal Anthropological Society, Oktober 1958.
[68]Schaller, George B., »A Naturalist in South Asia«, New York Zoological Society Bulletin, Frühjahr 1971.
[69]Geist, V., Mountain Sheep, Chicago 1971.
[70]Ebenda.
[71]David-Neel, Alexandra, Magic and Mystery in Tibet, a. a. O.
[72]Ebenda.
[73]Laotse, Tao te king.
[74]Lowry, Malcolm, Hear Us, O Lord from Heaven Thy Dwelling Place, Philadelphia 1961.
[75]Traherne, Thomas, Centuries of Meditation.
[76]Ebenda.
[77]Beziehungsweise: Stoliczkas Hochgebirgs-Wühlmaus (Alticola Stoliczkanus), (unbenannte) Wühlmaus (Pitymys irene), (unbenannte) Spitzmaus (Sorex avaneus).
[78]Ornstein, Robert, Die Psychologie des Bewußtseins, Fischer Tb. 6317.
[79]The Hundred Thousand Songs of Milarepa, übers. v. Gharma C. C. Chang, 2 Bde., Boulder 1977.
[80]Snellgrove, David, Four Lamas of Dolpo, a. a. O.
[81]Trungpa, Chögyam, Spiritueller Materialismus. Vom wahren geistigen Weg, Aurum, 1975.
[82]Dogen Zenji, Shobogenzo. Die Schatzkammer der Erkenntnis des wahren Dharma, Theseus, o. J.
[83]Schaller, George B., Stones of Silence, New York 1980.
[84]Bhagavadgita.
[85]Love, Deborah, Annaghkeen, a. a. O.
[86]Diese Geschichte ist eine Variation der in der Heimatregion von Tukten überlieferten Legende.
[87]Pawo Tsuk-lar-re Cho-chung III.; zitiert in: Sir Charles Bell, Tibet: Past and Present, London 1969.
[88]Swami Pranavananda, in Journal of the Bombay Natural History Society, 54, 1956.
[89]Yonah N. ibn Aharon, in: I. Sanderson, The Abominable Snowman, Radnor, Pa., 1961, S. 458. Vielleicht wurde Sangbai-Dagpo hier verwechselt mit Sabdag-po, dem »Erd-Meister«, einem lokalen Erdgott, der gefürchtet und geachtet wird, der aber, soweit ich weiß, nicht mit dem »Menschen-Wesen aus dem Schnee« gleichgesetzt wird. Sanbahi' dag-po, der »Verborgene Meister«, ist der Name, mit dem Dorje-Chang, der Urbuddha der Karma-Kargyütpas, in manchen exoterischen Kulten bezeichnet wird. (Siehe: L. A. Waddell, The Buddhism of Tibet, a. a. O.)
[90]Dr. Schallers Empfehlung an die nepalesische Regierung führte zu der Schaffung eines 250 Quadratkilometer großen Naturschutzgebietes, das jedoch formell noch nicht als Tierschutzgebiet anerkannt ist. Das ist sehr schade, denn die Hinweise darauf häufen sich, daß der Schneeleopard in diesem Land bald ausgestorben sein wird.
319